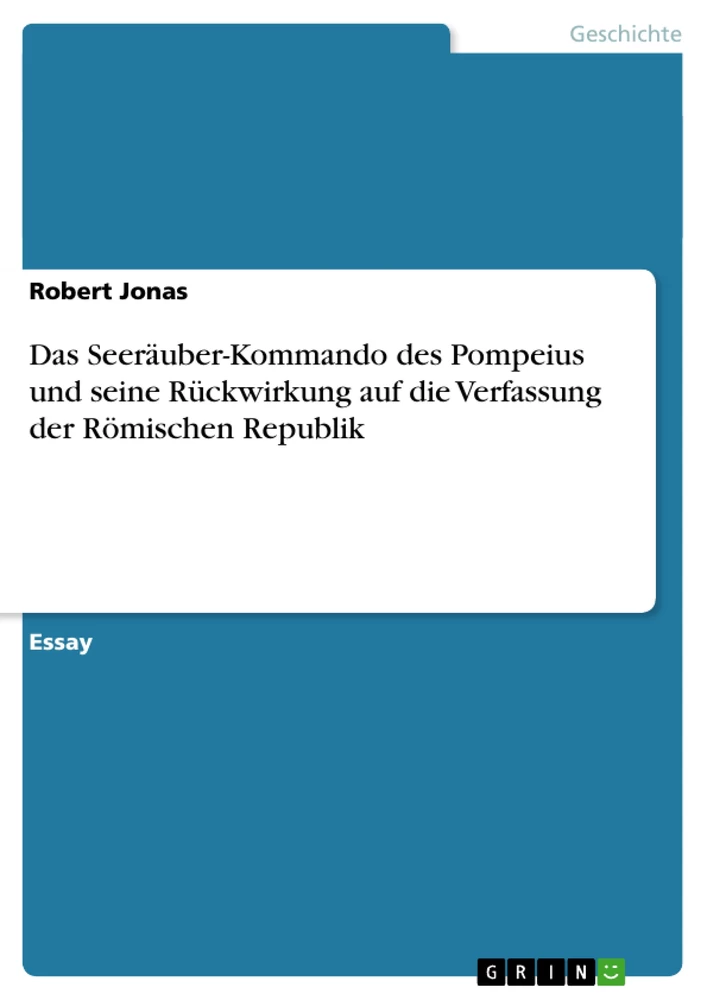Der Feldherr Pompeius wird in den antiken Quellen häufig als ehrgeizig beschrieben, aber auch als jemand, der nicht immer offen aussprach, was er dachte. Dieser Ehrgeiz und sein strategisches Talent hatten ihm bereits außerordentliche imperia, Befehlsgewalten über ein Heer, zwei Triumphe und das höchste Staatsamt des Konsuls beschert, obwohl er weder das der Verfassung nach notwendige Alter erreicht noch den cursus honorum, die Abfolge der politischen Ämter in einer politischen Laufbahn, vorschriftsgemäß eingehalten hatte. Als ihm dann im Jahre 67 das imperium gegen die Seeräuber im Mittelmeer übertragen wurde, zierte er sich scheinheilig vor der Übernahme. Für ihn war das Kommando gewiss eine weitere Genugtuung. Für die Römische Republik aber und ihre seit Jahrhunderten gewachsene und von Sulla kürzlich reformierte Verfassung stellte dieses Kommando eine harte Belastungsprobe, wenn nicht sogar eine Gefahr dar. Ziel dieses Aufsatzes ist es, den Charakter dieser politischen Maßnahme und seiner Rückwirkung auf die res publica zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zustandekommen und Inhalt des Seeräuberkommandos
- Charakterisierung des Seeräuber-Kommandos und Bewertung seiner Rückwirkungen auf die res publica
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz untersucht das Seeräuber-Kommando des Pompeius im Jahre 67 v. Chr. und seine Auswirkungen auf die Verfassung der Römischen Republik. Er analysiert die Hintergründe des Kommandos, seine Inhalte und die politische Bedeutung dieser Maßnahme.
- Die Entstehung und Entwicklung der Piraterie im Mittelmeer
- Die politische Situation in Rom und die Notwendigkeit eines Eingreifens gegen die Piraterie
- Die Vergabe des Kommandos an Pompeius und die damit verbundenen Machtbefugnisse
- Die Auswirkungen des Kommandos auf die römische Verfassung und die Machtverhältnisse
- Die Rolle des Pompeius in der römischen Politik und seine strategischen Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Feldherrn Pompeius und seine politische Karriere vor. Sie beleuchtet seinen Ehrgeiz und sein strategisches Talent, die ihm bereits zu hohen Ämtern verholfen hatten. Der Aufsatz untersucht die politische Bedeutung des Seeräuber-Kommandos für die Römische Republik und seine Auswirkungen auf die Verfassung.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Piraterie im Mittelmeer. Es beschreibt die Bedrohung, die die Piraten für das Römische Reich darstellten, und die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um dem Piratenwesen ein Ende zu bereiten.
Das dritte Kapitel analysiert das Zustandekommen und den Inhalt des Seeräuber-Kommandos. Es beschreibt die politische Situation in Rom, die Notwendigkeit eines Eingreifens gegen die Piraterie und die Vergabe des Kommandos an Pompeius.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Pompeius Magnus, Seeräuber, Piraterie, Römische Republik, Verfassung, Imperium, Macht, Politik, Geschichte, Antike, Mittelmeer.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Seeräuber-Kommando des Pompeius?
Im Jahr 67 v. Chr. erhielt Pompeius durch die Lex Gabinia ein außerordentliches Kommando (Imperium), um die Piratenplage im gesamten Mittelmeer zu bekämpfen.
Warum war dieses Kommando verfassungsrechtlich problematisch?
Es verlieh Pompeius eine enorme, fast uneingeschränkte Macht über weite Teile des Reiches, was das Prinzip der kollegialen und zeitlich begrenzten Ämter der Republik untergrub.
Wie erfolgreich war Pompeius gegen die Seeräuber?
Pompeius war militärisch extrem erfolgreich und konnte die Piraterie im Mittelmeer innerhalb von nur drei Monaten fast vollständig zerschlagen.
Welchen Charakter hatte Pompeius laut antiken Quellen?
Er wurde als ehrgeizig und strategisch talentiert beschrieben, galt aber auch als verschlossen und scheinheilig in Bezug auf seine politischen Ambitionen.
Was bedeutet „Cursus Honorum“?
Es ist die traditionelle Abfolge der politischen Ämter in Rom. Pompeius ignorierte diese Regeln oft, indem er Ämter ohne die nötigen Vorstufen oder das Mindestalter besetzte.
Wie wirkte sich das Kommando auf den Untergang der Republik aus?
Die Vergabe solch gewaltiger Imperia an Einzelpersonen schuf Präzedenzfälle, die den Weg für die spätere Alleinherrschaft und den Zusammenbruch der republikanischen Ordnung ebneten.
- Citation du texte
- Robert Jonas (Auteur), 2009, Das Seeräuber-Kommando des Pompeius und seine Rückwirkung auf die Verfassung der Römischen Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281777