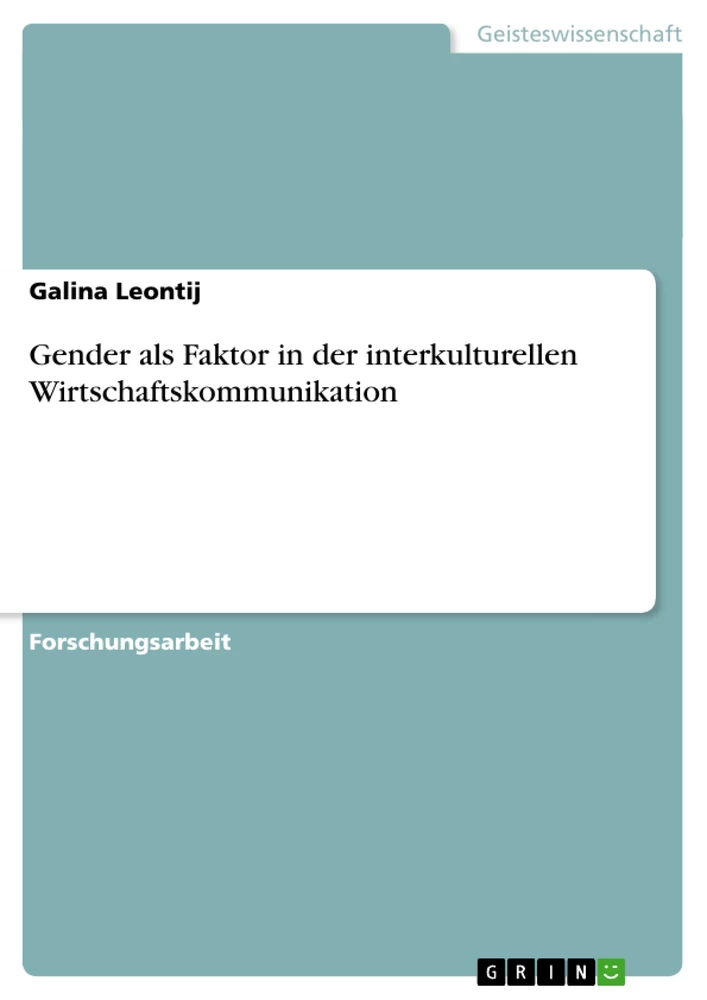Seit der Umstrukturierung der Sowjetunion sind verschiedene gesellschaftliche Veränderungen beobachtbar, die nach erwartbaren Transformationsprozessen (-versuchen, -handlungen etc.) zu unerwarteten Ergebnissen und Enttauschungen geführt haben.
"Die Beispiellosigkeit der eingetretenen Zusammenbruche und fortwirkenden Umbruche sowie die Unmöglichkeiten, diese Situationen im ′Osten′ in Bezug auf den ′Westen′ Europas ... transformations- und/oder modernisierungstheoretisch zu subsumieren, äußern sich ... in der völligen Verschiedenheit der sozialen Existenzgrundlagen, der Inhalte, Formen und Zwecke des Arbeitens, Wirtschaftens, des Erwerbs der Lebensmittel aller Art sowie der Inhalte und Formen sozialer Beziehungen und kultureller Lebensäußerungen in allen Bereichen dieser Gesellschaften - vor, wahrend und nach den Zusammenbrüchen der sie prägenden politischen Systeme.
Dies betrifft schließlich auch die sozialen Verhaltenspositionen und -muster durch die kulturellen Wertesysteme, Normen aller Art sowie die Tradierungen der sozialen Psyche, der politischen Mentalität von Individuen, Gruppen und Schichten in den Generationen und durch sie in den verschiedenen Bereichen der Individuation und Sozialisation." (Geier 1994, S. 115)
Gerade diese Unerwartbarkeit der Umbruche und deren "Produkte" ist für die sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung spannend. Die Relevanzen betreffen sowohl den Bereich der interkulturellen (Wirtschafts-) Kommunikation als auch die Geschlechterforschung; diesen zwei Gebieten widmet sich meine Arbeit.
Die zunehmende (zumindest angestrebte) Offenheit der osteuropäischen Länder für die Einführung der Marktwirtschaft und des Privatunternehmertums ist der Anreiz für verschiedene westliche Unternehmen, den Osteuropa-Markt zu erschließen. Es ist eine zunehmende Internationalisierung des Wirtschaftslebens in Osteuropa beobachtbar, die eine direkte Kommunikation und Kooperation zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen aus West- und Osteuropa erfordert. Dass diese Kontakte auch als problematisch empfunden werden, weil es zur Kollision von unterschiedlichen Gesetzessystemen, Wirtschaftsstrukturen, Mentalitäten etc. kommt, d.h. zur Kollision von zwei unterschiedlichen Kulturen, haben bereits einige Studien erwiesen. Es gibt einige Untersuchungen speziell zur deutschsowjetischen Kommunikation, wie die von Helga Kotthoff (1993), Kappel/Rathmayr (1994) und anderen.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Problemstellung des Forschungsauftrages
- Die erste Erhebungsphase
- Informantenzugang als Faktor der interkulturellen Kommunikation
- Methode
- Methode der Datenerhebung: das verstehende Interview
- Zur Methode der Auswertung
- [was ist erfragbar]
- [groundedtheoretische Auswertung]
- Zukünftiges methodisches Vorgehen in der Feldforschung: Ethnographie
- Reflexionsniveau, Involvement
- Involvement
- Interviewerin als Faktor
- Topoi und Stereotypen
- Zur Theorie der Interkulturalität
- Interkulturelle kommunikative Konfliktpotentiale/Irritationspotentiale/Missverständnisse
- Das Fremde und das Eigene: Stereotype und Vorurteile und ihre Relevanz in interkulturellen Konflikten
- Empirische Befunde
- Zuschreibungen an die Mitglieder der beiden Kulturen:
- ukrainische Passivität
- zur "Geduld" als einer angeblich typischen Charaktereigenschaft der Ukrainer
- Unterschiedliche Erwartungshaltungen ("ich hab dann halt gedacht, hier ist es auch so...") und Stereotypen ("der Osten war immer irgendwie so grau: und UNATTRAKTIV irgendwie")
- Arbeitsmoral und ihre Hintergründe: die deutsche Ordnungsliebe gegen die sowjetische Schlamperei
- Nachwuchs und neue Angestellte, Generationenkonflikte
- Hierarchien und Arbeitsmethoden: "и раз это шеф, это чуть ли не икона на которую надо молиться" (und wenn es ein chef ist, dann ist es beinahe eine ikone die man anbeten soll.)
- Zusammenprallen von unterschiedlichen Autoritätsmethoden: westliche gg. die sowjetisch geprägte
- Ukrainische Auffassung vom Geschäftsleben und westlichen Arbeitsmethoden
- Das Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Managementkonzepten aufgrund unterschiedlicher Gesellschaftsstrukturen
- Konfliktpotentiale in der Alltagsorganisation
- Phänomene der Verwestlichung
- Die Wahrnehmung der Verwestlichung durch Ukrainer/innen und Deutsche/Österreicher kontrastiv
- Die Rolle der aus dem Westen "importierten Kultur" in der ukrainischen Gesellschaft. Einfluss der westlichen auf die ukrainische Kultur
- Veränderungen in der Ukraine: "das Kopieren" der westlichen Standards?
- Gender in der Ukraine
- Das Geschlechterrollenverhalten von Arbeitskräften in multinationalen Betrieben
- "wenn ich in ein Unternehmen rein komme und ich sehe da ist der Präsident eine Frau dann weiß ich dann wird das Geschäft auch funktionieren."
- "die männliche Leitung hat meistens keine Ahnung"
- westliche Managerinnen im ukrainischen Arbeitsumfeld: Schwierigkeiten bei der Autoritätsdurchsetzung
- ukrainische Frauen und Männer aus westlicher Sicht: Arbeitsmoral und Kompetenzen
- Geschlechtersituation der Ukrainer im Allgemeinen: ihre eigene Sicht
- Frauen/Männer und Geschäft: Unternehmensgründung und Aufstiegschancen in den West/Ost-Unternehmen
- Mangel an weiblichen Führungskräften und die Gründe dafür (aus der Sicht meiner Respondenten)
- Chancenverbesserung für Frauen? Keineswegs. Ein Kampf gegen Vorurteile
- Kulturalität/Inszenierung von Männlichkeit/Weiblichkeit in der Ukraine (Impressionen)
- Schlussthesen
- Interkulturelle Kommunikation in deutsch-ukrainischen Joint-Ventures
- Gender-spezifische Herausforderungen in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation
- Einfluss der Verwestlichung auf die ukrainische Gesellschaft und die Geschlechterrollen
- Analyse von Stereotypen und Vorurteilen in Bezug auf ukrainische und deutsche/österreichische Kultur
- Rekonstruktion von Selbst- und Fremdbeschreibungen der Mitarbeiter in den Joint-Ventures
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Forschungsprojekt untersucht die Rolle von Gender in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation am Beispiel deutsch-ukrainischer Joint-Ventures in Kiew. Ziel ist es, die Herausforderungen und Konfliktpotenziale im Kommunikationsfeld dieser Unternehmen aufzudecken und zu analysieren, wie sich die Umwandlung der ukrainischen Gesellschaft von einer sozialistischen zu einer marktorientierten Struktur auf die Geschlechterverhältnisse auswirkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung des Forschungsauftrags vor, die sich mit der Untersuchung der Veränderungen in der ukrainischen Gesellschaft nach der Auflösung der Sowjetunion beschäftigt. Das Projekt untersucht die Relevanz von interkultureller (Wirtschafts-) Kommunikation und Geschlechterforschung in diesem Kontext.
Die erste Erhebungsphase und der Informantenzugang als Faktor der interkulturellen Kommunikation werden beschrieben. Die Methode der Datenerhebung, das verstehende Interview, wird erläutert, ebenso wie die Methode der Auswertung, einschließlich der groundedtheoretischen Auswertung.
Das Kapitel über "Topoi und Stereotypen" analysiert interkulturelle kommunikative Konfliktpotentiale und das Aufeinandertreffen von Stereotypen und Vorurteilen in der deutsch-ukrainischen Wirtschaftskommunikation.
Die empirischen Befunde zeigen, wie Zuschreibungen an die Mitglieder der beiden Kulturen, unterschiedliche Arbeitsmoral und Managementkonzepte zu Konflikten führen.
Der Abschnitt über "Phänomene der Verwestlichung" analysiert die Wahrnehmung und den Einfluss der Verwestlichung durch Ukrainer/innen und Deutsche/Österreicher.
Das Kapitel "Gender in der Ukraine" untersucht das Geschlechterrollenverhalten von Arbeitskräften in multinationalen Betrieben, die Geschlechtersituation der Ukrainer im Allgemeinen und die Situation von Frauen und Männern in der Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf Unternehmensgründung und Aufstiegschancen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Interkulturelle Kommunikation, Gender, Wirtschaftskommunikation, deutsch-ukrainische Joint-Ventures, Stereotype, Vorurteile, Verwestlichung, Geschlechterrollen, Arbeitsmoral, Managementkonzepte, und gesellschaftliche Transformationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieses Forschungsprojekts?
Es untersucht Gender als Faktor in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation am Beispiel deutsch-ukrainischer Joint-Ventures in Kiew.
Welche Stereotype treten in der Kommunikation auf?
Häufige Topoi sind die „ukrainische Passivität“ oder „Geduld“ im Gegensatz zur „deutschen Ordnungsliebe“.
Wie wird das Thema Gender in ukrainischen Betrieben analysiert?
Die Arbeit beleuchtet das Rollenverhalten von Führungskräften, Schwierigkeiten westlicher Managerinnen und Aufstiegschancen für Frauen in der Ukraine.
Welche Methode wurde für die Datenerhebung genutzt?
Es wurden verstehende Interviews durchgeführt und nach der Grounded Theory ausgewertet.
Was bedeutet „Verwestlichung“ in diesem Kontext?
Es geht um das Kopieren westlicher Standards und den Einfluss importierter Kultur auf die ukrainische Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Welche Rolle spielen Hierarchien in der Zusammenarbeit?
Es prallen unterschiedliche Konzepte aufeinander, etwa die westliche Autoritätsmethode gegen eine eher sowjetisch geprägte, fast „ikonische“ Verehrung des Chefs.
- Citation du texte
- Galina Leontij (Auteur), 2001, Gender als Faktor in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28177