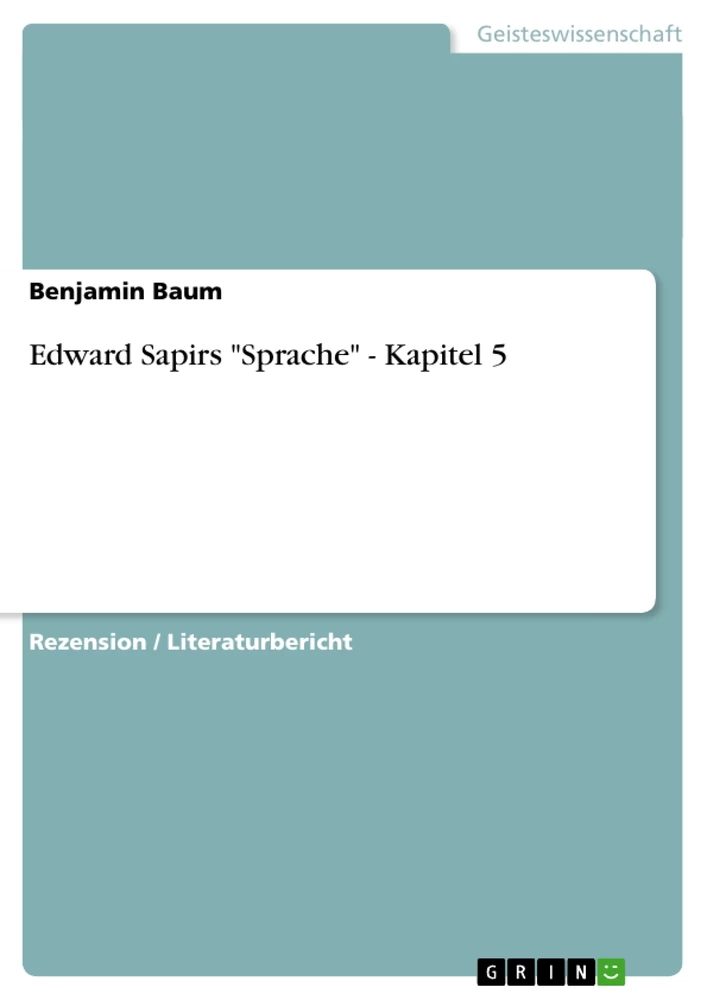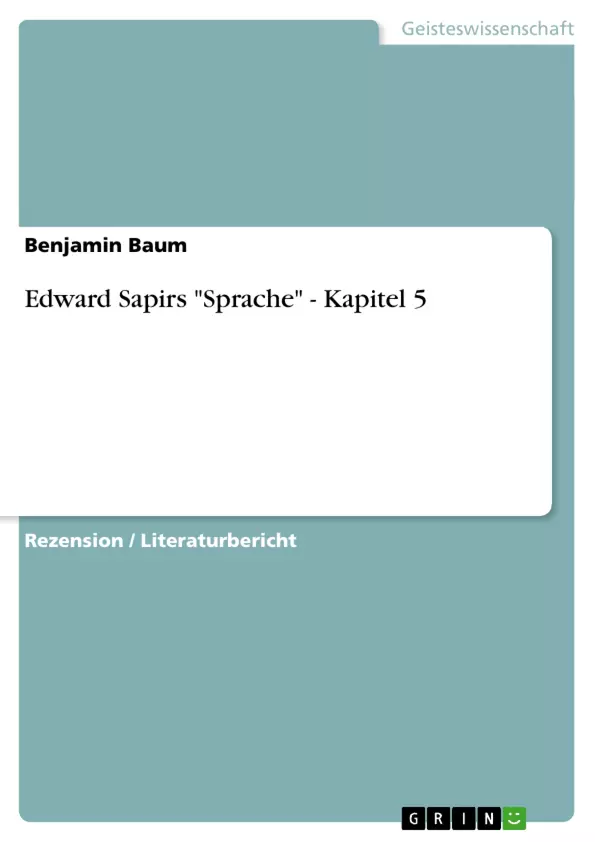Die Theorie vom sprachlichen Drift, die Sapir´sche Sprachtypologie – und natürlich die Sapir-Whorf-Hypothese über das Verhältnis von Sprache und Denken: das sind die Schlagworte, die man aus heutiger Sicht mit dem Sprachwissenschaftler Edward Sapir in Verbindung bringt. Sie haben ihm einen festen Platz in der Riege jener Linguisten eingebracht, die durch neuartige Hypothesen und ungewohnte Denkansätze die Geschichte ihrer Wissenschaft wesentlich mit bestimmt haben. Geboren wurde Sapir am 26. Januar 1884 in Lauenburg, Pommern. Nachdem er 1889 zusammen mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten emigriert war, studierte er ab 1901 an der Columbia University in New York zunächst Deutsche Philologie und Indogermanistik. 1905 schloss er sein Germanistikstudium mit einer Arbeit über Herders „Theorie des Ursprungs der Sprache“ ab. Anschließend studierte er Anthropologie. Im Jahre 1909 folgte nach verschiedenen Forschungstätigkeiten in Washington, Berkeley, Philadelphia und Oregon die Promotion über die Grammatik einer Indianersprache namens Takelma. Ein Jahr später wurde Sapir als Leiter der Division of Anthropology ans National Museum nach Ottawa berufen. Hier beschäftigte er sich neben dem Nootka und der Na-Dene-Sprachen auch mit der Poesie. Insgesamt zeichnete Sapir 39 Indianersprachen auf, schlug 1921 die erste Gesamtgliederung der nordamerikanischen Indianersprachen vor. Bei seiner stets interdisziplinären Arbeit verband er Feldforschung mit theoretischer Linguistik, Anthropologie mit Sprachwissenschaft.
Im Jahre 1925 folgte Sapir einem Ruf aus Chicago, wo er eine Professorenstelle am Department of Sociology and Anthropology annahm. Hier gründete er zusammen mit anderen Sprachwissenschaftlern die Language - das Organ der Linguistic Society of America. 1931 schließlich wechselte Sapir zur Yale University, New Haven, wo er als Professor für Anthropologie und Linguistik die erste dortige School of Linguistic gründete. Am 4. Februar 1939 erlag Sapir seinem zweiten Herzanfall. Sapirs linguistisches Hauptwerk Sprache - Eine Einführung in das Wesen der Sprache - zugleich sein einziges abgeschlossenes Buch - stellt noch heute einen geschätzten und viel zitierten Fundus einflussreicher Theorien und Hypothesen innerhalb der Sprachwissenschaft sowie des amerikanischen Strukturalismus dar. Sapirs Theorie der sprachlichen Relativität sieht jede Sprache in engem Zusammenhang mit Geisteswelt und Kultur der betreffenden Sprachgemeinschaft...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Edward Sapir und die Sprache
- 1.1 Leben und Werk
- 1.2 Das Kapitel „Form und Sprache: Grammatische Begriffe“
- 1.4 Die grammatischen Formenkategorien
- 2. Was braucht die Sprache?
- 2.1 Die unentbehrlichen Sprachbegriffe
- 2.2 Entbehrliche Sprachbegriffe
- 3. Zu Form und Funktion
- 3.1 Drei Gründe für den Vorrang der Form vor der Funktion
- 4. Sapirs neue Begriffstafel
- 4.1 Die vier neuen Kategorien
- 4.2 Die Abstufung der Anschaulichkeit
- 5. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Edward Sapirs linguistischem Werk und konzentriert sich insbesondere auf sein Kapitel „Form und Sprache: Grammatische Begriffe“. Ziel ist es, Sapirs Konzepte und Theorien zu erläutern und deren Bedeutung für die Sprachwissenschaft aufzuzeigen.
- Sapirs Leben und Werk
- Analyse des Kapitels "Form und Sprache: Grammatische Begriffe"
- Die Rolle grammatischer Begriffe in Sapirs Theorie
- Sapirs Unterscheidung zwischen anschaulicher Vorstellung und sprachlicher Form
- Die Bedeutung von Form und Funktion in Sapirs Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Edward Sapir und die Sprache: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das Leben und Werk von Edward Sapir, einem einflussreichen Sprachwissenschaftler. Es skizziert seine wichtigsten Beiträge zur Linguistik, darunter seine Theorie des sprachlichen Drifts, seine Sprachtypologie und die Sapir-Whorf-Hypothese. Der Fokus liegt auf Sapirs interdisziplinärem Ansatz, der Feldforschung mit theoretischer Linguistik und Anthropologie verbindet. Seine bedeutende Arbeit an indigenen Sprachen Nordamerikas und seine Gründung der Language, dem Organ der Linguistic Society of America, werden hervorgehoben. Das Kapitel betont Sapirs nachhaltigen Einfluss auf den amerikanischen Strukturalismus und die Sprachwissenschaft im Allgemeinen.
1.2 Das Kapitel „Form und Sprache: Grammatische Begriffe“: Sapir untersucht in diesem Kapitel die Beziehung zwischen sprachlicher Form und der dahinterliegenden "Welt der Begriffe". Am Beispiel des englischen Satzes "the farmer kills the duckling" analysiert er die Grundbegriffe und zeigt, wie die Sprache anschauliche Vorstellungen vereinfacht und abstrahiert. Er argumentiert, dass Sprachen nicht jede einzelne Vorstellung durch ein eigenes Wort ausdrücken können und dass die Sprache eine "gewisse Hilflosigkeit" aufweist, indem sie die detaillierte Beschreibung der Wirklichkeit zugunsten von verkürzten, formelhaften Ausdrücken vernachlässigt. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen der anschaulichen Bedeutung eines Wortstamms und der synthetisch entstandenen Bedeutung eines komplexeren Wortes, wie z.B. "farmer" im Vergleich zu "farm".
Schlüsselwörter
Edward Sapir, Sprachphilosophie, Grammatische Begriffe, Sprachtypologie, Sapir-Whorf-Hypothese, Form und Funktion, Sprachliche Relativität, Amerikanischer Strukturalismus, Indianersprachen, Wortstamm, Anschaulichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Edward Sapir und die Sprache"
Was ist der Inhalt des Textes "Edward Sapir und die Sprache"?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das linguistische Werk von Edward Sapir, insbesondere sein Kapitel "Form und Sprache: Grammatische Begriffe". Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf Sapirs Konzepten und Theorien und deren Bedeutung für die Sprachwissenschaft.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Sapirs Leben und Werk, eine detaillierte Analyse des Kapitels "Form und Sprache: Grammatische Begriffe", die Rolle grammatischer Begriffe in Sapirs Theorie, die Unterscheidung zwischen anschaulicher Vorstellung und sprachlicher Form, die Bedeutung von Form und Funktion in Sapirs Sprachphilosophie, sowie seine Sprachtypologie und die Sapir-Whorf-Hypothese.
Was ist das zentrale Thema des Kapitels "Form und Sprache: Grammatische Begriffe"?
In diesem Kapitel untersucht Sapir die Beziehung zwischen sprachlicher Form und der dahinterliegenden "Welt der Begriffe". Er analysiert, wie Sprache anschauliche Vorstellungen vereinfacht und abstrahiert und argumentiert, dass Sprachen nicht jede Vorstellung durch ein eigenes Wort ausdrücken können. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen der anschaulichen Bedeutung eines Wortstamms und der synthetisch entstandenen Bedeutung komplexerer Wörter.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Edward Sapir, Sprachphilosophie, Grammatische Begriffe, Sprachtypologie, Sapir-Whorf-Hypothese, Form und Funktion, Sprachliche Relativität, Amerikanischer Strukturalismus, Indianersprachen, Wortstamm und Anschaulichkeit.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst die Kapitel: 1. Edward Sapir und die Sprache (inkl. Unterkapitel zu Leben und Werk und dem Kapitel "Form und Sprache: Grammatische Begriffe"), 2. Was braucht die Sprache?, 3. Zu Form und Funktion, 4. Sapirs neue Begriffstafel und 5. Literaturangaben.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Zielsetzung des Textes ist es, Sapirs Konzepte und Theorien zu erläutern und deren Bedeutung für die Sprachwissenschaft aufzuzeigen. Er soll ein Verständnis für Sapirs Ansatz und seine Beiträge zur Linguistik vermitteln.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text eignet sich für Studierende der Linguistik und Sprachwissenschaft, sowie für alle, die sich für die Sprachphilosophie und das Werk von Edward Sapir interessieren. Das Verständnis setzt ein grundlegendes Wissen über linguistische Konzepte voraus.
Wo finde ich weitere Informationen zu Edward Sapir?
Weitere Informationen zu Edward Sapir finden Sie in wissenschaftlichen Publikationen und Lexika der Linguistik. Das Kapitel "Literaturangaben" im Text selbst könnte ebenfalls weiterführende Literatur auflisten.
- Citar trabajo
- Benjamin Baum (Autor), 2004, Edward Sapirs "Sprache" - Kapitel 5, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28182