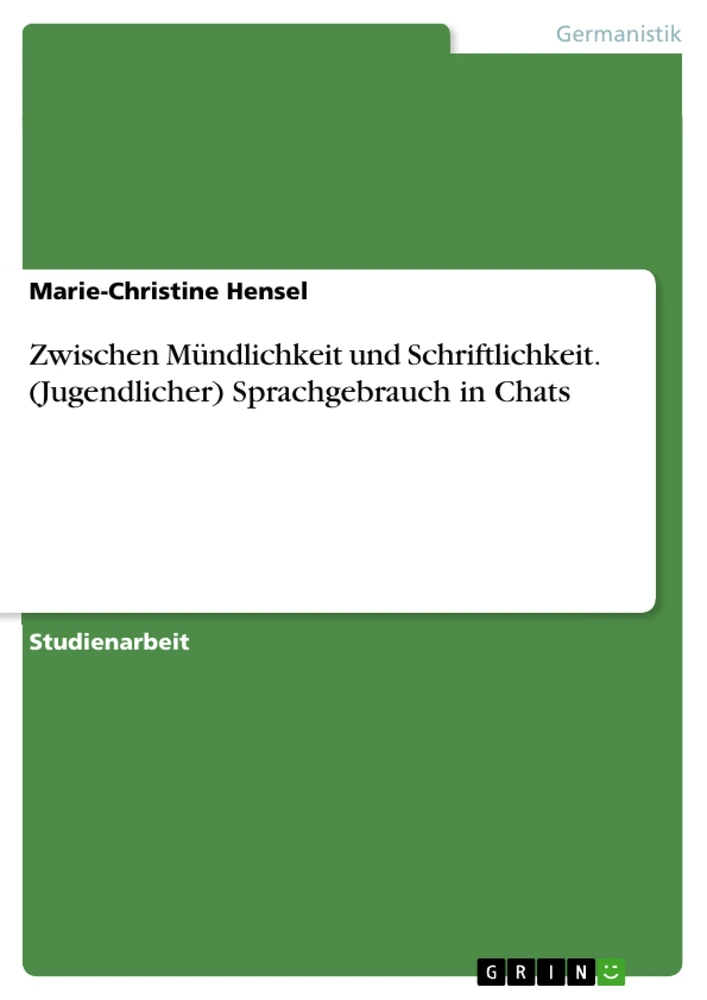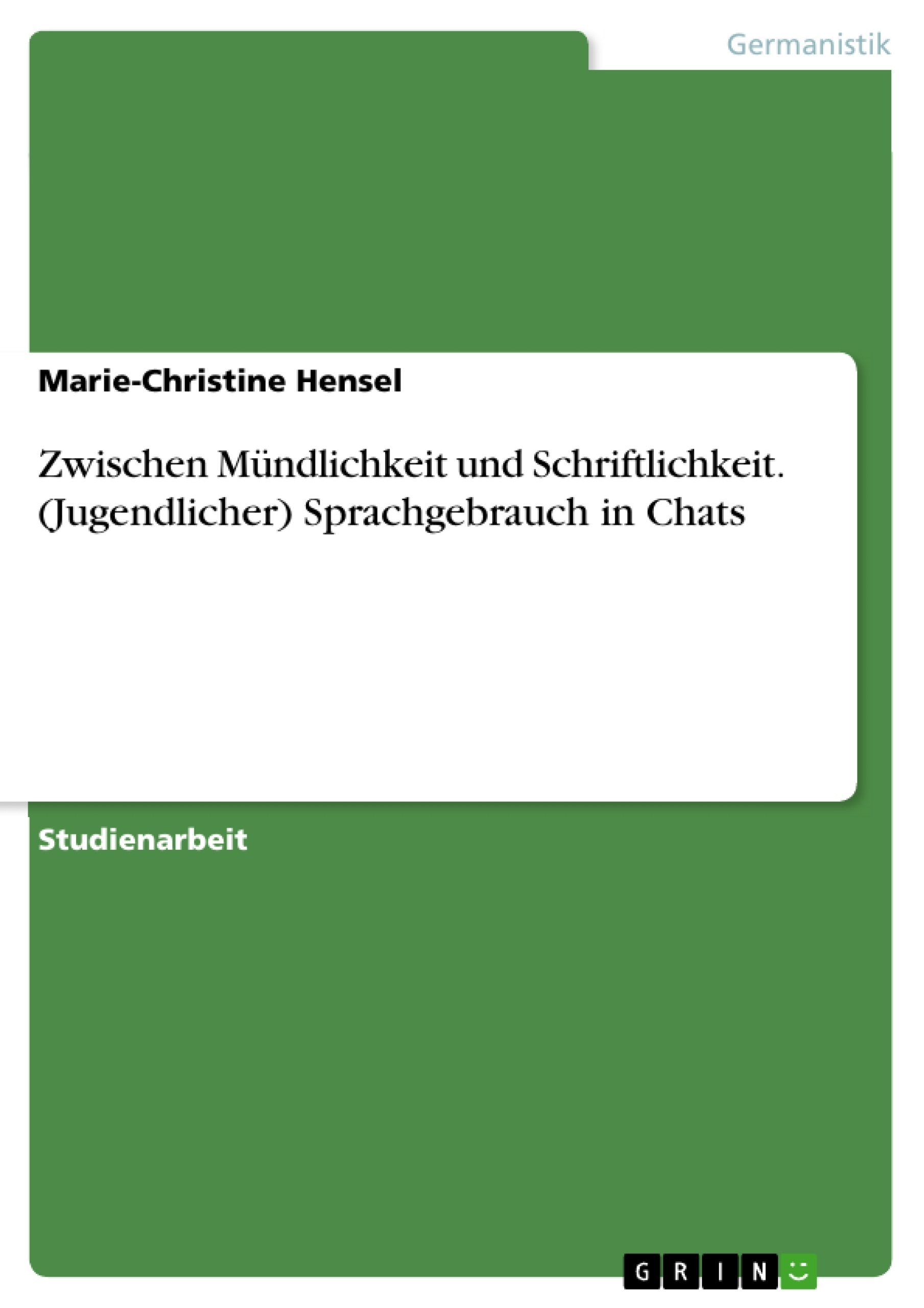Seit Mitte der neunziger Jahre hat das Internet als Informations- und Kommunikationsmittel einen enormen Zuwachs erfahren. Heutzutage ist jedem Nutzer der elektronische Austausch von Informationen und Nachrichten möglich. Seit der Etablierung des Smartphones ist dieser Informations- und Nachrichtenaustausch nicht einmal mehr an den Computer gebunden. Das Smartphone wird immer mehr zu einer multifunktionalen Kommunikationszentrale, die es dem Verbraucher ermöglicht, unabhängig vom Ort jederzeit Daten zu erhalten. So lösen die angebotenen Internetdienste wie Chats, Diskussionsforen oder E-Mails klassische Mitteilungsträger wie den Brief nahezu gänzlich ab. Die Entstehung und Nutzung der, durch das Smartphone eröffneten, neuen Kommunikationsformen, führen zu einem neuen Forschungsfeld für die Sprachwissenschaft. Gerade der Chat stellt ein notwendiges Verständigungsmittel für den Mitteilungsaustausch dar. Als die Service-Leistungen der Smartphones, die heute zur Selbstverständlichkeit geworden sind, 2002 noch vage Visionen waren, prognostizierte Freyermuth, dass das Internet zu einem ‚Evernet‘ werden würde und die permanente Vernetzung und die ‚Immer-an-Kommunikation‘ zum Regelfall. Diese Prognose ist zur heutigen Realität geworden. Insbesondere für Jugendliche ist die Nutzung von Chats und Instant-Messengern nicht mehr wegzudenken. Eine besonders tragende Rolle spielt dabei die Applikation ‚WhatsApp‘ (Eine Form des Chats für Smartphones). Binnen vier Jahren hat WhatsApp rund 450 Millionen aktive Nutzer gewonnen, Tendenz stark steigend. Der WhatsApp Gründer Jan Koum berichtet davon, dass täglich fast eine Millionen Nutzer hinzukommen. Durch derartige Zahlen wird deutlich: Ein Großteil der Kommunikation findet heute über das Internet statt. Das Schreiben hat durch die Medien einen neuen Status bekommen. Dies hat, wie sich bereits vermuten lässt, auch Auswirkungen auf unseren Schreibstil. Es wurde bereits hinreichend festgestellt, dass sich in den computerbasierten Kommunikationsformen des Internets tatsächlich ein neuer Schreibstil etabliert hat, der viele Elemente beinhaltet, die als ‚konzeptionell Mündlich‘ einzuordnen wären.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mündlichkeit & Schriftlichkeit aus sprachtheoretischer Sicht
- 2.1 Konzeption & Medium - Mündlichkeits-/ Schriftlichkeitsmodell
- 2.2 Allgemeine Merkmale der gesprochenen Sprache
- 3. Charakteristische Merkmale Internetbasierter Kommunikation
- 3.1 Abgrenzung gegenüber Chats
- 3.2 Mediale und konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei WhatsApp
- 4. Auswirkungen von konzeptioneller Mündlichkeit und beschleunigter Textproduktion
- 4.1 Zum Korpus
- 4.2 Linguistische Besonderheiten handybasierter Kommunikation am Beispiel von WhatsApp
- 4.3 Variationen
- 4.3.1 Zeichensetzung
- 4.3.2 Groß- und Kleinschreibung
- 4.3.3 Umgang mit der Orthographie
- 4.3.4 Smileys & Emotikons als Imitation parasprachlicher Informationen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Sprachgebrauch in Chats, insbesondere WhatsApp, im Kontext des Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodells von Koch/Oesterreicher. Ziel ist es, die Einordnung von WhatsApp-Kommunikation in dieses Modell zu analysieren und die Schwierigkeiten dabei zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf einer Korpusanalyse und untersucht die linguistischen Besonderheiten dieser Kommunikationsform.
- Das Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodell von Koch/Oesterreicher
- Die Charakteristika internetbasierter Kommunikation, speziell von Chats
- Linguistische Besonderheiten der WhatsApp-Kommunikation
- Die Einordnung von WhatsApp in das Nähe-/Distanz-Kontinuum
- Die Auswirkungen von beschleunigter Textproduktion auf den Sprachgebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den rasanten Aufstieg des Internets und insbesondere von Smartphones als Kommunikationsmittel. Sie hebt die Bedeutung von Chats, vor allem WhatsApp, als dominierende Kommunikationsform hervor und prognostiziert, basierend auf den Entwicklungen der frühen 2000er Jahre, die heutige Realität der „Immer-an-Kommunikation“. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des neu entstandenen Schreibstils in der smartphonebasierten Kommunikation und seiner linguistischen Besonderheiten, insbesondere im Kontext des Modells von Koch/Oesterreicher.
2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit aus sprachtheoretischer Sicht: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es das Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodell von Koch/Oesterreicher einführt. Es erklärt die Unterscheidung zwischen Medium (phonisch/graphisch) und Konzeption (gesprochen/geschrieben) und beschreibt das Nähe-/Distanz-Kontinuum. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, die traditionelle Unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener Sprache auf neue Kommunikationsformen anzuwenden und argumentiert für die Notwendigkeit eines differenzierteren Ansatzes.
3. Charakteristische Merkmale Internetbasierter Kommunikation: Kapitel 3 widmet sich den spezifischen Merkmalen internetbasierter Kommunikation im Vergleich zu traditionellen Chat-Formaten und WhatsApp. Es analysiert mediale und konzeptionelle Aspekte der Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Kontext dieser neuen Kommunikationsformen und legt den Grundstein für die spätere empirische Untersuchung. Hier wird die Abgrenzung zu anderen Chat-Formen und die Besonderheiten von WhatsApp beleuchtet.
4. Auswirkungen von konzeptioneller Mündlichkeit und beschleunigter Textproduktion: Der Kern der Arbeit liegt in diesem Kapitel, welches eine empirische Untersuchung der linguistischen Besonderheiten der WhatsApp-Kommunikation anhand eines Korpus darstellt. Es analysiert Variationen in Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung, Orthographie und den Gebrauch von Smileys und Emoticons. Das Kapitel untersucht, wie diese Besonderheiten die Einordnung der WhatsApp-Kommunikation in das Modell von Koch/Oesterreicher beeinflussen.
Schlüsselwörter
Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Koch/Oesterreicher-Modell, Chat, WhatsApp, Smartphone-Kommunikation, Korpusanalyse, Linguistik, Nähe, Distanz, sprachliche Besonderheiten, Textproduktion, mediale Mündlichkeit, konzeptionelle Mündlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachgebrauch in WhatsApp-Chats
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Sprachgebrauch in WhatsApp-Chats im Kontext des Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodells von Koch/Oesterreicher. Der Fokus liegt auf der Analyse der Einordnung von WhatsApp-Kommunikation in dieses Modell und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Die Analyse basiert auf einer Korpusanalyse und untersucht die linguistischen Besonderheiten dieser Kommunikationsform.
Welches Modell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet das Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodell von Koch/Oesterreicher als theoretischen Rahmen. Dieses Modell unterscheidet zwischen dem Medium (phonisch/graphisch) und der Konzeption (gesprochen/geschrieben) und beschreibt ein Nähe-/Distanz-Kontinuum.
Welche Aspekte der WhatsApp-Kommunikation werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene linguistische Besonderheiten der WhatsApp-Kommunikation, darunter Variationen in der Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung, Orthographie und den Gebrauch von Smileys und Emoticons. Es wird untersucht, wie diese Besonderheiten die Einordnung der WhatsApp-Kommunikation in das Modell von Koch/Oesterreicher beeinflussen.
Wie wird die Untersuchung durchgeführt?
Die Untersuchung basiert auf einer Korpusanalyse. Ein Korpus von WhatsApp-Nachrichten wurde analysiert, um die linguistischen Besonderheiten dieser Kommunikationsform zu identifizieren und zu beschreiben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Mündlichkeit & Schriftlichkeit aus sprachtheoretischer Sicht, Charakteristische Merkmale Internetbasierter Kommunikation, Auswirkungen von konzeptioneller Mündlichkeit und beschleunigter Textproduktion, und Fazit. Kapitel 2 beschreibt das theoretische Modell, Kapitel 3 untersucht die spezifischen Merkmale von internetbasierter Kommunikation im Vergleich zu traditionellen Chats, und Kapitel 4 präsentiert die empirische Analyse der WhatsApp-Kommunikation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Koch/Oesterreicher-Modell, Chat, WhatsApp, Smartphone-Kommunikation, Korpusanalyse, Linguistik, Nähe, Distanz, sprachliche Besonderheiten, Textproduktion, mediale Mündlichkeit, konzeptionelle Mündlichkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die WhatsApp-Kommunikation im Kontext des Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmodells von Koch/Oesterreicher einzuordnen und die Herausforderungen bei dieser Einordnung zu beleuchten. Ein weiteres Ziel ist die Beschreibung der linguistischen Besonderheiten dieser Kommunikationsform.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Das Fazit des fünften Kapitels wird in der gegebenen Vorschau nicht explizit zusammengefasst. Die FAQs basieren auf den verfügbaren Informationen aus dem Inhaltsverzeichnis, den Zielen und der Kapitelzusammenfassung.)
- Citar trabajo
- Marie-Christine Hensel (Autor), 2013, Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. (Jugendlicher) Sprachgebrauch in Chats, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281837