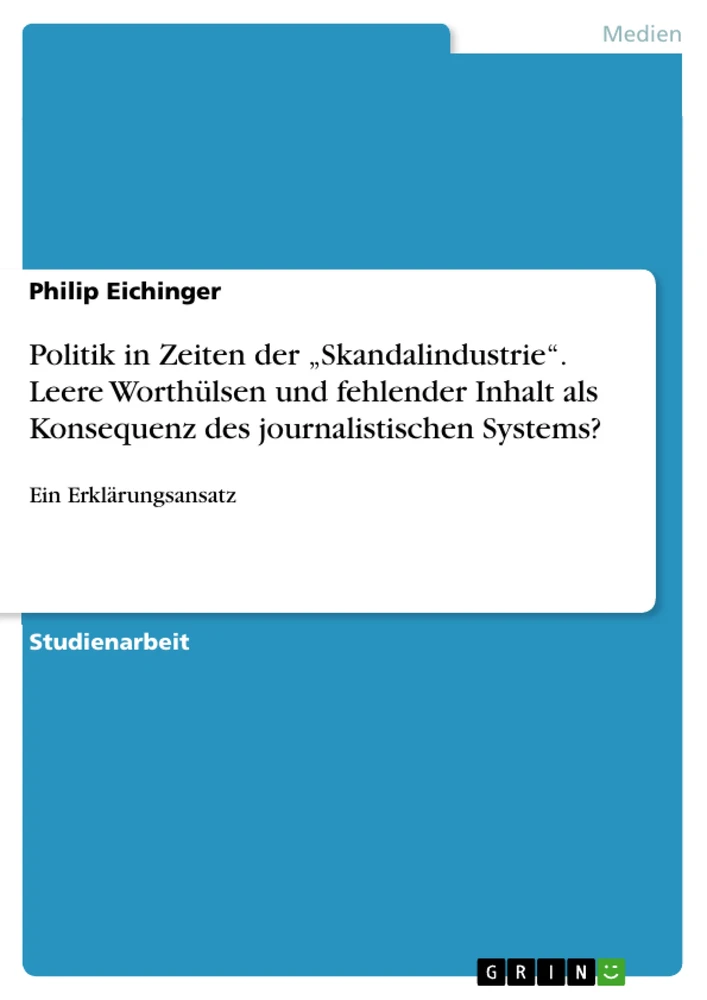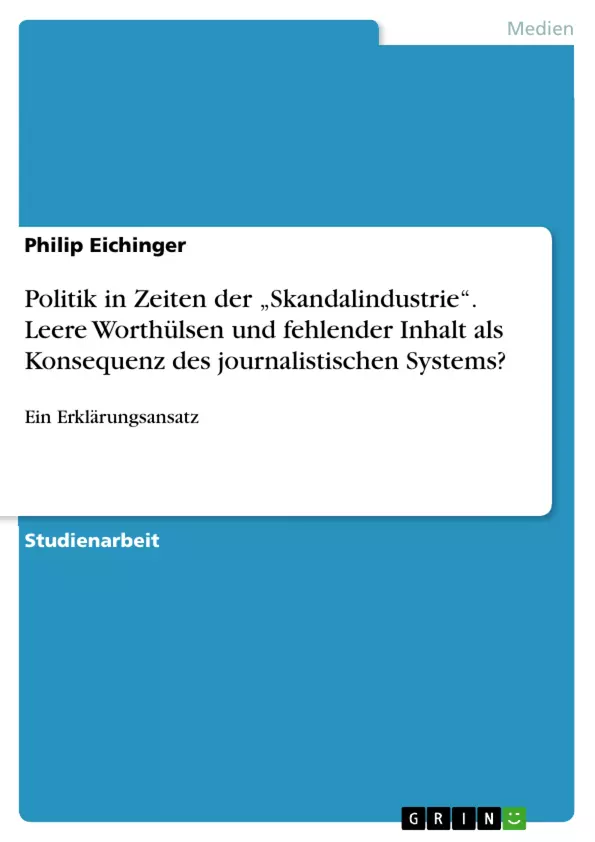„Der neueste Skandal hat schon den Fuß in der Tür, bevor sie sich hinter dem Vorigen schließen kann“ schrieb der deutsche Soziologe Karl Otto Hondrich im Jahre 2004 in seinem Werk „Enthüllung und Entrüstung“. Doch wie kommt es dann, dass erst im letzten Jahrzehnt der Skandal und der Begriff des Skandals in der Wissenschaft weitgehend gesteigerte Aufmerksamkeit erfuhren?
So kritisierten noch im Jahr 2004 und auch 1999 unter anderem Neu, Thompson et al: „Der Skandal, so scheint es, ist das Selbstverständlichste von der Welt, über das sich kein Wort zu verlieren lohnt“. Manch böse Zungen mögen behaupten, dass das gesteigerte Interesse am Skandal damit verbunden ist, dass die Wissenschaft selbst Opfer von Skandalen wurde. Guttenberg, Schavan, Koch-Mehrin und Chatzimarkakis sind nur einige wenige, wenngleich prominente Beispiele aus dem politischen Umfeld, deren wissenschaftliche Arbeit auf die eine oder andere Art ein Plagiat darstellte und in Konsequenz des „Tabubruchs“ skandalisiert wurden. Selbstverständlich geht der politische Skandal jedoch weit über plagiierte Doktorarbeiten hinaus. Wulf, Köhler und Boetticher stellen nach Thompson und Neckel den genuin als „klassischen“ Skandalfall bezeichneten Vorfall dar. Ein vermeintlicher Korruptionsverdacht, Wirtschaftsinteressen von Politkern und die (sexuelle) Affäre mit einer Minderjährigen könnten als „Normalfall“ des politischen Skandals bezeichnet werden – diese Fälle haben das größte Skandalpotential.
Doch was bedingt Medien, eine derartige Versessenheit auf Fehltritte der Politiker und den gestörten politischen Ablauf zu zeigen? Längst lässt sich sagen, dass die normativ angenommene „Watchdog“-Aufgabe insbesondere bei boulevardesken Medien den Mechanismen zur extremen Skandalisierung zumindest teilweise gewichen ist. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich dabei mit dem Aufzeigen und Analysieren der Medienmechanismen, die zu einer deutlichen Tendenz, beziehungsweise, zu einem Wandel von gesteigerter Skandalisierung führen können. Dabei sollen im Fazit mögliche, theoretische Antworten auf die Fragen, „Warum reagieren Politiker derartig zurückhaltend? Was bedingt die Verstrickung in inhaltslose „Worthülsen?““, gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der (politische-) Skandal als Medienereignis
- 2.1 Die Bedeutung des Skandals als demokratisches Grundeelement
- 2.2 Die elementaren Mechanismen der Skandalisierung
- 3. Theorie des Journalismus
- 3.1 Der Skandal als mediale Sensation
- 4. Strukturelle Veränderungsprozesse und Gegebenheiten der Medien
- 4.1 Ökonomische Aspekte
- 4.2 Mechanismen der Boulevardisierung
- 5. Fazit: Das „Journalismus-Dilemma“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mechanismen der Medien, die zu einer gesteigerten Skandalisierung in der Politik beitragen. Sie analysiert, warum Politiker vermehrt auf inhaltslose Aussagen zurückgreifen und wie die Medien diese Entwicklung beeinflussen. Das Ziel ist es, mögliche Antworten auf die Fragen nach den Ursachen für zurückhaltende Politiker und die Verbreitung inhaltsloser Aussagen zu finden.
- Der politische Skandal als Medienereignis und seine Definition
- Die Rolle der Medien bei der Skandalisierung
- Ökonomische und strukturelle Faktoren der Boulevardisierung
- Der Einfluss von Skandalen auf die Politikverdrossenheit
- Das „Journalismus-Dilemma“: Watchdog-Funktion vs. Skandalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Aufmerksamkeit, die der politische Skandal in den letzten Jahren in der Wissenschaft erfahren hat, im Gegensatz zu früheren Einschätzungen, die den Skandal als selbstverständlich abgetan hatten. Sie führt Beispiele für politische Skandale an, die weit über Plagiate hinausgehen und das Skandalpotential von Korruptionsverdacht, Wirtschaftsinteressen und sexuellen Affären hervorhebt. Die Einleitung thematisiert die Angst von Politikern vor Medienkritik und die daraus resultierende Tendenz zu inhaltsloser Politik, die durch Beispiele wie Aussagen des bayerischen Finanzministers Markus Söder illustriert wird. Abschließend wird die Zielsetzung der Arbeit formuliert: die Analyse der Medienmechanismen, die zu einer gesteigerten Skandalisierung führen.
2. Der (politische-) Skandal als Medienereignis: Dieses Kapitel untersucht die Definition des politischen Skandals. Ausgehend von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes „scandalon“ als „Tierfalle“, wird die heutige, ironische Doppeldeutigkeit im Kontext von Politik und Medien diskutiert. Es wird die große Anzahl an „skandalverdächtigen“ Ereignissen in der Medienlandschaft hervorgehoben. Das Kapitel stellt klar, dass ein Skandal nicht einfach ein aufgedeckter Missstand ist, sondern das Ergebnis öffentlicher Kommunikation über bestehende Missstände. Es werden die notwendigen Merkmale eines Skandals erläutert: ein Missstand, der als bedeutend, vermeidbar und schuldhaft empfunden wird und allgemeine Empörung hervorruft. Schließlich wird die besondere Rolle des politischen Skandals in der medialen Berichterstattung herausgestellt, da er potenziell alle Bürger betrifft.
Schlüsselwörter
Politischer Skandal, Medien, Skandalisierung, Boulevardisierung, Politikverdrossenheit, Journalismus, Medienmechanismen, öffentliche Kommunikation, Normverletzung, Watchdog-Funktion, Inhaltslosigkeit, Rhetorik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Skandalisierung in der Politik
Was ist der Hauptgegenstand der Analyse?
Die Arbeit analysiert die Mechanismen der Medien, die zu einer gesteigerten Skandalisierung in der Politik beitragen. Im Fokus stehen die Ursachen für zurückhaltende Politiker und die Verbreitung inhaltsloser Aussagen, sowie der Einfluss der Medien auf diese Entwicklung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Analyse umfasst die Definition des politischen Skandals als Medienereignis, die Rolle der Medien bei der Skandalisierung, ökonomische und strukturelle Faktoren der Boulevardisierung, den Einfluss von Skandalen auf die Politikverdrossenheit und das „Journalismus-Dilemma“: Watchdog-Funktion vs. Skandalisierung.
Wie wird der politische Skandal definiert?
Der politische Skandal wird nicht einfach als aufgedeckter Missstand definiert, sondern als Ergebnis öffentlicher Kommunikation über einen Missstand, der als bedeutend, vermeidbar und schuldhaft empfunden wird und allgemeine Empörung hervorruft. Die Arbeit bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung von "scandalon" als "Tierfalle" und diskutiert die heutige, ironische Doppeldeutigkeit im Kontext von Politik und Medien.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Skandalisierung?
Die Arbeit untersucht, wie Medienmechanismen zu einer gesteigerten Skandalisierung beitragen. Es werden ökonomische und strukturelle Faktoren der Boulevardisierung analysiert, und der Einfluss der Medienberichterstattung auf die Wahrnehmung und Verbreitung von Skandalen wird beleuchtet. Der Aspekt des „Journalismus-Dilemmas“, also der Balance zwischen der Watchdog-Funktion und der Tendenz zur Skandalisierung, wird ebenfalls thematisiert.
Welche Faktoren tragen zur Boulevardisierung bei?
Die Analyse betrachtet ökonomische und strukturelle Faktoren, die zur Boulevardisierung beitragen und somit die Skandalisierung verstärken. Konkrete Beispiele und Mechanismen werden im Detail untersucht.
Welchen Einfluss haben Skandale auf die Politikverdrossenheit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Berichterstattung über politische Skandale und der Zunahme von Politikverdrossenheit in der Bevölkerung.
Was ist das „Journalismus-Dilemma“?
Das „Journalismus-Dilemma“ beschreibt den Konflikt zwischen der wichtigen Watchdog-Funktion des Journalismus (Überwachung der Politik) und der Tendenz zur Skandalisierung, die die Glaubwürdigkeit der Medien und das Vertrauen in die Politik beeinträchtigen kann.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der (politische-) Skandal als Medienereignis, Theorie des Journalismus, Strukturelle Veränderungsprozesse und Gegebenheiten der Medien und Fazit: Das „Journalismus-Dilemma“.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politischer Skandal, Medien, Skandalisierung, Boulevardisierung, Politikverdrossenheit, Journalismus, Medienmechanismen, öffentliche Kommunikation, Normverletzung, Watchdog-Funktion, Inhaltslosigkeit, Rhetorik.
- Arbeit zitieren
- Philip Eichinger (Autor:in), 2013, Politik in Zeiten der „Skandalindustrie“. Leere Worthülsen und fehlender Inhalt als Konsequenz des journalistischen Systems?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281839