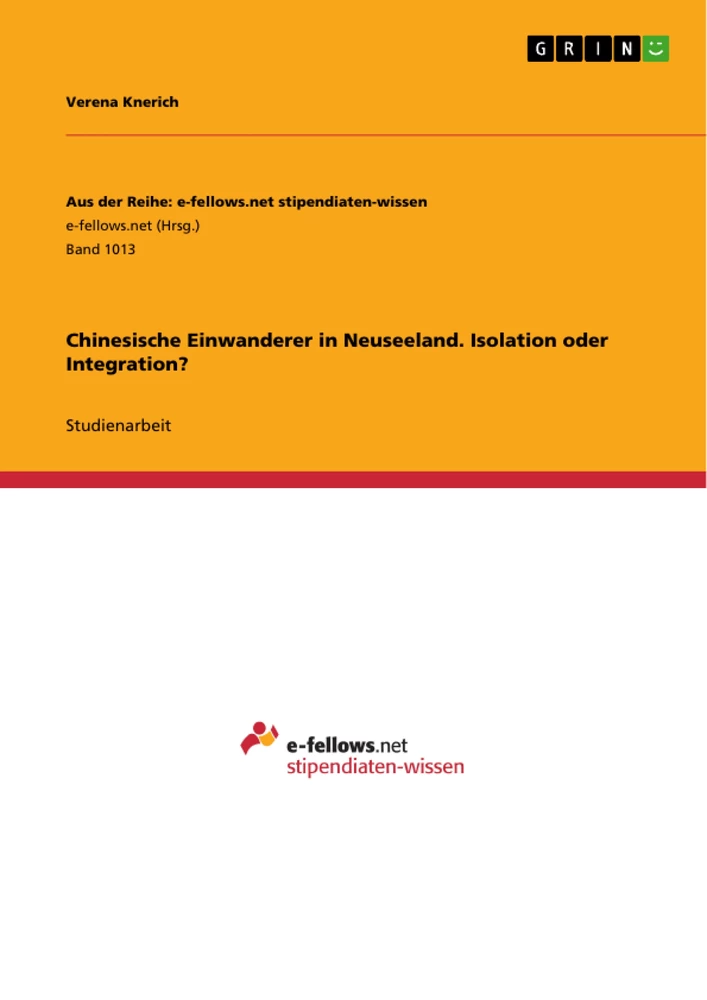Bei der oberflächlichen Betrachtung der Bevölkerung Neuseelands kristallisieren sich primär zwei als homogen empfundene Gruppen heraus: die indigenen Maori auf der einen und die englisch sprachigen Pakeha auf der anderen Seite. Rein historisch gesehen war diese Aufteilung bei der Besiedlung Neuseelands Anfang des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts das erklärte Ziel. Es sollte eine Art ”better Britain” geschaffen werden (Sinclair 1986: 79), deren Siedler bestenfalls angelsächsischer Herkunft und damit idealtypische Weiße waren. Als eigentliches Gründungsdokument wird häufig der 1840 unterschriebene Vertrag von Waitangi angeführt, der auch heute noch für manche als Beleg der fundamentalen Bikulturalität der Nation aus Maori und Pakeha, also Nicht-Maori, dient.
In der Realität gestaltet sich die Identitätskonstruktion Neuseelands wesentlich komplexer, als dieses dualistische Prinzip suggerieren mag. Nicht erst durch den sprunghaften Anstieg primär asiatischer Immigranten Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Bevölkerungskomposition innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert.
Die vorliegende Arbeit soll mit Fokus auf die Chinesen, als eine der wichtigsten der Immigrationsgruppen, einen ersten Eindruck vermitteln, welche Mechanismen der Integration und Isolation in Gang traten und treten, wenn es um die Aushandlung sowohl der eigenen wie auch der neuseeländischen Identität als Ganzes geht.
Nach einem kurzen historischen Überblick zur Geschichte der chinesischen Einwanderung werden im zweiten Teil einige Faktoren untersucht, welche bei der Aushandlung der eigenen Identität der Einwanderer zum Tragen kommen.Dies hat nicht nur wirtschaftliche Folgen sondern auch Auswirkungen darauf, wie sich die Einwanderer innerhalb der neuseeländischen Bevölkerung positionieren und wie beispielsweise die Beziehung zu den Maori charakterisiert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Neuseeland - eine bikulturelle Nation?
- Historischer Überblick zur Einwanderung mit Fokus auf China als Herkunftsland
- Erste Immigration: Diskriminierung und Bande zum Mutterland (1860er bis 1940)
- Assimilationsdruck und Isolation (nach 1950)
- Integration der ethnischen Identität in Immigrationsdiskurse (ab 1980er)
- Identitätsstiftende Einflüsse auf und durch Chinese New Zealanders
- transnationale Bindungen und ökonomische Implikationen
- Positionierung innerhalb der neuseeländischen Bevölkerung
- "One country, many peoples”- heutiger Diskurs um Multikulturalität in Neuseeland
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Identitätskonstruktion chinesischer Einwanderer in Neuseeland und untersucht, wie sich die Integration und Isolation in den Diskursen um die eigene und die neuseeländische Identität niederschlagen. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der chinesischen Einwanderung in Neuseeland, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Integration und untersucht die Rolle transnationaler Bindungen und ökonomischer Implikationen für die Identität der Einwanderer.
- Historische Entwicklung der chinesischen Einwanderung in Neuseeland
- Integration und Isolation von chinesischen Einwanderern
- Identitätskonstruktionen im Kontext der neuseeländischen Gesellschaft
- Transnationale Bindungen und ökonomische Implikationen
- Multikulturalität in Neuseeland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Frage nach der bikulturellen Identität Neuseelands und zeigt, dass die Realität komplexer ist als das dualistische Prinzip von Māori und Pakeha suggeriert. Die Arbeit konzentriert sich auf die chinesische Einwanderergemeinschaft als Beispiel für die Herausforderungen der Integration und Isolation in Neuseeland.
Der erste Teil der Arbeit bietet einen historischen Überblick über die chinesische Einwanderung in Neuseeland. Er beleuchtet die Anfänge der Einwanderung im Zusammenhang mit den Goldfunden in Otago und die damit verbundene Diskriminierung und Isolation. Der Abschnitt beschreibt die "White New Zealand Policy" und die damit verbundene Stigmatisierung der Chinesen als "Yellow Peril".
Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Identitätsstiftenden Einflüsse auf und durch Chinese New Zealanders. Er analysiert die transnationalen Bindungen zum Mutterland und die ökonomischen Implikationen der Einwanderung. Der Abschnitt beleuchtet die Positionierung der Chinesen innerhalb der neuseeländischen Bevölkerung und die Beziehung zu den Māori.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die chinesische Einwanderung, Neuseeland, Identität, Integration, Isolation, Multikulturalität, Transnationalität, ökonomische Implikationen, "White New Zealand Policy", "Yellow Peril", Māori, Pakeha.
Häufig gestellte Fragen
Ist Neuseeland eine rein bikulturelle Nation?
Obwohl oft nur die Māori und die Pakeha (Europäer) thematisiert werden, ist die Realität komplexer. Vor allem durch asiatische Einwanderer hat sich die Bevölkerungskomposition dramatisch verändert, was das dualistische Prinzip infrage stellt.
Was war die „White New Zealand Policy“?
Dies war eine historische politische Ausrichtung, die darauf abzielte, Neuseeland als „besseres Britannien“ mit Siedlern angelsächsischer Herkunft zu bewahren, was zur Diskriminierung nicht-weißer Einwanderer führte.
Welche Rolle spielten chinesische Einwanderer in der Geschichte Neuseelands?
Die erste große Einwanderungswelle war mit den Goldfunden in Otago in den 1860er Jahren verbunden. Chinesen waren jedoch oft starker Diskriminierung und Stigmatisierung (z. B. als „Yellow Peril“) ausgesetzt.
Wie unterscheidet sich Integration von Isolation bei chinesischen Migranten?
Die Arbeit untersucht Mechanismen wie transnationale Bindungen zum Mutterland und wirtschaftliche Netzwerke, die einerseits die eigene Identität stärken, andererseits aber auch zur sozialen Isolation führen können.
Wie ist die Beziehung zwischen chinesischen Einwanderern und den Māori?
Die Studie beleuchtet die Positionierung der chinesischen Gemeinschaft innerhalb der neuseeländischen Gesellschaft und wie sie sich im Spannungsfeld zwischen der indigenen Bevölkerung und der europäischen Mehrheit verortet.
- Citar trabajo
- Verena Knerich (Autor), 2014, Chinesische Einwanderer in Neuseeland. Isolation oder Integration?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281949