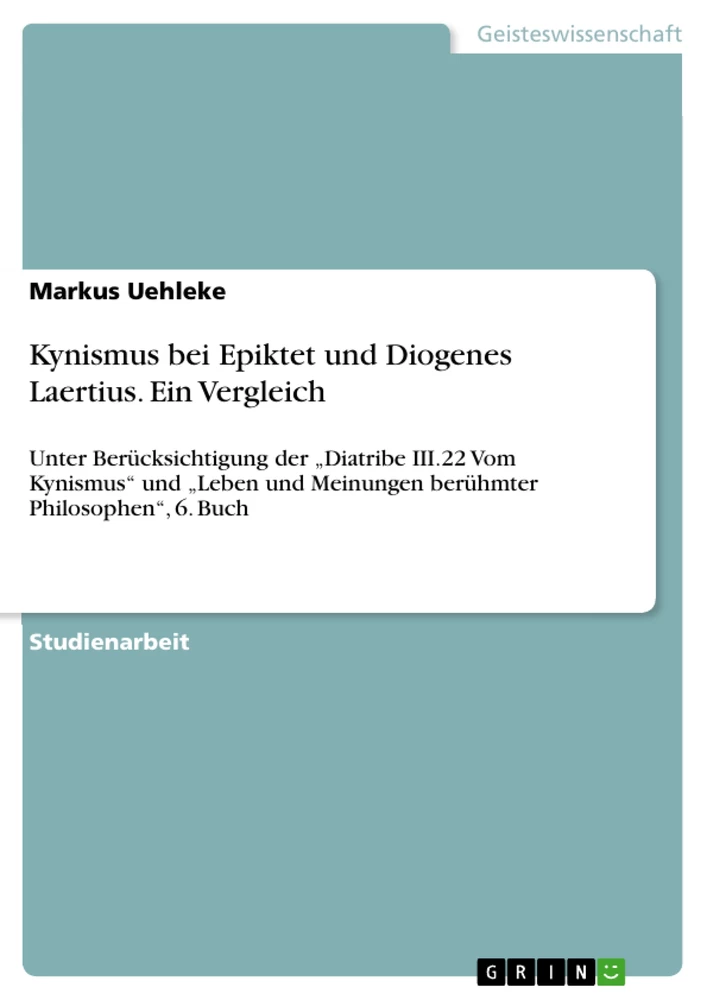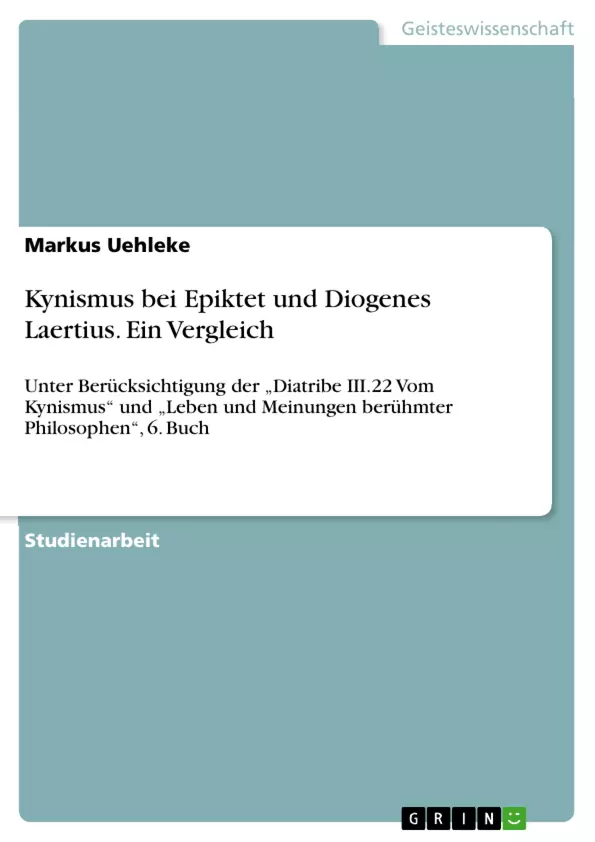Halten wir also die Übereinstimmungen und Unterschiede der Kynismuskonzeptionen bei Diogens Laertius und bei Epiktet fest. Auffällig ist zunächst zwar die Betonung des Individuums und des Exklusivitätsgedankens, zu welchem der Mensch gewisse Fertigkeiten mit sich bringen muss, um überhaupt Kyniker zu werden. Epiktet stellt wohl treffend fest, dass niemand als Kyniker geboren werden kann. Sozialisierungseinflüsse und persönliche Prägung spielen wohl eine gewisse Rolle, bei der immer bewussten Entscheidung für den Kynismus. Ebenso durchschimmernd ist das, was Wilhelm Capelle als „Armeleutephilosophie“ bezeichnete, stammen doch die behandelten Philosophen aus dem Sklavenstand und taten sie dies nicht (wie z.B. Hipparchia), so war es eine grundlegende Prämisse, sich für die Armut zu entscheiden. Bei Epiktet kommt die göttliche Losung des Kynikers hinzu, eine Komponente, die sich bei Diogenes Laertius nirgendwo finden lässt. Ebenfalls unterscheiden diese sich in der Formulierung des Polytheismus (Laertius) und des Monotheismus (Epiktet). Die spezifische Weltfremdheit der Kyniker wird bei Epiktet geradezu ins Metaphysische gehoben, denn nach ihm, walten sie in einem ganz anderen Reich, einem viel herrlicheren, während sie auf der irdischen Welt nur als Apostel einer höheren Wahrheit zu fungieren scheinen.
Was im Umgang mit den Mitmenschen bei Diogenes Laertius noch als misanthropisches und zynisches Verhalten bei den beschriebenen Kynikern hervortritt, wird bei Epiktet völlig ins Gegenteil, zu einem Prinzip der Philanthropie gekehrt, denn der Kyniker darf nach seiner Konzeption, keinem anderen Menschen oder gar Gott irgendeinen Schaden zufügen. Während Diogenes von Sinope sich nicht davon abhalten lässt, körperlich wie verbal auf seine Mitmenschen loszugehen, steht bei Epiktet das Moment des passiven Ertragens von eventuellem Elend im Vordergrund. Deutlich tritt hier das stoische Bild des Unerschütterlichen hervor. In beiden Konzepten lassen sich das Prinzip der Apathie und der Autarkie erkennen, allerdings tritt erst bei Epiktet die Konsequenz der beiden, die Ataraxie deutlich hervor.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung der Kyniker bei Diogenes Laertius
- Darstellung des Kynismus bei Epiktet
- Gemeinsamkeit und Unterschiede der Konzeptionen
- Persönliche Bewertung der Konzepte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz vergleicht die Kynismuskonzeptionen von Epiktet und Diogenes Laertius, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Die Arbeit analysiert die dargestellten Überlieferungen und bewertet die jeweiligen Konzepte kritisch.
- Die Darstellung des Kynismus bei Diogenes Laertius
- Die Darstellung des Kynismus bei Epiktet
- Vergleich der Konzeptionen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Kritische Bewertung der kynischen Konzepte
- Die Rolle der Askese und der Eudämonie im Kynismus
Zusammenfassung der Kapitel
Darstellung der Kyniker bei Diogenes Laertius: Die Darstellung konzentriert sich auf Antisthenes, Diogenes von Sinope und Krates. Diogenes Laertius beschreibt die Kyniker als misanthropisch, exklusiv, asketisch und redegewandt. Ihre Abgrenzung zur Gesellschaft wird durch den Vergleich Diogenes' mit einem Hund verdeutlicht. Die Anekdote vom „Menschen“ und „Unflat“ illustriert ihre Verachtung für den Pöbel. Ihre materielle Askese, exemplifiziert an Antisthenes' Stock und Quersack und Diogenes' Verzicht auf Becher und Schüssel, wird als Weg zur Autarkie interpretiert. Die Frage der Eudämonie wird behandelt, jedoch nicht als zentrales Thema. Die Redegewandtheit der Kyniker wird anhand von Anekdoten über Diogenes' Verkauf als Sklave veranschaulicht. Ihr Frauenbild wird als eigenartig und anti-emotional beschrieben. Der Kosmopolitismus wird als weiterer wichtiger Aspekt des Kynismus hervorgehoben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Aufsatz: Vergleich der Kynismuskonzeptionen von Epiktet und Diogenes Laertius
Was ist der Gegenstand des Aufsatzes?
Der Aufsatz vergleicht die Konzeptionen des Kynismus bei Epiktet und Diogenes Laertius. Das Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Darstellungen des Kynismus herauszuarbeiten und die jeweiligen Konzepte kritisch zu bewerten.
Welche Themen werden im Aufsatz behandelt?
Der Aufsatz behandelt die Darstellung des Kynismus bei Diogenes Laertius, die Darstellung des Kynismus bei Epiktet, einen Vergleich beider Konzeptionen (Gemeinsamkeiten und Unterschiede), eine kritische Bewertung der kynischen Konzepte und die Rolle von Askese und Eudämonie im Kynismus.
Wer sind die zentralen Figuren im Aufsatz?
Die zentralen Figuren sind Epiktet und Diogenes Laertius, deren unterschiedliche Darstellungen des Kynismus verglichen werden. Im Kontext von Diogenes Laertius werden außerdem Antisthenes, Diogenes von Sinope und Krates als wichtige Kyniker vorgestellt.
Wie wird der Kynismus bei Diogenes Laertius dargestellt?
Diogenes Laertius beschreibt die Kyniker als misanthropisch, exklusiv, asketisch und redegewandt. Seine Darstellung betont ihre Abgrenzung von der Gesellschaft, ihre materielle Askese (z.B. Antisthenes' Stock und Quersack, Diogenes' Verzicht auf Gebrauchsgegenstände), ihre Verachtung für den Pöbel und ihren Kosmopolitismus. Die Frage der Eudämonie wird angesprochen, jedoch nicht als zentrales Thema behandelt. Das Frauenbild wird als eigenartig und anti-emotional beschrieben.
Welche Aspekte des Kynismus werden im Vergleich hervorgehoben?
Der Vergleich der Konzeptionen von Epiktet und Diogenes Laertius konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Darstellungen der kynischen Philosophie, insbesondere bezüglich Askese, Eudämonie, Verhältnis zur Gesellschaft und dem Charakter der Kyniker.
Wie ist der Aufsatz strukturiert?
Der Aufsatz beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Darstellung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und ein Glossar der Schlüsselbegriffe. Die einzelnen Kapitel behandeln die jeweiligen Darstellungen des Kynismus bei Diogenes Laertius und Epiktet und vergleichen diese kritisch.
Welche Rolle spielen Askese und Eudämonie im Aufsatz?
Askese und Eudämonie sind zentrale Konzepte im Kynismus und werden im Aufsatz im Kontext der Darstellung bei Diogenes Laertius und Epiktet analysiert und verglichen. Die materielle Askese wird als Weg zur Autarkie interpretiert, während die Bedeutung der Eudämonie (Glückseligkeit) im Rahmen der kynischen Philosophie untersucht wird.
- Citar trabajo
- Markus Uehleke (Autor), 2009, Kynismus bei Epiktet und Diogenes Laertius. Ein Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281998