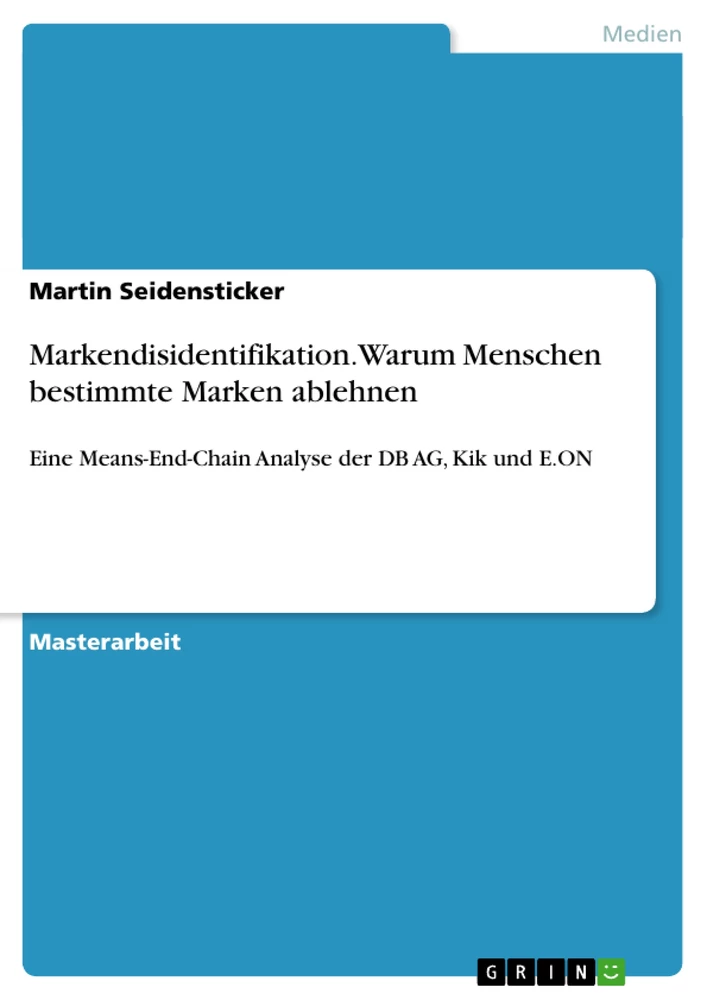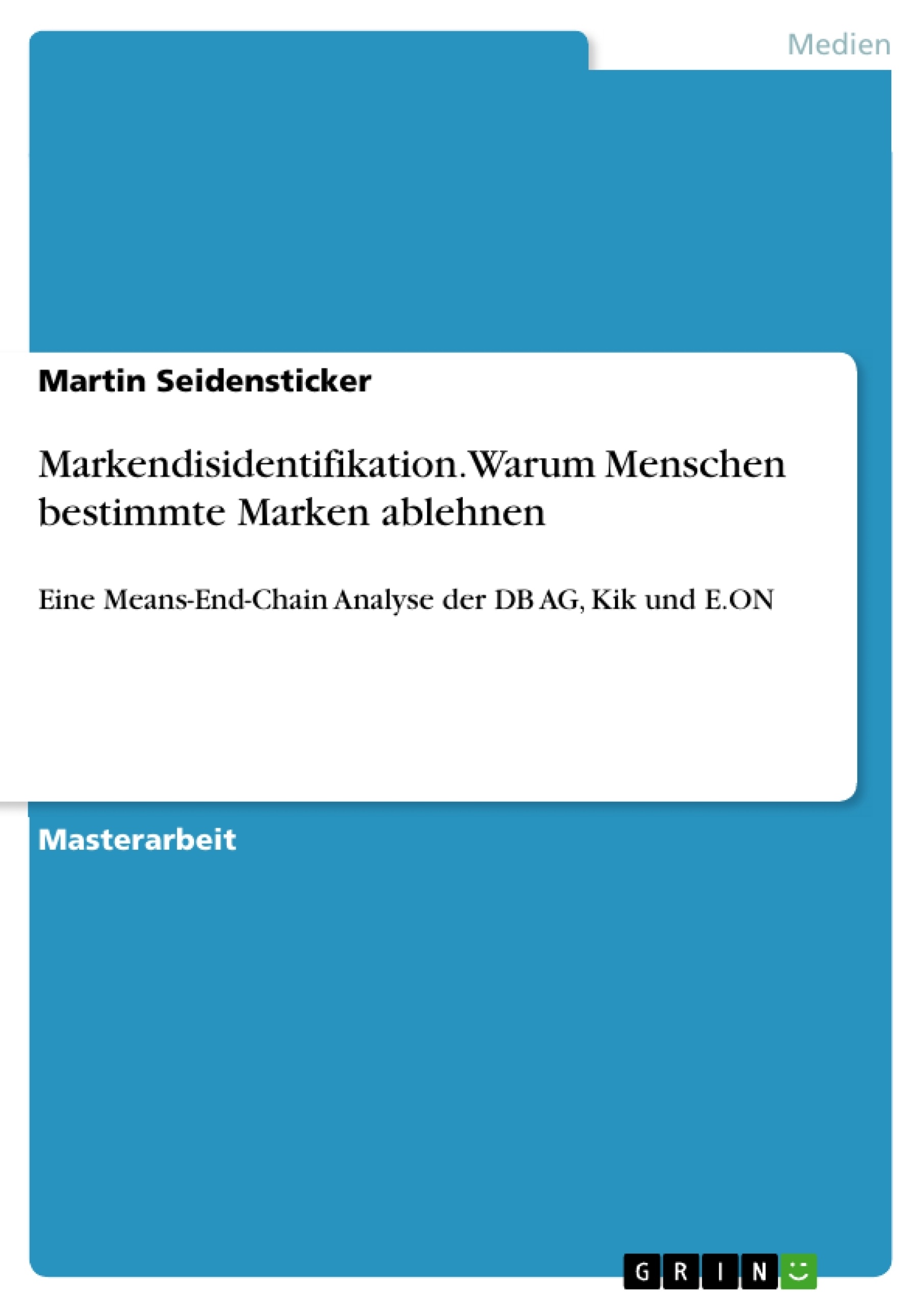Menschen benötigen die Identifikation, um zu klären, wer sie sind. Aufbauend auf dem Social Identity Approach will ein Mensch seine soziale Identität erhalten oder verbessern (Tajfel & Turner, 1986). Die persönliche Identität ist das „einheitliche und kontinuierliche Bewusstsein, wer man ist“ (Burmeister, 1998, S. 681). Die persönliche und die soziale Identität eines Individuums ergeben zusammengenommen das Selbstkonzept (vgl. z.B. Turner, 1984, S. 527). Das Selbstkonzept ist die „organisierte Gesamtheit der Wahrnehmungen und Gefühle eines Individuums gegenüber sich selbst“ (Übersetzt und angepasst von Conrady, 1990, S. 62 nach Rogers, 1965, S. 136). Die Disidentifikation benötigt der Mensch, um zu klären, wer er nicht ist. Durch die soziale Kategorisierung organisiert der Mensch seine soziale Umgebung, indem er sich und andere in Gruppen unterteilt. Auf drei Ebenen kategorisiert man das soziale Selbst gegenüber anderen: die persönliche, die relationale und die kollektive Ebene. Die negative Kategorisierung ist der Prozess, bei dem ein Mensch seine Identität durch das definiert, was er nicht ist (Zhong et al., 2008, S. 793f.). Das aktuelle Markenverständnis umfasst alles, was an einem Markt zu Kauf und Konsum angeboten wird, um ein Bedürfnis oder Wunsch zu befriedigen (Einwiller, 2003, S. 99). Markendisidentifikation wird definiert als ein Selbstkonzept, das auf (1) Trennung zwischen eigener Identität und wahrgenommener Identität der Marke (Markenimage), und (2) auf einer negativen persönlichen, relationalen oder kollektiven Kategorisierung von sich selbst und der Marke basiert. Die Vorstudie (N=147) ergab, dass KiK Textilien und Non-Food GmbH, Wiesenhof Geflügelkontor GmbH, E.ON SE, Deutsche Bahn AG und Apple Inc. (nachfolgend als Kik, Wiesenhof, E.ON, Deutsche Bahn und Apple bezeichnet) besonders relevant für die Markendisidentifikation sind, wovon die Deutsche Bahn, Kik und E.ON in der Hauptstudie untersucht wurden. Mittels einer Means-End-Chain Analyse (N=15) wurde untersucht, ob und welche generalisierbaren Markenwerte einer Markendisidentifikation zu Grunde liegen. Das Ergebnis war, dass die Markenwerte „Verletzung der ökonomischen-, sozialen- und ökologischen Verantwortung“ den instrumentellen Wert „Verantwortungsbewusstsein“ verletzten, was dem Konstrukt der Nachhaltigkeit entspricht. Zusätzlich verletzen die Markenwerte „Ärger“, „Einschränkung“ und „Verletzung des Selbstwertes“ die terminalen Werte „Innere Harmonie“, „Freiheit“ und „Sicherheit“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsinteresse
- Der Gang der Arbeit
- Defining Who You Are by What You're Not…
- Identifikation
- Social Identity Approach
- Das Selbstkonzept
- Definition
- Abgrenzung zu Commitment
- Disidentifikation
- Selbstkonzept oder Selbstwahrnehmung?
- Die negative,,relationale" Kategorisierung
- Definition
- Abgrenzung zu Identifikation, Dissonanz und Reaktanz
- Die Marke und ihre Wirkung auf den Menschen
- Funktionen der Marke
- Markenidentifikation
- Markenwerte
- Die Marke als Symbol
- Beziehungen mit Marken
- Markenimage
- Die Marke als Mittel zum Zweck
- Markendisidentifikation
- Definition
- Zustände und Extreme der Marken (dis)identifikation
- Empirische Untersuchung
- Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage
- Methodisches Vorgehen
- Der Means-End-Ansatz
- Das Laddering
- Die Inhaltsanalyse
- Die Hierarchical Value Map
- Probleme der Means-End-Chain Analyse
- Ergebnisse
- Vorstudie
- Stichprobe
- Die Laddering-Interviews
- Demografie
- Kategorien
- Hierarchical Value Map
- Diskussion
- Nutzung
- Krise
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Markendisidentifikation. Ziel ist es, die Entstehung und die Auswirkungen von negativer Markenwahrnehmung zu untersuchen, indem die Means-End-Chain Analyse als methodisches Werkzeug eingesetzt wird. Die Arbeit analysiert, wie negative Markenwerte auf die instrumentellen und terminalen Werte von Konsumenten wirken und welche Auswirkungen dies auf die Beziehung zwischen Konsument und Marke hat.
- Identifikation und Disidentifikation als zentrale Konzepte
- Die Rolle des Selbstkonzepts und der sozialen Kategorisierung
- Die Bedeutung von Markenwerten und Markenimage
- Die Anwendung der Means-End-Chain Analyse zur Untersuchung von Markendisidentifikation
- Die Auswirkungen von negativer Markenwahrnehmung auf Konsumentenverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Markendisidentifikation ein und erläutert die Relevanz des Forschungsgegenstands. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte um Marken und deren Image sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Kontext von Markenwahrnehmung. Die Einleitung stellt das Forschungsinteresse und den Gang der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Identifikation und Disidentifikation. Es werden die Konzepte des Social Identity Approach, des Selbstkonzepts und der negativen Kategorisierung erläutert. Das Kapitel definiert die Begriffe Identifikation und Disidentifikation und grenzt sie von verwandten Konzepten ab. Darüber hinaus werden die Funktionen der Marke, die Markenidentifikation, Markenwerte, das Markenimage und die Beziehung zwischen Konsument und Marke beleuchtet.
Das dritte Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der Markendisidentifikation. Es werden das Erkenntnisinteresse und die Forschungsfrage vorgestellt. Das Kapitel erläutert das methodische Vorgehen, das auf der Means-End-Chain Analyse basiert. Es werden die einzelnen Methoden, wie das Laddering, die Inhaltsanalyse und die Hierarchical Value Map, detailliert beschrieben. Abschließend werden die Probleme der Means-End-Chain Analyse diskutiert.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Vorstudie, die Stichprobe, die Laddering-Interviews, die Demografie, die Kategorien und die Hierarchical Value Map vorgestellt. Die Ergebnisse werden diskutiert und in Bezug auf die Nutzung und die Krise von Marken interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Markendisidentifikation, Means-End-Chain Analyse, Markenwerte, Markenimage, Selbstkonzept, soziale Kategorisierung, Nachhaltigkeit, Konsumentenverhalten, negative Markenwahrnehmung, Markenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Markendisidentifikation?
Markendisidentifikation beschreibt den Prozess, bei dem ein Mensch seine Identität dadurch definiert, dass er sich bewusst von einer Marke distanziert und sie ablehnt.
Warum lehnen Menschen bestimmte Marken ab?
Häufige Gründe sind die Verletzung ökonomischer, sozialer oder ökologischer Verantwortung sowie negative Emotionen wie Ärger oder eine Verletzung des Selbstwerts.
Welche Marken wurden in der Studie untersucht?
Besonders relevant für Disidentifikation erwiesen sich Marken wie Kik, Wiesenhof, E.ON, die Deutsche Bahn und Apple.
Was ist eine Means-End-Chain Analyse?
Es ist eine Methode, um Zusammenhänge zwischen Produktmerkmalen (Markenwerten), funktionalen Nutzen und den persönlichen Werten des Konsumenten aufzudecken.
Wie hängen Nachhaltigkeit und Markenablehnung zusammen?
Die Studie zeigt, dass mangelndes Verantwortungsbewusstsein einer Marke in Bezug auf Nachhaltigkeit ein zentraler Grund für Markendisidentifikation ist.
- Arbeit zitieren
- Martin Seidensticker (Autor:in), 2013, Markendisidentifikation. Warum Menschen bestimmte Marken ablehnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282032