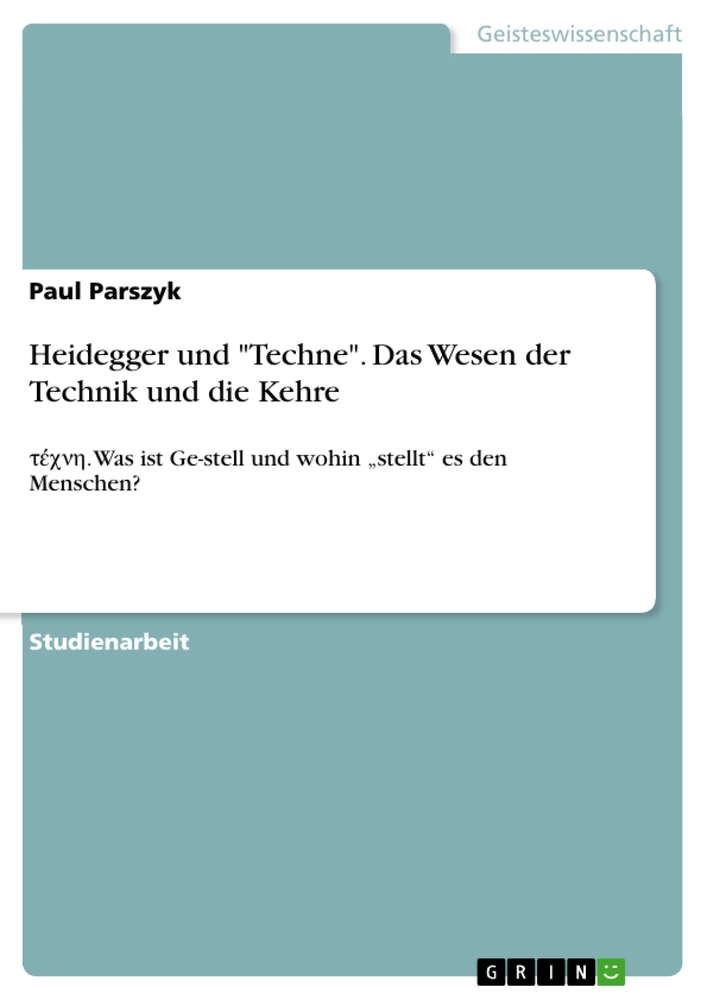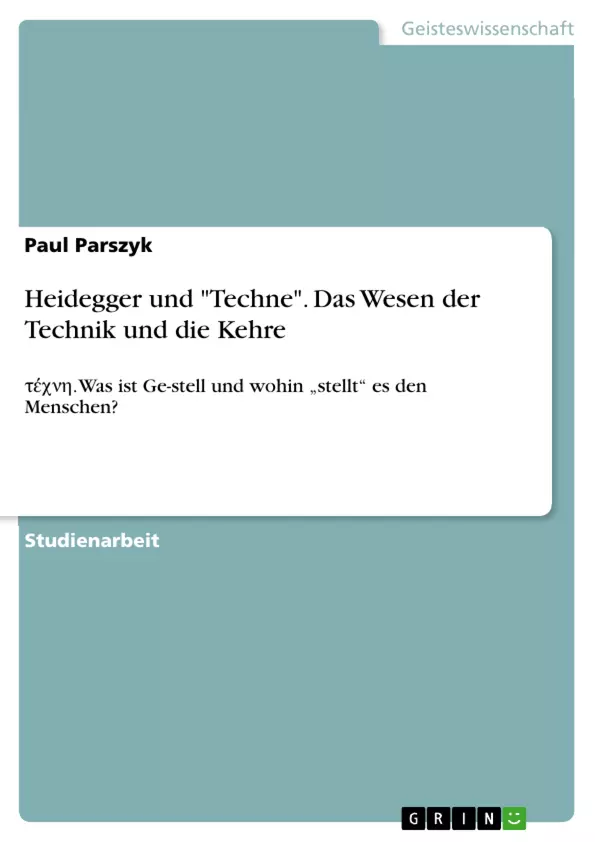In der Frage nach der Technik, wendet Heidegger seine dekonstruktivistische Methode der ἀλήθεια (alētheia) an, um zu „be-stimmen“, was τέχνη (technē) eigentlich ist: Technik sei im Wesentlichen nichts Technisches, sondern „Ge-stell“, heißt es in einer der Thesen Heideggers.
Was genau Heidegger damit meint und wie oder ob sich dies auf (moderne) Technik anwenden lässt, wird von mir in dieser Selbststudienarbeit untersucht und diskutiert werden. Was genau ist also „Gestell“ und wohin „stellt“ es die Technikverwendenden? Wird das Wesen des Menschen und unsere Auffassung von Realität hierbei „ent-borgen“ oder auch „ver-borgen“ bzw. „ver-stellt“? Welche Rolle spielt hierbei die Ambivalenz der Technik für Heidegger?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heidegger und τέχνη
- Heideggers Kulturkritik
- Heideggers Frage nach der Technik (Das „Was“ und έλoç)
- Heideggers Unterscheidung: Vorhandenheit und Zuhandenheit (Sein und Zeit)
- Heideggers Unterscheidung: Technik („alt“ und modern)
- Was ist Ge-stell? - Ressource und Referenz
- Die Kehr(e)(-seite) und Seinsmodi der Technik
- Zusammenfassungen
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Martin Heideggers Philosophie der Technik und analysiert seine Kritik an der modernen Technisierung. Ziel ist es, Heideggers Konzept des „Ge-stell“ zu verstehen und dessen Auswirkungen auf das menschliche Dasein zu untersuchen.
- Heideggers Kulturkritik und seine Kritik an der Metaphysik
- Das Wesen der Technik und die Frage nach dem „Was“
- Die Unterscheidung zwischen „alt“ und moderner Technik
- Das „Ge-stell“ als Ausdruck der modernen Technisierung
- Die Ambivalenz der Technik und ihre Auswirkungen auf das menschliche Dasein
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach dem Wesen der Technik im Kontext von Heideggers Philosophie. Sie beleuchtet die anthropologische Perspektive auf Technik und die Rolle der „Verlängerung des Körpers“.
Das Kapitel „Heidegger und τέχνη“ analysiert Heideggers Kulturkritik und seine Kritik an der Metaphysik. Es untersucht die Frage nach dem Wesen der Technik und die Rolle des „Was“ in Heideggers Philosophie. Weiterhin werden die Unterscheidung zwischen Vorhandenheit und Zuhandenheit sowie die Unterscheidung zwischen „alt“ und moderner Technik beleuchtet.
Das Kapitel „Was ist Ge-stell? - Ressource und Referenz“ befasst sich mit Heideggers Konzept des „Ge-stell“ als Ausdruck der modernen Technisierung. Es analysiert die Rolle des „Ge-stell“ in der Beziehung zwischen Mensch und Technik und untersucht die Auswirkungen der Technisierung auf das menschliche Dasein.
Das Kapitel „Die Kehr(e)(-seite) und Seinsmodi der Technik“ untersucht die Ambivalenz der Technik und ihre Auswirkungen auf das menschliche Dasein. Es analysiert die Rolle der Technik in der modernen Welt und die Frage, ob die Technik das menschliche Dasein „ent-borgen“ oder „ver-borgen“ bzw. „ver-stellt“.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Technikphilosophie, Martin Heidegger, das „Ge-stell“, Kulturkritik, Metaphysik, das Wesen der Technik, die Ambivalenz der Technik, die moderne Technisierung und die Auswirkungen der Technik auf das menschliche Dasein.
- Quote paper
- Paul Parszyk (Author), 2013, Heidegger und "Techne". Das Wesen der Technik und die Kehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282044