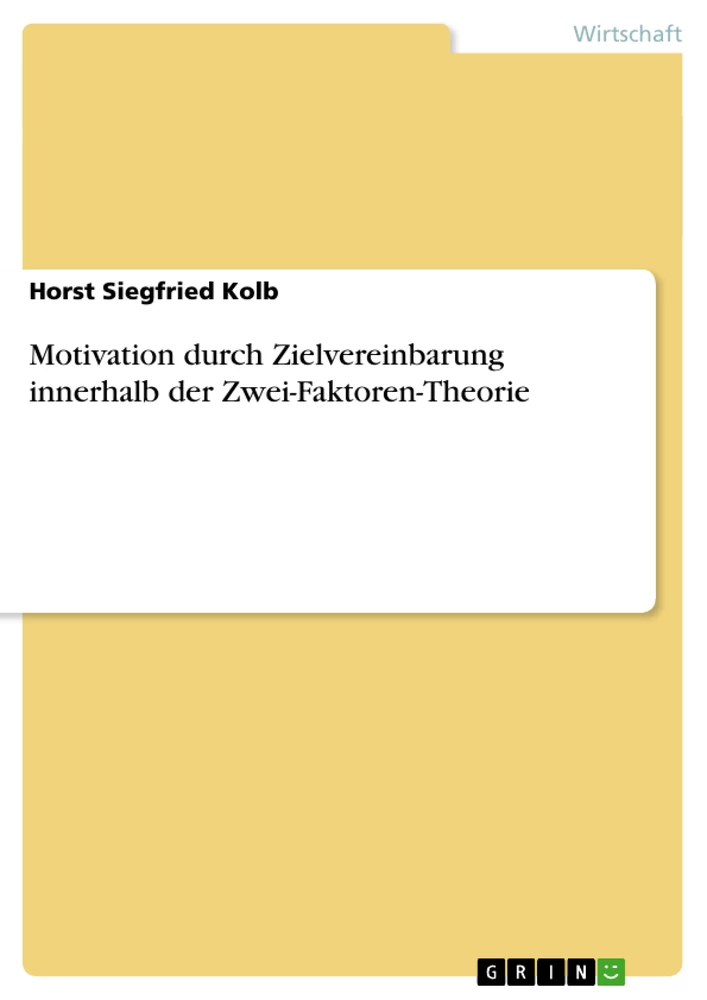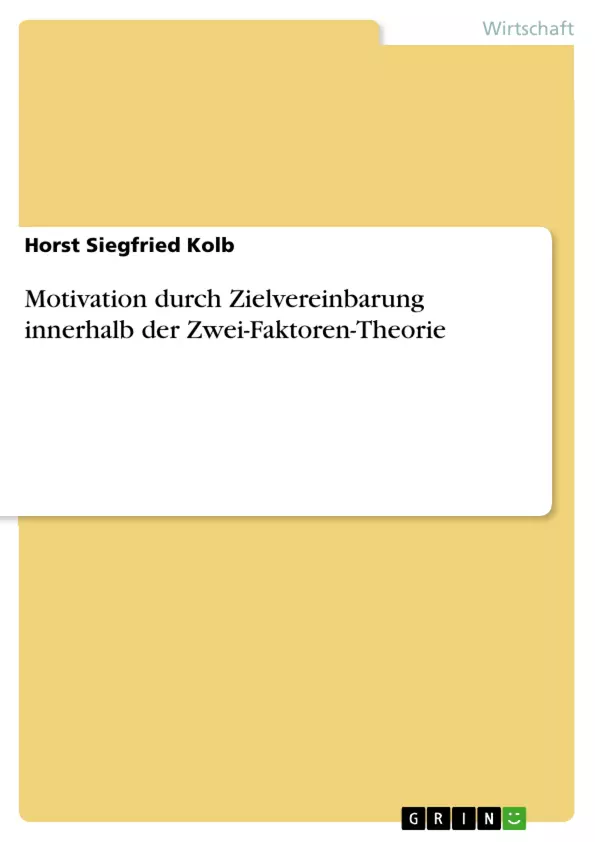Manchmal erscheint es schon als aktueller Trend: Das Management by Objectives (MbO), also Führen durch Zielvereinbarung. Dabei werden in der Literatur zahlreiche Vorteile genannt. Obwohl das Planen von Zielen zunächst Kosten und vor allem Zeit benötigt, stünden Vorteile wie Gestaltungsspielräume als Bedürfnisse moderner Belegschaft, Förderung des Teamgeistes und der Leistungsbereitschaft im Vordergrund. Dabei soll sich der Mitarbeiter durch das „Vereinbaren“ – entgegen dem „Setzen“ – von Zielen mit diesen identifizieren und darüber hinaus ein stärkeres Commitment (Bindung) an das Unternehmen generiert werden. Es bleibt aber bisher eine große Frage offen: Wie steht es mit der Motivation?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einführung
- Zielvereinbarungen
- Vorteil der Zielvereinbarung versus einer Zielvorgabe
- Begriffsdefinition Ziel
- Akzeptanz im Zielvereinbarungsprozess
- Zielbeziehungen
- Positive Auswirkungen einer Zielvereinbarung
- Positive Auswirkungen auf die Motivation
- Positive Auswirkungen auf die Sicherheit
- Positive Auswirkungen auf allgemeine Aspekte
- Chancen für Vorgesetzte und Unternehmen
- Zielarten
- Quantitative versus qualitative Ziele
- Ziele in Abhängigkeit von Freiheitsgraden und Anforderungskomplexität
- Ziele in Abhängigkeit vom Planungshorizont
- Ziele in Abhängigkeit vom Abstraktionsniveau
- Ziele in Abhängigkeit von der Verhaltensdimension
- Ziele in Abhängigkeit von Kompetenz
- Ziele in Abhängigkeit von der Nähe der Erreichbarkeit
- Ziele in Abhängigkeit vom Zielbereich
- Ziele in Abhängigkeit von der Personenanzahl
- Ziele in Abhängigkeit von festgestelltem Mangel
- Ziele in Abhängigkeit vom Status quo
- Ziele in Abhängigkeit vom Integration versus Autonomie
- Wirkung der Ziele
- Gütekriterien und Anforderungen
- Zielformulierung SMART
- Zielkriterien im 3-V-Modell
- Messung des Zielerreichungsgrades
- Prozentuale Messung
- Skalierte Messung
- Goal Attainment Scailing (GAS)
- Fehler bei Zielvereinbarungen
- Zielsetzung statt Zielvereinbarung
- Verwechslung von Ziel und Indikatoren
- Ziele ohne Zukunftsentwurf
- Ziele ohne sinnvolle Begründung
- Opferung sinnvoller Ziele für Messbarkeit
- Fehlende Anknüpfung
- Fehlende strategische Verankerung
- Kumulierte Sicherheitspuffer
- Bestehende Zielkonflikte
- Intransparentes Verteilungssystem
- Mehrfache Verteilung bei unterschiedlicher Zielhöhe
- Zu lange Zielzeiträume
- Geringschätzung konstruktiver Atmosphäre
- Arbeitsrechtliche Konsequenzen
- Individualrechtliche Aspekte beim Ausbleiben einer Zielvereinbarung
- Arbeitsrechtliche Sanktionen bei Zielverfehlung
- Krankheit und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- Motivatorische Konsequenzen
- Begriffsbestimmung Motivation
- Motivationsarten
- Intrinsische Motivation
- Extrinsische Motivation
- Motivationstheorien
- Inhaltstheorien
- Prozesstheorien
- Zwei-Faktoren-Theorie nach Frederick Herzberg
- Defizitmotivation und Expansionsmotivation
- Ereignisgruppen
- Motivatoren
- Hygienefaktoren
- Gegenüberstellung der Motivatoren und Hygienefaktoren
- Kritik an der Zwei-Faktoren-Theorie
- Faktorenverteilung der Zwei-Faktoren-Theorie
- Zusammenhang zwischen Motivation und Vergütung
- Negativer Zusammenhang zwischen Motivation und Vergütung
- Positiver Zusammenhang zwischen Motivation und Vergütung
- Fazit dieses Zusammenhangs
- Motivation durch Zielvereinbarung
- Motivator Leistung
- Motivator Anerkennung
- Motivator Arbeitsinhalt
- Motivator Verantwortung
- Motivator Aufstieg und Beförderung
- Motivator Wachstum
- Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
- S-E-Erwartung
- S-H-Erwartung
- H-E-Erwartung
- E-F-Erwartung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Motivation durch Zielvereinbarungen im Kontext der Zwei-Faktoren-Theorie. Sie analysiert die Funktionsweise von Zielvereinbarungen, ihre Auswirkungen auf die Motivation von Mitarbeitern und die Rolle der Zwei-Faktoren-Theorie in diesem Zusammenhang.
- Die Bedeutung von Zielvereinbarungen für die Motivation von Mitarbeitern
- Die Anwendung der Zwei-Faktoren-Theorie auf Zielvereinbarungen
- Die verschiedenen Arten von Zielen und ihre Auswirkungen auf die Motivation
- Die Rolle von Motivatoren und Hygienefaktoren in der Zwei-Faktoren-Theorie
- Die Bedeutung von Zielformulierung und Zielerreichungsgrad für die Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Zielvereinbarungen ein und erläutert die Relevanz des Themas für die Praxis. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Zielvereinbarungen. Es werden die verschiedenen Arten von Zielvereinbarungen vorgestellt und die Vorteile gegenüber einer Zielvorgabe erläutert.
Das dritte Kapitel definiert den Begriff "Ziel" und beleuchtet die Bedeutung der Akzeptanz im Zielvereinbarungsprozess. Es werden verschiedene Aspekte der Zielbeziehungen und die positiven Auswirkungen einer Zielvereinbarung auf die Motivation, die Sicherheit und allgemeine Aspekte des Arbeitslebens diskutiert.
Das vierte Kapitel widmet sich den verschiedenen Zielarten. Es werden quantitative und qualitative Ziele, Ziele in Abhängigkeit von Freiheitsgraden und Anforderungskomplexität, Ziele in Abhängigkeit vom Planungshorizont, Ziele in Abhängigkeit vom Abstraktionsniveau, Ziele in Abhängigkeit von der Verhaltensdimension, Ziele in Abhängigkeit von Kompetenz, Ziele in Abhängigkeit von der Nähe der Erreichbarkeit, Ziele in Abhängigkeit vom Zielbereich, Ziele in Abhängigkeit von der Personenanzahl, Ziele in Abhängigkeit von festgestelltem Mangel, Ziele in Abhängigkeit vom Status quo und Ziele in Abhängigkeit vom Integration versus Autonomie vorgestellt und analysiert.
Das fünfte Kapitel untersucht die Wirkung von Zielen auf die Motivation von Mitarbeitern. Es werden die Gütekriterien und Anforderungen an eine effektive Zielformulierung, wie z. B. die SMART-Methode, sowie die Messung des Zielerreichungsgrades anhand verschiedener Methoden, wie z. B. der prozentualen Messung, der skalierten Messung und des Goal Attainment Scailing (GAS), erläutert.
Das sechste Kapitel befasst sich mit möglichen Fehlern bei Zielvereinbarungen. Es werden verschiedene Fehlerquellen, wie z. B. Zielsetzung statt Zielvereinbarung, Verwechslung von Ziel und Indikatoren, Ziele ohne Zukunftsentwurf, Ziele ohne sinnvolle Begründung, Opferung sinnvoller Ziele für Messbarkeit, fehlende Anknüpfung, fehlende strategische Verankerung, kumulierte Sicherheitspuffer, bestehende Zielkonflikte, ein intransparentes Verteilungssystem, mehrfache Verteilung bei unterschiedlicher Zielhöhe, zu lange Zielzeiträume und die Geringschätzung konstruktiver Atmosphäre, analysiert.
Das siebte Kapitel beleuchtet die arbeitsrechtlichen Konsequenzen von Zielvereinbarungen. Es werden die individualrechtlichen Aspekte beim Ausbleiben einer Zielvereinbarung, die arbeitsrechtlichen Sanktionen bei Zielverfehlung und die Auswirkungen von Krankheit und Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die Zielvereinbarung diskutiert.
Das achte Kapitel befasst sich mit den motivatorischen Konsequenzen von Zielvereinbarungen. Es werden die verschiedenen Arten von Motivation, wie z. B. intrinsische und extrinsische Motivation, sowie verschiedene Motivationstheorien, wie z. B. die Zwei-Faktoren-Theorie nach Frederick Herzberg, vorgestellt und analysiert.
Das neunte Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Motivation und Vergütung. Es werden die verschiedenen Aspekte des Zusammenhangs, wie z. B. der negative und der positive Zusammenhang, sowie die Auswirkungen auf die Motivation durch Zielvereinbarung, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Motivation, Zielvereinbarungen, die Zwei-Faktoren-Theorie, Motivatoren, Hygienefaktoren, Zielformulierung, Zielerreichungsgrad, Arbeitsrechtliche Konsequenzen, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation und den Zusammenhang zwischen Motivation und Vergütung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg?
Sie unterscheidet zwischen Motivatoren (die Zufriedenheit erzeugen, z.B. Leistung, Anerkennung) und Hygienefaktoren (die Unzufriedenheit verhindern, z.B. Gehalt, Arbeitsbedingungen).
Wie motivieren Zielvereinbarungen (MbO) Mitarbeiter?
Durch das gemeinsame Aushandeln von Zielen identifizieren sich Mitarbeiter stärker mit den Aufgaben, erhalten Gestaltungsspielräume und empfinden eine höhere Bindung (Commitment) zum Unternehmen.
Was bedeutet die SMART-Formel bei Zielen?
Ziele sollten Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert sein, um effektiv zu wirken.
Kann Gehalt die Motivation langfristig steigern?
Nach Herzberg gehört Gehalt zu den Hygienefaktoren. Eine Erhöhung verhindert zwar Unzufriedenheit, führt aber allein nicht zu dauerhafter Motivation oder Leistungssteigerung.
Welche Fehler sollten bei Zielvereinbarungen vermieden werden?
Häufige Fehler sind einseitige Zielvorgaben statt echter Vereinbarungen, mangelnde strategische Verankerung oder zu lange Zeiträume für die Zielerreichung.
- Citation du texte
- Horst Siegfried Kolb (Auteur), 2014, Motivation durch Zielvereinbarung innerhalb der Zwei-Faktoren-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282115