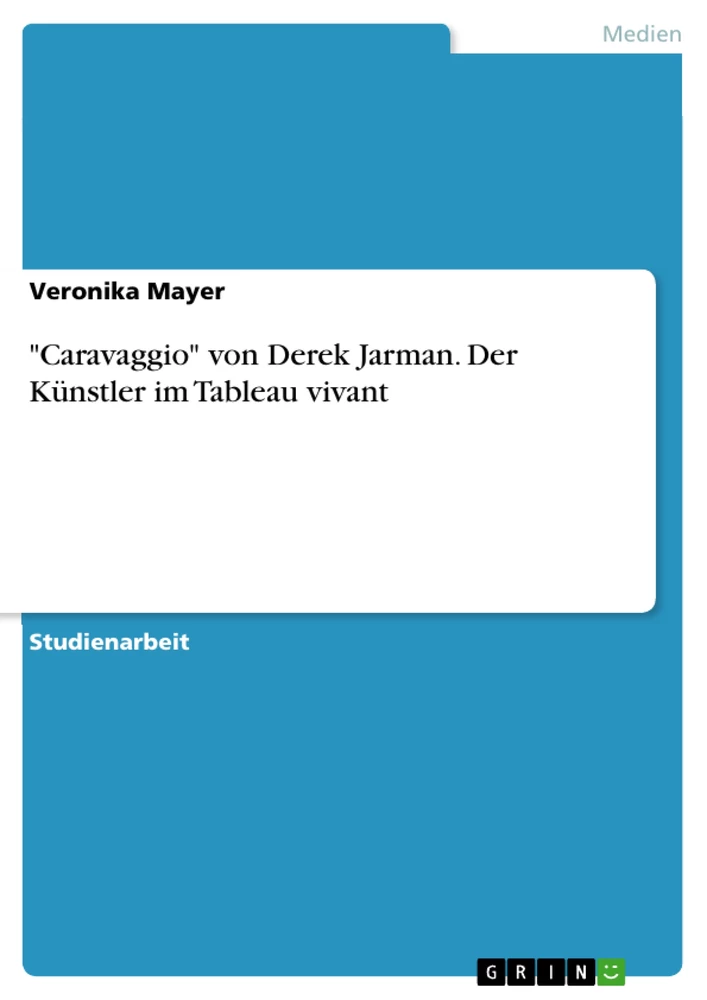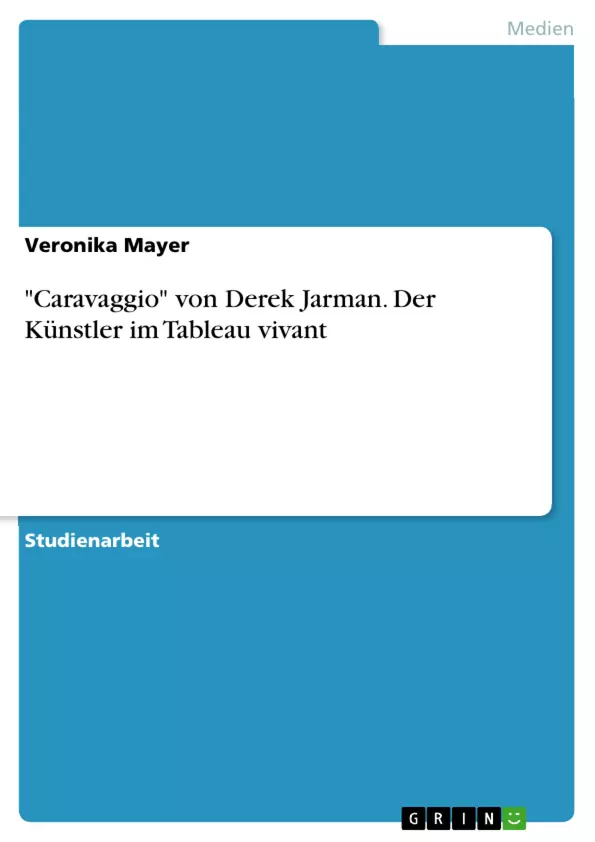Derek Jarman lieferte mit seiner Biographie über den italienischen Maler Michelangelo Merisi da Caravaggio 1986 einen Spielfilm, der heute einerseits als Klassiker über Homosexualität und künstlerisches Vorzeigemodell der britischen Filmgeschichte gilt, aber andererseits wegen seiner Tendenz zur Selbstinszenierung gerügt wird.
Derek Jarman (1942-1994) studierte von 1960 bis 1963 am King's College in London Geschichte, Englisch und Kunstgeschichte. Von 1963 bis 1967 war er an der Slade School of Art, wo er sich mit Malerei, Bühnenbild und auch Film-Design beschäftigte. Mit Ende der 70er Jahre fing er an, auch eigene Filme zu drehen. Jarman war offen homosexuell und beklagte oft, wegen seiner Sexualität und später auch seiner HIV-Infektion als Künstler nicht beachtet und diskriminiert zu werden. 1994 starb er an den Folgen von Aids. In den mehr als 20 Jahren seiner künstlerischen Arbeit entstanden laut Scherer und Vogt mehr als ein Dutzend Langfilme, rund 50 Kurz- und Experimentalfilme, mehrere Bücher und zum Großteil unbekannte Bilder. Themen seiner künstlerischen Arbeit sind die Verbindung von Homosexualität und Kunst, der Film als Prozess statt als Produkt, Improvisation und die Verwendung einer filmischen Traumsprache. Besonders in seinen Filmen spiegelt sich Jarmans Grundsatz, Kunst sei ein untrennbarer Teil des Lebens, wieder (Jarman 1996; Scherer/ Vogt 1996).
Dieser Grundsatz lässt sich auch in seinem Film Caravaggio (1986) finden und eröffnet eine spannende Auseinandersetzung mit Biographik, Film und Kunst. So stellen sich Fragen wie: Wie setzt sich der Spielfilm mit Künstlerbiographie auseinander? Wie setzt der Spielfilm den Künstler und sein Werk ins Bild? Welches Künstlerbild vermittelt der Spielfilm und mit welchen Mitteln? Dabei ist Jarmans Einsatz von Tableaux vivants in Caravaggio besonders auffällig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegendes
- Künstlermythen
- Caravaggio: Entstehung einer schwarzen Legende
- Das Tableau vivant
- Derek Jarmans Caravaggio (1986)
- Jarmans Tableaux vivants
- Christliche Symbolik und kunsthistorische Referenzen
- Vor-Bild? Nach-Bild?
- Abbildungsverzeichnis
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Derek Jarmans Film „Caravaggio" (1986) und untersucht, wie der Spielfilm mit Künstlerbiographie und dem Werk des italienischen Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio umgeht. Der Fokus liegt dabei auf Jarmans Einsatz von Tableaux vivants und deren Bedeutung für die filmische Darstellung von Künstlermythen und kunsthistorischen Referenzen.
- Die Rolle von Künstlermythen in der Biographik
- Die Entstehung der „schwarzen Legende" um Caravaggio
- Die Funktion von Tableaux vivants in Jarmans Film
- Die Verbindung von christlicher Symbolik und kunsthistorischen Referenzen
- Die Frage nach dem Verhältnis von Vor-Bild und Nach-Bild
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Films „Caravaggio" ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Im Kapitel „Grundlegendes" werden zunächst Künstlermythen in der Biographik beleuchtet, bevor die Entstehung der „schwarzen Legende" um Caravaggio und die Definition des Begriffs „Tableau vivant" erläutert werden. Das Kapitel „Derek Jarmans Caravaggio (1986)" analysiert Jarmans Einsatz von Tableaux vivants und die Verbindung von christlicher Symbolik und kunsthistorischen Referenzen in seinem Film. Abschließend wird im Kapitel „Vor-Bild? Nach-Bild?" die Frage nach dem Verhältnis von Vor-Bild und Nach-Bild im Kontext von Jarmans Film diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Derek Jarmans Film „Caravaggio", Künstlerbiographie, Tableau vivant, Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Künstlermythen, christliche Symbolik, kunsthistorische Referenzen, Vor-Bild, Nach-Bild, Filmsprache, Filmgeschichte, Homosexualität, Kunst und Leben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Tableau vivant" im Film "Caravaggio"?
Ein Tableau vivant ist ein "lebendes Bild", bei dem Schauspieler die Gemälde Caravaggios exakt nachstellen. Derek Jarman nutzt dieses Mittel, um die Grenze zwischen Kunst und Leben zu verwischen.
Welches Bild vermittelt Derek Jarman von Caravaggio?
Jarman zeigt Caravaggio als einen Außenseiter, dessen Homosexualität und gewaltsames Leben untrennbar mit seiner künstlerischen Vision verbunden sind. Er thematisiert dabei auch die "schwarze Legende" um den Maler.
Inwiefern ist der Film autobiographisch für Derek Jarman?
Jarman, selbst offen homosexuell, projiziert eigene Erfahrungen von Diskriminierung und die Überzeugung, dass Kunst ein Teil des Lebens ist, auf die Figur des Caravaggio.
Welche Rolle spielt christliche Symbolik im Film?
Jarman verknüpft die religiösen Motive in Caravaggios Werk mit der profanen und oft gewalttätigen Realität der Modelle, was die Spannung zwischen sakraler Kunst und menschlicher Existenz verdeutlicht.
Warum gilt der Film als Klassiker der britischen Filmgeschichte?
Durch seine experimentelle Bildsprache, die Auseinandersetzung mit Homosexualität und die innovative Verbindung von Malerei und Film setzte "Caravaggio" neue Maßstäbe im Biopic-Genre.
- Citar trabajo
- Veronika Mayer (Autor), 2011, "Caravaggio" von Derek Jarman. Der Künstler im Tableau vivant, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282126