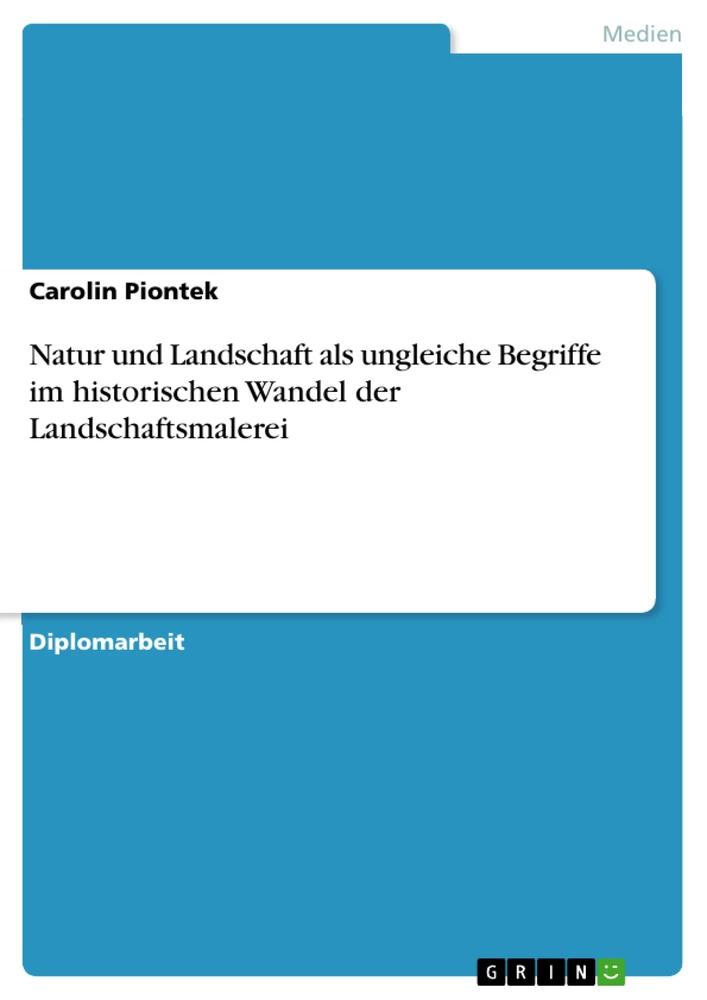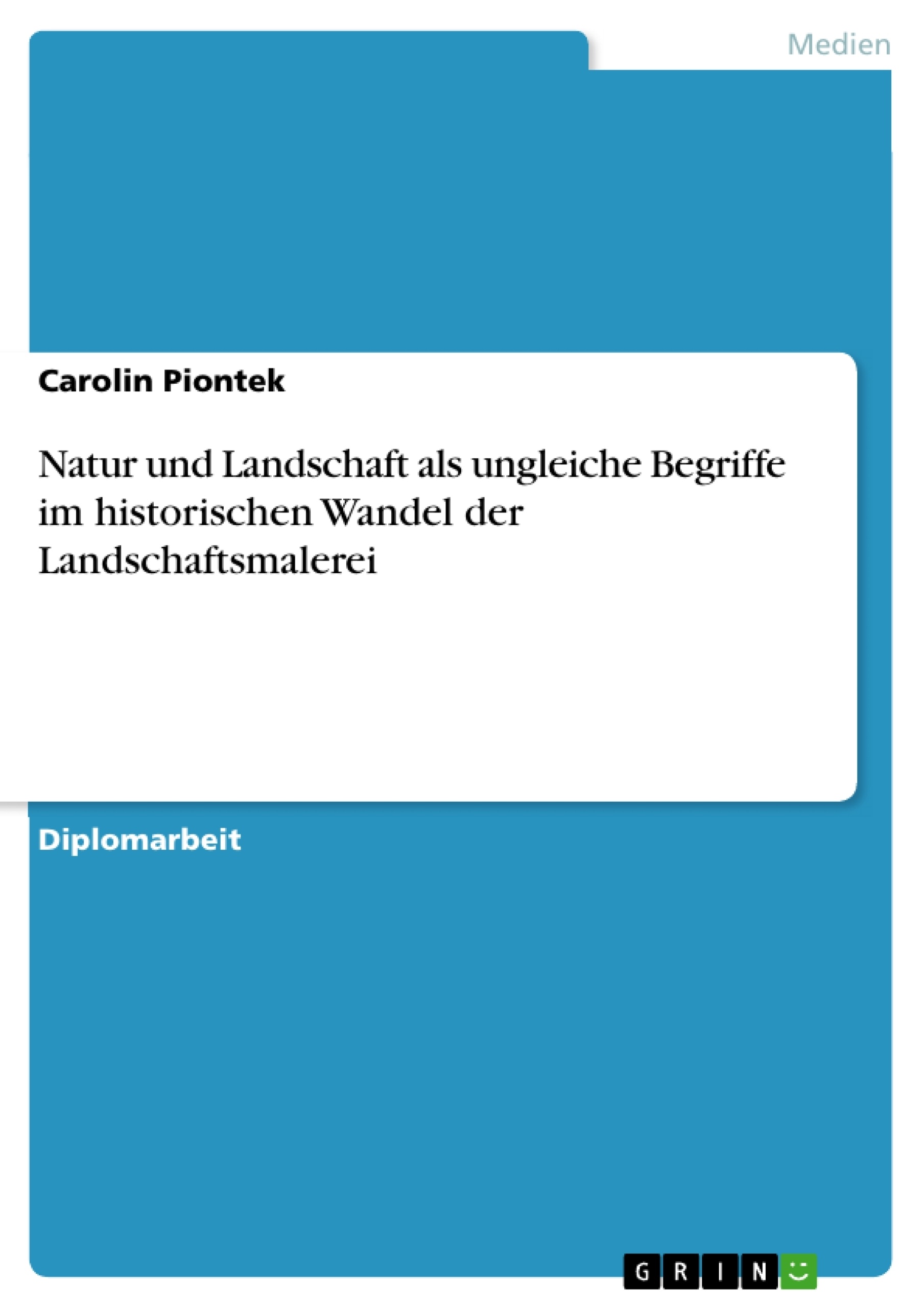Viele Jahrhunderte wurde die Landschaftsmalerei als kulturhistorisch immanente Malerei unterbewertet. Dabei ist sie die Äußerung einer Weltsicht der jeweiligen Epoche und offenbart die Gefühlswelt des in ihr lebenden Individuums so eindringlich wie ein Portrait. Aufgebrochen als eine Sehnsucht des Menschen nach der Ursprünglichkeit der Natur, die durch die Zivilisation und ihrer Kultivierung, der zunehmenden Verstädterung und dem Verlust seiner inneren Harmonie erwuchs, wird die Landschaftsmalerei zum Ausdruck seines Innenlebens und zu einer Möglichkeit der Selbstfindung, indem der Mensch versucht seine Stellung in der Welt zu definieren.
Die Landschaftsmalerei hat sich stets gewandelt und neue Sichtweisen aufgezeigt. Anfangs als Hintergrundkulisse hat sie nun den Platz als unabhängiges Bildthema neben der Portraitmalerei und dem Stillleben eingenommen. Immer geht die Landschaftsmalerei mit einem ästhetischen und kulturellen Bewusstsein und dem Aufbegehren der Wissenschaften nach Welterschließung einher. Sie bietet einen unaufdringlichen Einblick in politische, kulturelle, gesellschaftliche oder religiöse Ansichten des Künstlers und der Menschen seines Zeitalters. Wir leiten aus der Natur Gesetzmäßigkeiten her, die unsere Erfindungen vorantreiben, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen und sogar die Menschenrechte als naturgegeben zu untermauern, wie Rousseau dies tat. Wenn auch diese Theorie einige Lücken hatte, wie später Voltaire ironisch spöttelte, besaß sie auch einige Relationen zu unserem Dasein.
Die Landschaft wird zum Spiegelbild des Lebens wie der Frühromantiker Phillip Otto Runge bemerkt. Die Natur ist in ewigem Wandel begriffen zwischen Wachstum und Zerstörung, Leben und Tod. In der Natur finden wir Zuflucht, Trost, Gewissheit und Geborgenheit vor den Erschütterungen menschlicher Werte durch Krieg, Politik, gesellschaftliche Missstände und persönliche Schicksalsschläge. Der Mensch erfährt Selbstachtung, indem sie ihn Achtung seiner Umwelt lehrt, unabhängig von Nation, Hautfarbe, Ideologie, Religion, gesellschaftlicher Stellung oder Philosophie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff der Natur
- 3. Historische Begriffsbildung und Definition der Landschaft
- 4. Philosophische Betrachtungsweisen
- 5. Landschaftsmalerei vom Mittelalter bis zur klassischen Moderne
- 6. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Landschaftsmalerei und ihren Zusammenhang mit dem Verständnis von Natur und Landschaft. Sie beleuchtet die historische Begriffsbildung von "Natur", analysiert philosophische Perspektiven auf die Natur und verfolgt die Entwicklung der Landschaftsmalerei als künstlerische Auseinandersetzung mit der Natur und dem Verhältnis des Menschen zu ihr.
- Der Wandel des Naturbegriffs im Laufe der Geschichte
- Die philosophischen Interpretationen von Natur und Landschaft
- Die Entwicklung der Landschaftsmalerei als Spiegel der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung
- Das Verhältnis von Mensch und Natur in der Kunst und Philosophie
- Die Bedeutung der Natur für Kunst, Literatur und Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Landschaftsmalerei ein und betont deren Bedeutung als Ausdruck der jeweiligen Epoche und der individuellen Gefühlswelt. Sie hebt die Sehnsucht des Menschen nach der Ursprünglichkeit der Natur hervor, die durch die zunehmende Zivilisation und Verstädterung verloren geht. Die Landschaftsmalerei wird als Möglichkeit der Selbstfindung und der Definition der menschlichen Stellung in der Welt dargestellt. Die Einleitung skizziert den Wandel der Landschaftsmalerei von der Hintergrundkulisse zum eigenständigen Bildthema und ihren Zusammenhang mit dem ästhetischen, kulturellen und wissenschaftlichen Bewusstsein.
2. Zum Begriff der Natur: Dieses Kapitel analysiert den Begriff "Natur" etimologisch und semantisch, beginnend mit der lateinischen Wurzel "natura" und der griechischen Entsprechung. Es differenziert zwischen belebter und unbelebter Natur und betrachtet den Begriff im Kontext von Kultur und Technik. Der ursprüngliche Naturzustand wird definiert, und die vielschichtigen Bedeutungen von "Natur" werden erörtert, einschließlich ihrer Verwendung im alltäglichen Sprachgebrauch und in der Philosophie. Die Kapitel behandelt die Zuweisung von Eigenschaften wie Schönheit, Wahrheit und Reinheit an die Natur und deren Reflexion in der Kunst und Literatur. Der Einfluss des Naturrechts auf politische und juristische Systeme wird ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Landschaftsmalerei, Naturbegriff, Naturphilosophie, Kunstgeschichte, Mensch-Natur-Verhältnis, historische Begriffsbildung, Philosophie, Kulturgeschichte, Ästhetik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Landschaftsmalerei und ihr Zusammenhang mit dem Verständnis von Natur und Landschaft
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Landschaftsmalerei und ihren engen Bezug zum Verständnis von Natur und Landschaft. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Text analysiert den Wandel des Naturbegriffs im Laufe der Geschichte, philosophische Interpretationen von Natur und Landschaft und die Entwicklung der Landschaftsmalerei als Spiegel gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zum Begriff der Natur, Historische Begriffsbildung und Definition der Landschaft, Philosophische Betrachtungsweisen, Landschaftsmalerei vom Mittelalter bis zur klassischen Moderne und Schlussteil. Die Einleitung führt in das Thema ein, während die folgenden Kapitel jeweils einen Aspekt der Thematik vertiefen.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Landschaftsmalerei und ihren Zusammenhang mit dem Verständnis von Natur und Landschaft. Sie beleuchtet die historische Begriffsbildung von "Natur", analysiert philosophische Perspektiven auf die Natur und verfolgt die Entwicklung der Landschaftsmalerei als künstlerische Auseinandersetzung mit der Natur und dem Verhältnis des Menschen zu ihr.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen den Wandel des Naturbegriffs, philosophische Interpretationen von Natur und Landschaft, die Entwicklung der Landschaftsmalerei als Spiegel gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen, das Verhältnis von Mensch und Natur in Kunst und Philosophie sowie die Bedeutung der Natur für Kunst, Literatur und Wissenschaft.
Wie wird der Begriff "Natur" im Text behandelt?
Der Begriff "Natur" wird etimologisch und semantisch analysiert, beginnend mit der lateinischen Wurzel "natura" und der griechischen Entsprechung. Der Text differenziert zwischen belebter und unbelebter Natur, betrachtet den Begriff im Kontext von Kultur und Technik und erörtert die vielschichtigen Bedeutungen von "Natur" im alltäglichen Sprachgebrauch und in der Philosophie. Die Zuweisung von Eigenschaften wie Schönheit, Wahrheit und Reinheit an die Natur und deren Reflexion in Kunst und Literatur werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt die Landschaftsmalerei im Text?
Die Landschaftsmalerei steht im Zentrum des Textes. Sie wird als Spiegel der jeweiligen Epoche und der individuellen Gefühlswelt betrachtet, als Ausdruck der Sehnsucht nach der Ursprünglichkeit der Natur und als Möglichkeit der Selbstfindung und der Definition der menschlichen Stellung in der Welt dargestellt. Der Text verfolgt die Entwicklung der Landschaftsmalerei vom bloßen Hintergrundmotiv zum eigenständigen Bildthema und ihren Zusammenhang mit dem ästhetischen, kulturellen und wissenschaftlichen Bewusstsein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind Landschaftsmalerei, Naturbegriff, Naturphilosophie, Kunstgeschichte, Mensch-Natur-Verhältnis, historische Begriffsbildung, Philosophie, Kulturgeschichte und Ästhetik.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, der Text enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Argumentationslinien jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen.
- Quote paper
- Carolin Piontek (Author), 2012, Natur und Landschaft als ungleiche Begriffe im historischen Wandel der Landschaftsmalerei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282168