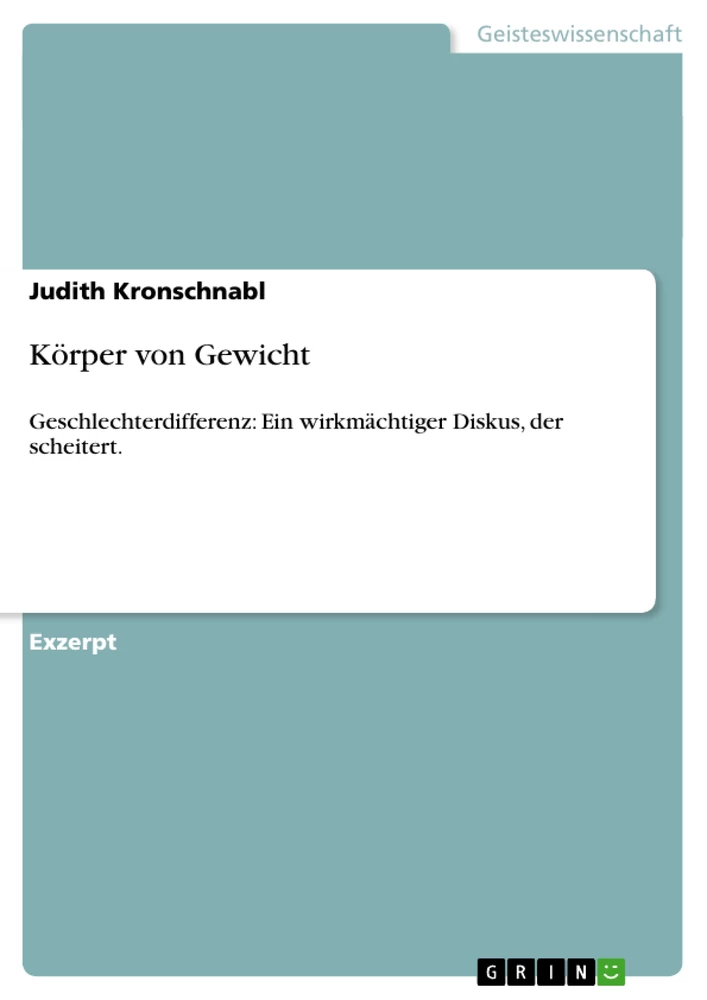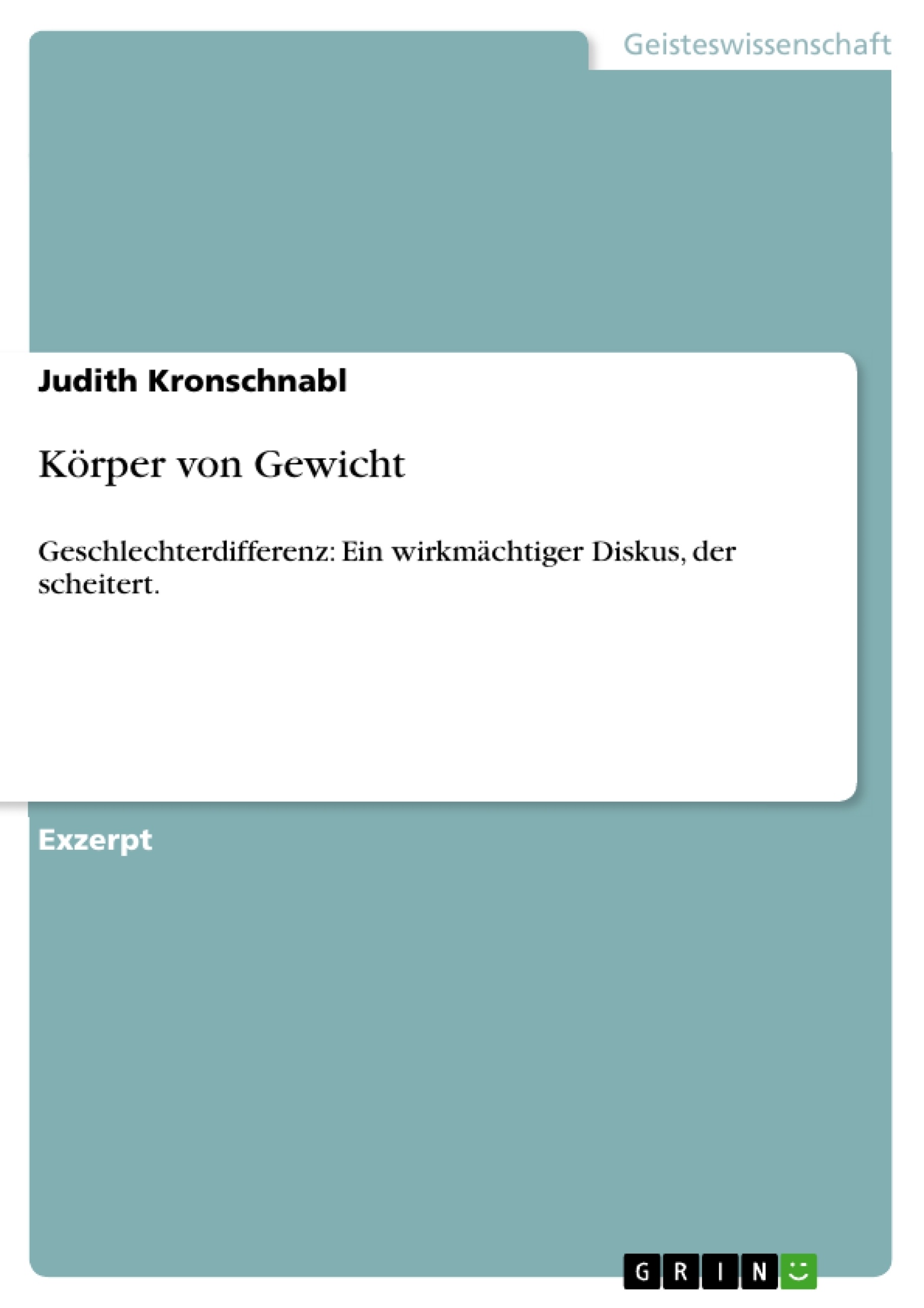Den Text „Körper von Gewicht“ verfasst Butler als Art Ergänzung zu ihrem Buch „Das Unbehagen der Geschlechter“, einerseits um Verwirrungen und Missverständnisse aufzuklären und andererseits um weiter über die Wirkungsweisen der heterosexuellen Vorherrschaft in Bezug auf sexuelle und politische Gegenstände nachzudenken. Dieses Exzerpt befasst sich mit eben diesem Text und erläutert dabei vor allem die Begriffe "gender", "sex" und "Performativität".
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Von der Konstruktion zur Materialisierung
- Performativität als Zitatförmigkeit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Judith Butlers „Körper von Gewicht“ dient als Erweiterung zu ihrem Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“. Sie beleuchtet die Wirkungsweisen der heterosexuellen Vorherrschaft in Bezug auf sexuelle und politische Gegenstände und räumt mit Missverständnissen zum Konzept der Performativität von sozialer Geschlechtsidentität auf.
- Die Performativität von sozialer Geschlechtsidentität und ihre Verbindung zur Materialität des biologischen Geschlechts
- Die Rolle des heterosexuellen Imperativs in der Konstruktion von Subjektivität und Abjektivität
- Die Kritik an der traditionellen Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht
- Die Materialisierung von Normen durch ständige Wiederholung und Zitierung
- Die Bedeutung von Instabilitäten und Brüchen in der Festigung von Geschlechtsnormen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort erläutert die Intention des Textes, die Verwirrungen und Missverständnisse rund um Butlers Konzept der Performativität von Geschlechtsidentität aus „Das Unbehagen der Geschlechter“ zu klären. Es wird die Frage aufgeworfen, wie sich geschlechtliche Praktiken als Orte kritischer Handlungsfähigkeit verstehen lassen, obwohl die Existenz des Subjekts bereits von diesen bestimmt ist.
Die Einleitung führt in Butlers Konzept der Performativität von Geschlechtsidentität ein. Sie beschreibt das biologische Geschlecht als ein regulierendes Ideal, dessen Materialisierung erzwungen wird. Diese Materialisierung erfolgt durch ständige Wiederholung von Normen, die das biologische Geschlecht konstituieren. Performativität wird als die ständig wiederholende und zitierende Praxis verstanden, durch die ein Diskurs die Wirkungen erzeugt, die er benennt. Materialität wird als die produktivste Wirkung von Macht verstanden.
Der Abschnitt „Von der Konstruktion zur Materialisierung“ kritisiert die traditionelle Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht, die das Natürliche als etwas vor der Intelligibilität liegend darstellt. Butler argumentiert, dass das biologische Geschlecht nicht durch Sinnzuweisungen ergänzt, sondern durch soziale Bedeutungen ersetzt wird. Sie ersetzt den Begriff der Konstruktion durch den der Materialisierung, der den Prozess der Stabilisierung von Normen im Laufe der Zeit beschreibt. Die ständige Wiederholung von Normen führt zu Instabilitäten, die das Potential haben, Geschlechtsnormen in eine produktive Krise zu versetzen.
Der Abschnitt „Performativität als Zitatförmigkeit“ bezieht sich auf Lacans Konzept der Geschlechtsannahme und argumentiert, dass diese Annahme durch einen regulierenden Apparat der Heterosexualität erzwungen ist. Butler erklärt die Performativität als eine diskursive Praxis, die das vollzieht, was sie benennt. Diese Macht ist abgeleitet und funktioniert nur durch Zitierung von Normen. Das Geschlecht wird durch ständige Wiederholung und Zitierung als Gesetz gefestigt. Die Performativität ist abhängig von der zwangsweisen und wiederholenden Praxis des heterosexuellen Sexual-Regimes.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Performativität von Geschlechtsidentität, die Materialisierung von Normen, das heterosexuelle Regime, die Konstruktion von Subjektivität und Abjektivität, die Kritik an der Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht und die Bedeutung von Instabilitäten und Brüchen in der Festigung von Geschlechtsnormen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptanliegen von Judith Butlers „Körper von Gewicht“?
Butler klärt Missverständnisse aus ihrem Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“ auf und vertieft die Analyse, wie körperliche Materialität durch diskursive Normen erzeugt wird.
Was bedeutet „Performativität“ bei Butler?
Performativität ist die ständige, zitathafte Wiederholung von Normen, durch die das Geschlecht erst als scheinbar natürliche Tatsache konstituiert wird.
Wie kritisiert Butler die Unterscheidung zwischen „Sex“ und „Gender“?
Butler argumentiert, dass auch das biologische Geschlecht (Sex) bereits kulturell konstruiert ist und nicht als neutrale, biologische Basis vor der sozialen Deutung (Gender) existiert.
Was ist der „heterosexuelle Imperativ“?
Es ist ein gesellschaftlicher Zwang, der Körper in ein binäres System einordnet und die Identität an eine heterosexuelle Matrix bindet, um Subjektivität zu erlangen.
Wie hängen Macht und Materialisierung zusammen?
Die Materialität des Körpers ist für Butler eine Wirkung von Macht; Normen materialisieren sich durch deren ständige Wiederholung und Festigung über die Zeit.
- Citar trabajo
- Judith Kronschnabl (Autor), 2013, Körper von Gewicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282234