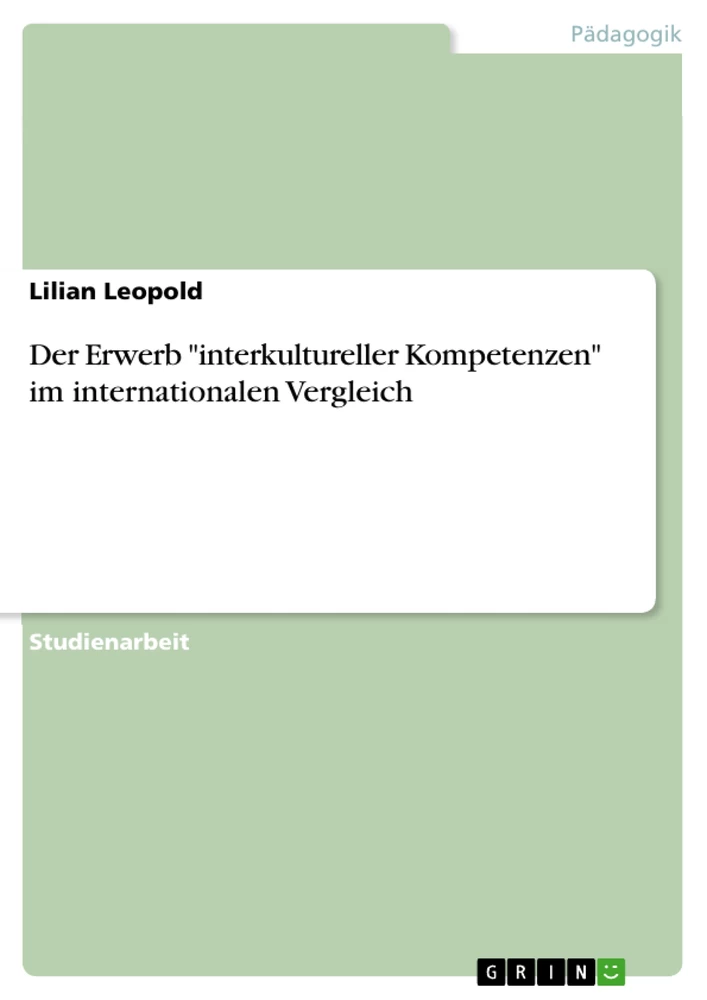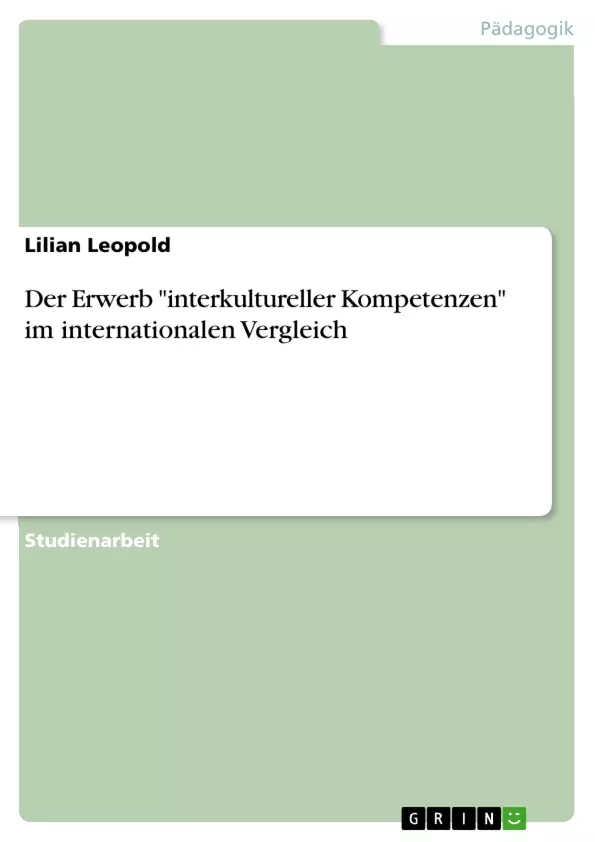Im Kontext einer Globalisierung, die sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene einen Einfluss auf die strukturelle Entwicklung von Beziehungen übt, hat der Erwerb von ‚Interkultureller Kompetenz‘ in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten eine besondere Bedeutung erfahren. Dieser wird inzwischen der Rang einer allgemeinen Schlüsselkompetenz zugesprochen. Ebenso vielfältig und uneinheitlich wie sich die Landschaft der Erwachsenenbildung und Bildungsträger in verschiedenen Staaten gestaltet, verhält es sich mit der Vielfalt des Umgangs mit dem Bedürfnis nach der Steigerung der eigenen interkulturellen Kompetenz. Hier zeigt sich deutlich die Schwierigkeit des internationalen Vergleichs. Vorausgehend soll ein grober Überblick der Diskussion um den wissenschaftlichen Umgang mit interkultureller Bildung und Pädagogik dazu dienen, einen differenzierten Blick auf die Thematik zu entwickeln. Sowohl der wissenschaftliche Blick auf das Zusammenleben verschiedener Kulturen als auch die öffentliche Diskussion unterliegt einem ständigen Wandel bzw. einer ständigen Weiterentwicklung. Diese soll in der vorliegenden Arbeit zunächst im Ansatz bezüglich des Diskurses in Deutschland sowie international nachvollzogen werden. Ergänzt wird dies durch eine kritische Diskussion der Begrifflichkeit und des Themenkomplexes ‚Kultur‘. Schließlich soll ein Einblick in die Thematik ‚Interkulturelle Kompetenz‘ helfen, die sehr verschiedenen Ansätze und Herangehensweisen in Deutschland (stellvertretend für die mitteleuropäischen Staaten) und Indien, welche im zweiten Teil der Arbeit beleuchtet werden, besser einordnen zu können. Schließlich soll versucht werden die beiden Herangehensweisen anhand von Richtlinien, die vom Rat der Europäischen Union verabschiedet wurden, zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Von der Schwierigkeit eines internationalen Vergleichs von Strategien für den Erwerb,interkultureller Kompetenz'
- II. Der pädagogische Kontext - die Interkulturelle Pädagogik und ihre Weiterentwicklung…........
- 1. Die Problematik um den Begriff Kultur
- 2. Die,Interkulturelle Kompetenz' - ein umstrittenes Feld .....
- III. Internationaler Vergleich der Herangehensweise an den Erwerb ‚Interkultureller Kompetenzʻ
- 1. Die Debatte um,Interkulturelle Kompetenz' in Mitteleuropa. Das Beispiel Deutschland....
- 2. Die indische Sicht auf, Interkulturelle Kompetenz'.
- 3. Verschiedene Herangehensweisen. Ein Abgleich......
- IV. Fazit......
- V. Literatur
- VI. Abbildungsverzeichnis........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Erwerb von,Interkultureller Kompetenz' im internationalen Vergleich. Sie analysiert die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Förderung interkultureller Kompetenzen in Deutschland und Indien, wobei die Schwierigkeiten eines internationalen Vergleichs im Vordergrund stehen. Die Arbeit beleuchtet den pädagogischen Kontext der Interkulturellen Pädagogik und ihre Weiterentwicklung, insbesondere die Kritik an der kulturellen Reduktion migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse.
- Die Problematik des Begriffs,Kultur' und seine Bedeutung im Kontext der Interkulturellen Pädagogik.
- Die vielschichtigen und umstrittenen Aspekte des Begriffs,Interkulturelle Kompetenz' und seine Relevanz in der heutigen globalisierten Welt.
- Der internationale Vergleich der Herangehensweisen an den Erwerb von,Interkultureller Kompetenz' in Deutschland und Indien.
- Die Herausforderungen und Chancen der Interkulturellen Pädagogik im Kontext von Migration und Globalisierung.
- Die Bedeutung von interkulturellen Kompetenzen für die Gestaltung eines gelingenden Zusammenlebens in multikulturellen Gesellschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I beleuchtet die Schwierigkeiten eines internationalen Vergleichs von Strategien für den Erwerb von,Interkultureller Kompetenz'. Es wird deutlich, dass die Bedeutung von interkulturellen Kompetenzen in einer globalisierten Welt immer wichtiger wird, jedoch die Herangehensweisen an die Förderung dieser Kompetenzen in verschiedenen Ländern stark variieren.
Kapitel II widmet sich dem pädagogischen Kontext der Interkulturellen Pädagogik und ihrer Weiterentwicklung. Es werden die Problematik des Begriffs,Kultur' und die Kritik an der kulturellen Reduktion migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse diskutiert.
Kapitel III vergleicht die Herangehensweisen an den Erwerb von,Interkultureller Kompetenz' in Deutschland und Indien. Es werden die unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven auf die Förderung interkultureller Kompetenzen in beiden Ländern beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Erwerb von,Interkultureller Kompetenz', den internationalen Vergleich, die Interkulturelle Pädagogik, die Problematik des Begriffs,Kultur', die Kritik an der kulturellen Reduktion migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse, die Herangehensweisen an die Förderung interkultureller Kompetenzen in Deutschland und Indien sowie die Herausforderungen und Chancen der Interkulturellen Pädagogik im Kontext von Migration und Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter interkultureller Kompetenz?
Interkulturelle Kompetenz gilt als Schlüsselqualifikation für das gelingende Zusammenleben und Interagieren in einer globalisierten, multikulturellen Welt.
Warum ist ein internationaler Vergleich schwierig?
Die Bildungssysteme und Trägerlandschaften sind weltweit sehr uneinheitlich, ebenso wie die Definitionen von 'Kultur' und 'Kompetenz'.
Wie unterscheidet sich die Sichtweise in Deutschland und Indien?
Die Arbeit vergleicht mitteleuropäische Ansätze (Beispiel Deutschland) mit der indischen Perspektive auf den Erwerb dieser Kompetenzen.
Welche Rolle spielt der Begriff 'Kultur' in der Pädagogik?
Der Begriff ist umstritten; die Arbeit kritisiert die oft stattfindende kulturelle Reduktion von migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen.
Welche Richtlinien dienen als Vergleichsbasis?
Als objektive Vergleichsbasis werden Richtlinien herangezogen, die vom Rat der Europäischen Union verabschiedet wurden.
- Quote paper
- Lilian Leopold (Author), 2013, Der Erwerb "interkultureller Kompetenzen" im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282346