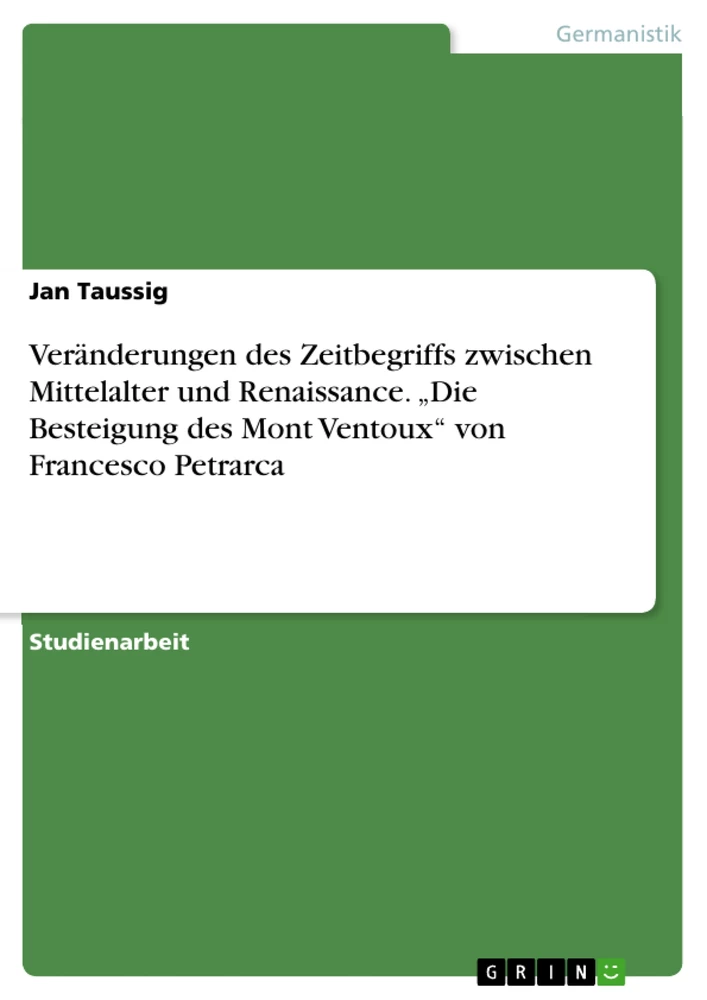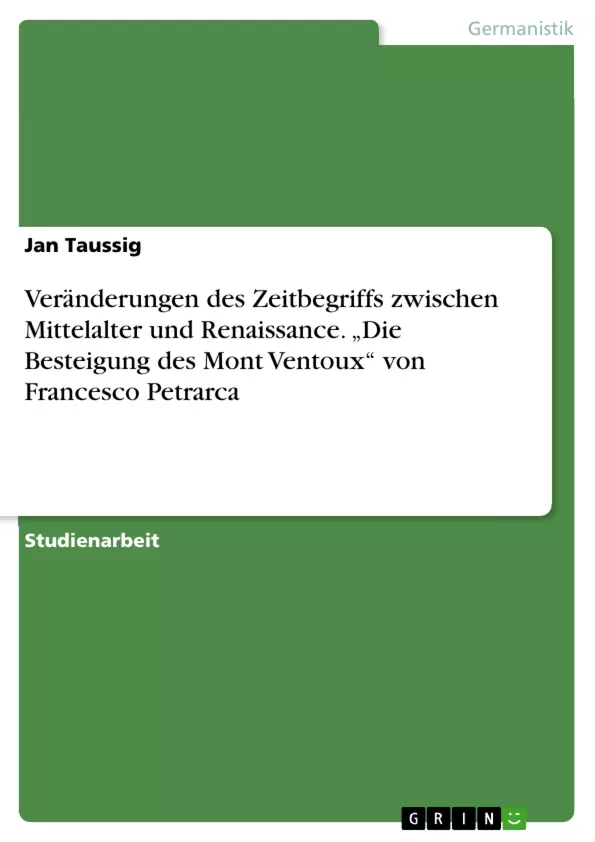In der vorliegenden Arbeit wird versucht, sich der Zeitauffassung im Mittelalter im Gegensatz zur Renaissance zu nähern. Welchen Stellenwert hatte die Zeit in welcher Epoche, was waren die geschichtlichen Gründe hierfür und wie wurde das Thema künstlerisch verarbeitet? Dies sind die zentralen Fragen, denen nachgegangen werden soll. Francesco Petrarcas „Die Besteigung des Mont Ventoux“ gilt als epochenübergreifender Text. Ob er auch inhaltlich und / oder formal exemplarisch für den Bedeutungswandel und die Stellenwertverschiebung des Zeitbegriffes in der Übergangsszeit vom Mittelalter zur Renaissance gelten kann, wird zu erörtern sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Zielsetzung, Erläuterung des Aufbaus
- Mittelalter
- Historische Rahmenbedingungen für die Zeitwahrnehmung im Mittelalter
- Künstlerische Umsetzung
- Renaissance
- Historische Rahmenbedingungen für die Zeitwahrnehmung in der Renaissance
- Künstlerische Umsetzung
- Anwendung auf „Die Besteigung des Mont Ventoux"
- Ergebnis
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Wandel des Zeitbegriffs zwischen Mittelalter und Renaissance. Sie untersucht, wie die Zeit in beiden Epochen wahrgenommen und künstlerisch verarbeitet wurde. Der Fokus liegt dabei auf Francesco Petrarcas „Die Besteigung des Mont Ventoux", einem Werk, das als Übergangsphänomen zwischen den beiden Epochen gilt. Die Arbeit analysiert, ob Petrarcas Werk exemplarisch für die Verschiebung des Zeitbegriffs in der Übergangsphase vom Mittelalter zur Renaissance steht.
- Zeitwahrnehmung im Mittelalter und in der Renaissance
- Historische Rahmenbedingungen für die Zeitwahrnehmung in beiden Epochen
- Künstlerische Umsetzung des Zeitbegriffs im Mittelalter und in der Renaissance
- Analyse von Francesco Petrarcas „Die Besteigung des Mont Ventoux" im Kontext des Zeitbegriffs
- Bedeutungswandel und Stellenwertverschiebung des Zeitbegriffs in der Übergangsphase vom Mittelalter zur Renaissance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und erläutert den Aufbau. Sie beleuchtet die Schwierigkeit, die Zeitgrenzen zwischen Mittelalter und Renaissance exakt zu definieren und betont die Notwendigkeit, Kontinuität und Wandel in dialektischer Verschränkung zu betrachten.
Das Kapitel „Mittelalter" untersucht die historischen Rahmenbedingungen für die Zeitwahrnehmung im Mittelalter. Es analysiert die semantische Vielfalt des Begriffs „Zeit" und die Herausforderungen, die sich aus der Betrachtung vergangener Epochen mit heutigen Kategorien ergeben. Das Kapitel beleuchtet die Lebensumstände des mittelalterlichen Menschen und zeigt auf, wie diese sein Zeit- und Weltbild prägten.
Das Kapitel „Renaissance" widmet sich der Zeitwahrnehmung in der Renaissance. Es analysiert die historischen Rahmenbedingungen und die künstlerische Umsetzung des Zeitbegriffs in dieser Epoche.
Das Kapitel „Anwendung auf „Die Besteigung des Mont Ventoux"“ untersucht Petrarcas Werk im Kontext der Zeitwahrnehmung im Mittelalter und in der Renaissance. Es analysiert, ob Petrarcas Werk exemplarisch für die Verschiebung des Zeitbegriffs in der Übergangsphase vom Mittelalter zur Renaissance steht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Zeitbegriff, das Mittelalter, die Renaissance, Francesco Petrarca, „Die Besteigung des Mont Ventoux", Zeitwahrnehmung, historische Rahmenbedingungen, künstlerische Umsetzung, Epochenwandel, Übergangsphänomen.
- Arbeit zitieren
- Jan Taussig (Autor:in), 2001, Veränderungen des Zeitbegriffs zwischen Mittelalter und Renaissance. „Die Besteigung des Mont Ventoux“ von Francesco Petrarca, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282354