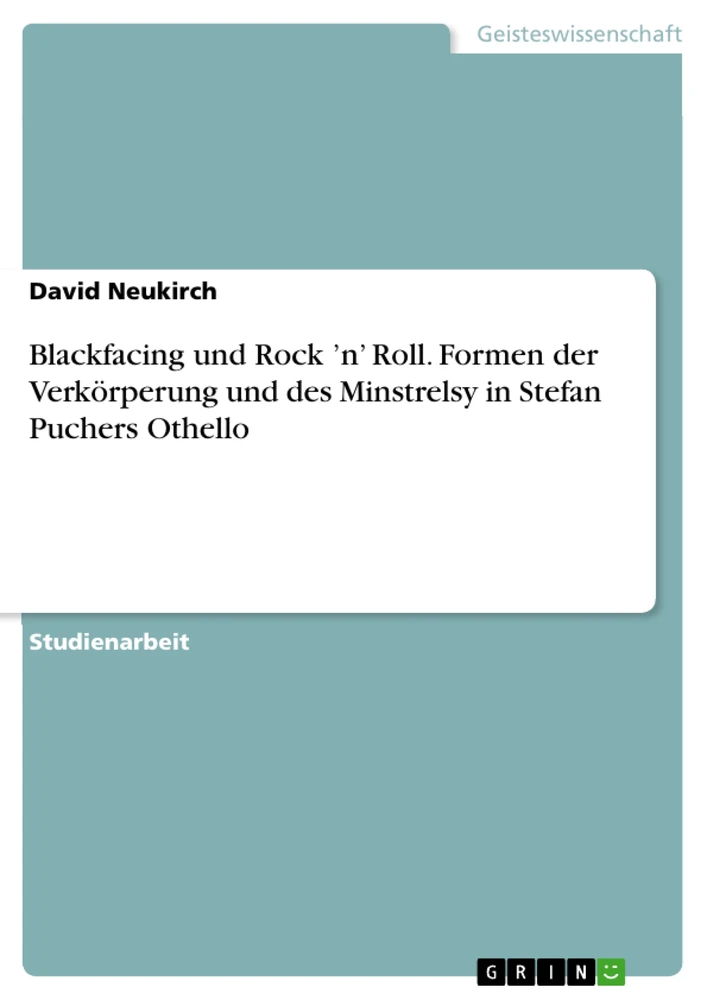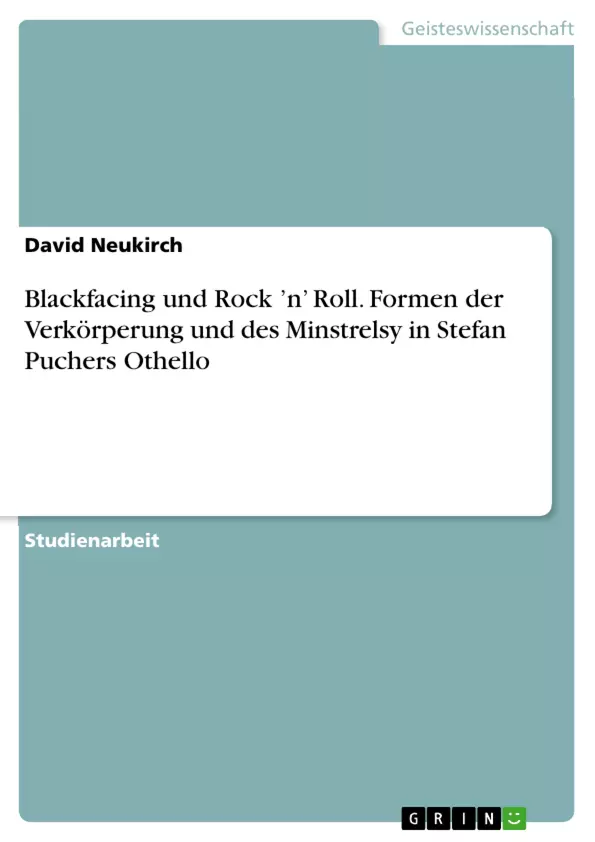In dieser Arbeit werde ich untersuchen, wie Alexander Scheer den Othello in Puchers Inszenierung verkörpert. Dazu werde ich Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen und Hans-Thies Lehmanns Postdramatisches Theater nutzen, die zur Analyse von zeitgenössischen Theateraufführungen ein geeignetes Instrumentarium geliefert haben. Dabei wird mein Augenmerk vor allem auf den Szenen liegen, in denen man als Zuschauer weniger den Eindruck hat, einen Othello vor sich zu sehen, sondern die dramatische Rolle hinter dem individuellen, phänomenalen Leib Scheers verschwindet.
In einem Ausblick möchte ich mich dann noch kurz, soweit der Rahmen dieser Hausarbeit das zulässt, dem Blackfacing zuwenden. Hier werde ich zunächst unter Verwendung der erst kürzlich erschienenen Reflexion von ethnischer Identität(szuweisung) im deutschen Gegenwartstheater der Mainzer Theaterwissenschaftlerin Hanna Voss einen knappen Abriss über die Geschichte des minstrelsy liefern, und dann auf die Frage eingehen, inwiefern der Hamburger Othello in der Tradition dieser amerikanischen Kunstform steht. Zu guter Letzt möchte ich dann noch einige Überlegungen anstellen, welche Ziele Stefan Pucher mit seiner Inszenierung verfolgt haben könnte, als er sie als eine Art Nummernrevue anlegte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alexander Scheers Verkörperung des Othello
- „Schlicht und ungeschminkt“
- Musikalisierung: Othello/Scheer der Rockstar
- Alexander Scheers Körperlichkeit
- Ausblick: Blackfacing
- Minstrelsy
- Othello: eine Minstrel-Show?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Verkörperung des Othello durch Alexander Scheer in Stefan Puchers Inszenierung des gleichnamigen Shakespeare-Stücks am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Sie untersucht, wie Scheers Körperlichkeit und Spielweise die Darstellung beeinflussen und welche Aspekte der Inszenierung im Kontext von Blackfacing problematisch sind.
- Verkörperung des Othello durch Alexander Scheer
- Analyse der Inszenierung im Kontext von Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen und Hans-Thies Lehmanns Postdramatischem Theater
- Kritik des Blackfacing und dessen historische Bedeutung im Kontext von Minstrelsy
- Untersuchung der Rolle des Publikums und seiner Interaktion mit der Inszenierung
- Bewertung der Inszenierung im Kontext von zeitgenössischen Diskussions um Repräsentation und Diversität im Theater
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Inszenierung von Stefan Pucher und die Rolle des Blackfacing in den Kontext der zeitgenössischen Debatte um Diversität und Repräsentation im Theater. Kapitel 2 untersucht, wie Alexander Scheer den Othello verkörpert. Dabei werden die Konzepte der Verkörperung und der Körperlichkeit im Theater anhand der Inszenierung erläutert. Kapitel 2.1 beleuchtet, wie die Diskrepanz zwischen der dramatischen Figur des Othello und der weißen Erscheinung Scheers durch die Inszenierung ins Zentrum gestellt wird. Kapitel 2.2 befasst sich mit der Musikalisierung der Inszenierung und der Inszenierung des phänomenalen Leibes Scheers.
Schlüsselwörter
Verkörperung, Körperlichkeit, Blackfacing, Minstrelsy, Othello, Alexander Scheer, Stefan Pucher, Erika Fischer-Lichte, Hans-Thies Lehmann, Theater, Inszenierung, Repräsentation, Diversität, Zeitgenössisches Theater.
Häufig gestellte Fragen
Was wird an der Othello-Inszenierung von Stefan Pucher analysiert?
Die Arbeit untersucht die körperliche Darstellung Othellos durch Alexander Scheer und die Verwendung von Blackfacing im Kontext zeitgenössischer Theaterästhetik.
Was ist 'Blackfacing' im historischen Kontext?
Blackfacing stammt aus der US-Minstrel-Tradition des 19. Jahrhunderts, bei der weiße Darsteller schwarze Menschen durch Schminke stereotyp und rassistisch karikierten.
Wie nutzt Alexander Scheer seinen Körper in der Rolle?
Scheer inszeniert Othello als "Rockstar". Die Arbeit analysiert dies mit Begriffen wie dem "phänomenalen Leib" und der Musikalisierung der Aufführung.
Was versteht man unter 'Postdramatischem Theater' nach Lehmann?
Es bezeichnet Theaterformen, die sich vom klassischen Textfokus lösen und stattdessen Performance, Körperlichkeit und die Interaktion mit dem Publikum betonen.
Warum ist die Inszenierung als 'Nummernrevue' angelegt?
Pucher nutzt dieses Format vermutlich, um die Künstlichkeit der Darstellung zu betonen und die Zuschauer zur Reflexion über Rollenbilder und Repräsentation anzuregen.
- Citar trabajo
- David Neukirch (Autor), 2014, Blackfacing und Rock ’n’ Roll. Formen der Verkörperung und des Minstrelsy in Stefan Puchers Othello, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282551