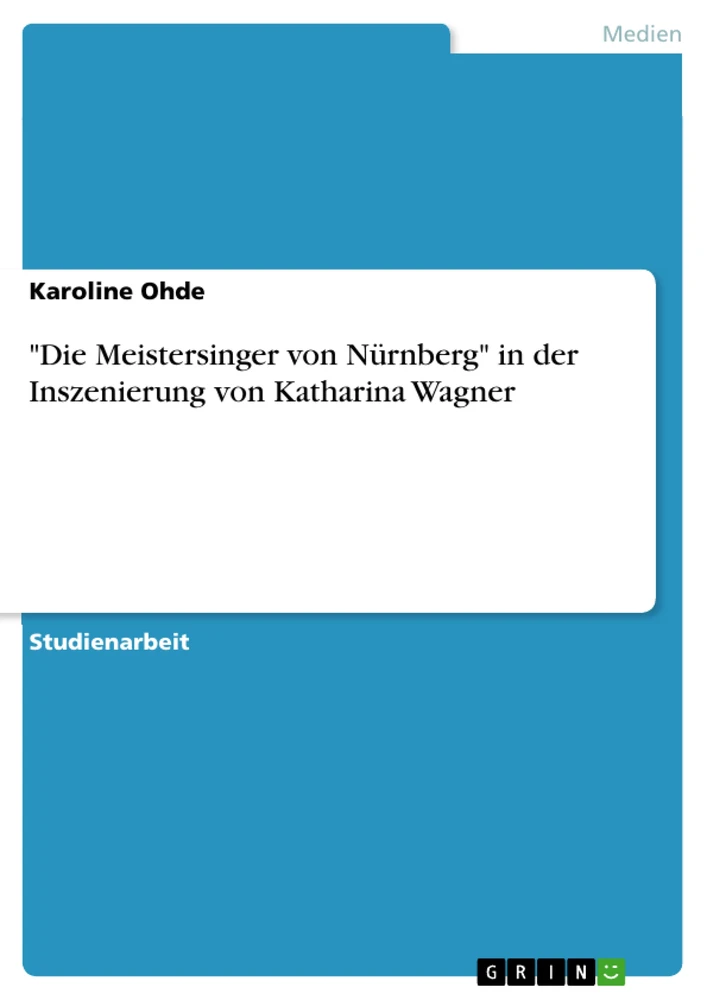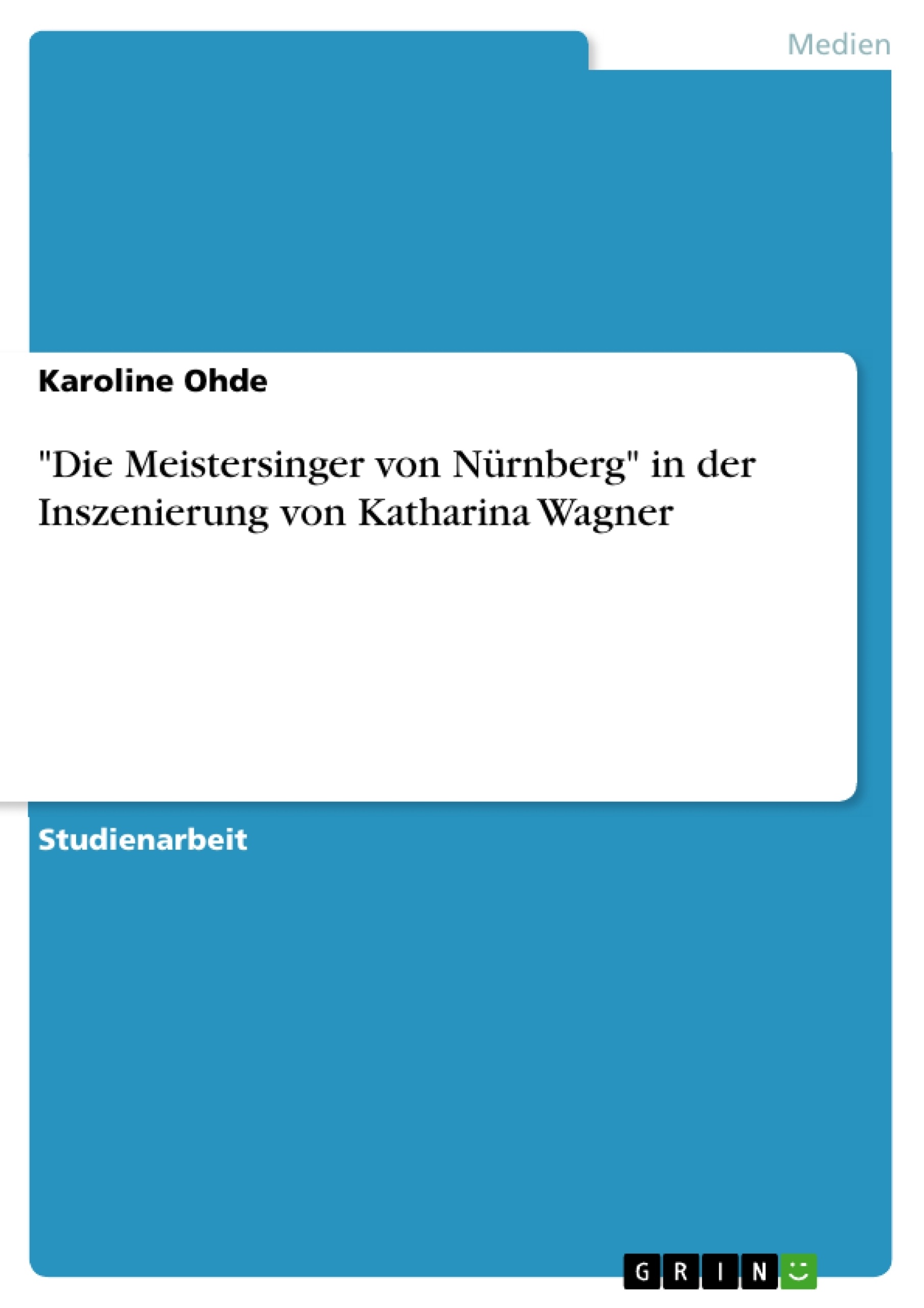Schwierigkeiten mit den Meistersingern, das sind auch Schwierigkeiten mit Wagner, mit Bayreuth und mit der Oper im Allgemeinen. Jugend und Oper scheinen ebenso wie die Wagnerianer und die Moderne ein Gegensatz zu sein. Moderne Opern-Inszenierungen bieten demnach eine enorme Reibungsfläche. Alteingesessene Opern-Fans zeigen sich kritisch, Kritiker objektiv und Teile des Publikums begeistert.
Die Inszenierung der Meistersinger von Nürnberg von Katharina Wagner steht im Mittelpunkt dieser Arbeit, da diese äußerst vielschichtig ist und Raum für Interpretationen lässt. Von besonderem Interesse ist, warum das Stück und die damit verbundene Modernität, die nicht erst 2007 in Bayreuth Einzug erhält, auf Ablehnung stieß.
Die Meistersinger von Nürnberg haben eine lange Inszenierungs-Geschichte bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth. Und wurden größtenteils nur von Mitgliedern der Wagner-Familie inszeniert. Festzustellen ist, dass dabei der Versuch unternommen wurde das Stück durch die Adaption moderner Inszenierungspraxis in das Hier und Jetzt zu transformieren und das Werk nicht als starre Geschichte einer vergangenen Zeit über die Bühne gehen zu lassen. Im Jahr 2007 macht die Ur-Enkelin Wagners, Katharina Wagner, auf sich aufmerksam, indem sie die Meistersinger neu interpretierte. Auch hier sind die Meinungen divers.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bayreuther Festspiele: Historie & Aufführungspraxis
- Wagners Meistersinger von Nürnberg
- Handlung
- Die Meistersinger in Bayreuth
- Katharina Wagners Inszenierung
- Die Transformation des Auditiven auf die visuelle Ebene
- Allegorie, Mimesis und Transformation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Katharina Wagners Inszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“ bei den Bayreuther Festspielen 2007 und beleuchtet, wie diese Inszenierung die Moderne und Innovation in Bayreuth etabliert. Das Ziel ist es, die von Wagner eingeführte Modernisierung aufzuzeigen und zu erklären, warum sie trotz ihrer innovativen Ansätze auf Ablehnung stieß.
- Die Bayreuther Festspiele und ihre Geschichte
- Wagners Konzept des „Gesamtkunstwerks“
- Die Inszenierungsgeschichte der „Meistersinger von Nürnberg“ in Bayreuth
- Katharina Wagners Inszenierung und die Transformation des Auditiven in das Visuelle
- Die Kritik an der modernen Inszenierung und die Auseinandersetzung mit Tradition und Innovation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik der „Meistersinger“ im Kontext der Bayreuther Festspiele und der modernen Operninszenierung beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich der Geschichte der Bayreuther Festspiele und beleuchtet Richard Wagners Vision vom „Gesamtkunstwerk“. Kapitel 3 analysiert die Handlung und die Inszenierungsgeschichte der „Meistersinger von Nürnberg“ in Bayreuth. Schließlich beleuchtet Kapitel 4 die Inszenierung von Katharina Wagner, insbesondere die Transformation des Auditiven auf die visuelle Ebene und die Wandlung der Hauptcharaktere.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Bayreuther Festspiele, Richard Wagner, „Meistersinger von Nürnberg“, Katharina Wagner, Modernisierung, Innovation, Tradition, „Gesamtkunstwerk“, Inszenierungspraxis, Transformation, visuelle Ebene.
- Arbeit zitieren
- Karoline Ohde (Autor:in), 2012, "Die Meistersinger von Nürnberg" in der Inszenierung von Katharina Wagner, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282559