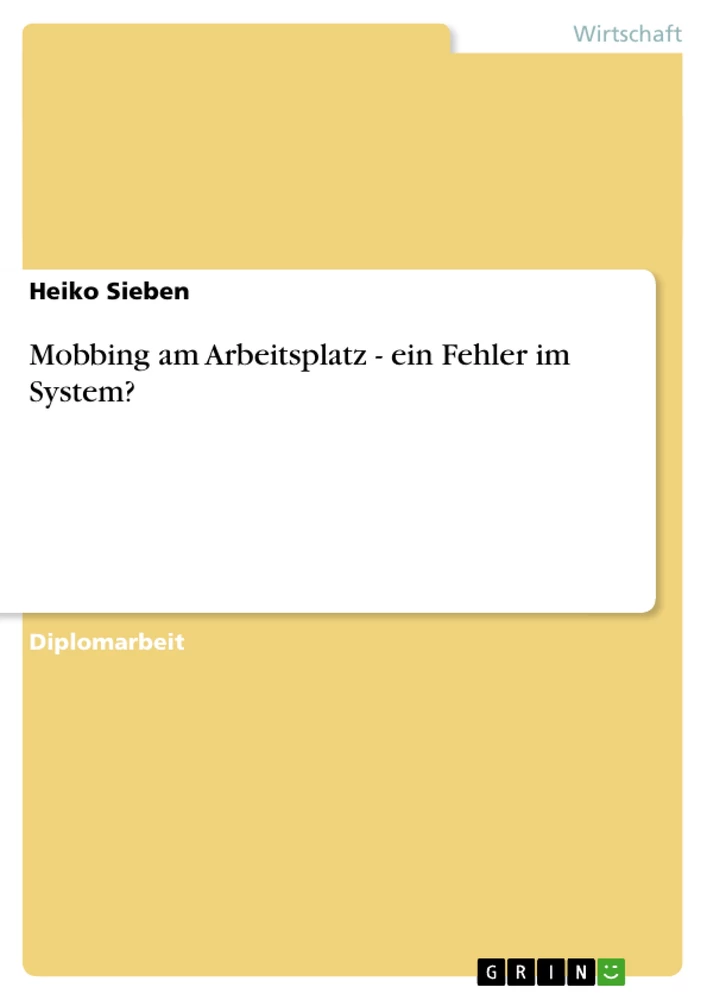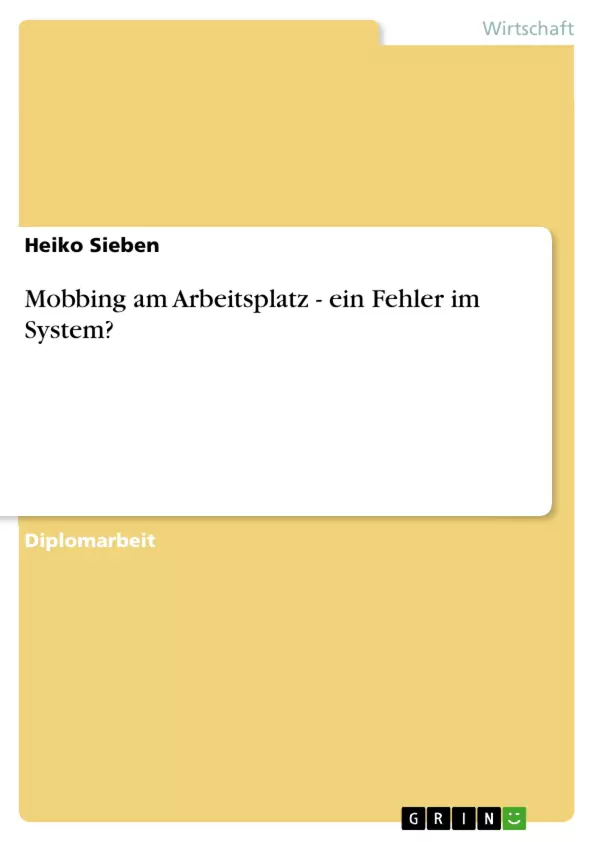Themenstellung und Ziel der Arbeit
Die Ökonomie des 21. Jahrhunderts ist geprägt durch hohe Arbeitslosenzahlen, zunehmende Finanznot der öffentlichen Haushalte, reformbedürftige Sozialsysteme und weitreichende demografische Veränderungen. In den abendländischen Industrienationen vollzieht sich ein tiefgreifender Wertewandel. Vor dem Hintergrund einschneidender Sparmaßnahmen und einer mit der Globalisierung einhergehenden gesellschaftlichen Veränderung beherrschen die Angst vor Arbeitslosigkeit, Verunsicherung und Konkurrenzdruck das soziale Klima in den Betrieben und den Selbsterhaltungstrieb des Einzelnen. Als Richtschnur des Erfolgs dienen persönliches Fortkommen und Eigennutz (Litzcke & Schuh, 2003).
Seit Beginn der 90er Jahre hat sich der Begriff „Mobbing“ in der wissenschaftlichen Diskussion etabliert. „Mobbing am Arbeitsplatz“ kann also als relativ junger Forschungszweig bezeichnet werden. Ob Mobbing aber als ein neues Phänomen der Arbeitswelt betrachtet werden kann, erscheint fraglich. Nicht erst seit den Veröffentlichungen des schwedischen Arbeitswissenschaftlers Leymann (u.a. 1993a) ist bekannt, dass sich eine zunehmende Anzahl von Menschen an ihrem Arbeitsplatz übermäßigem Druck vonseiten der Mitarbeiter und/oder Vorgesetzten ausgesetzt fühlen. Die Verhaltensweisen sind gekennzeichnet durch Ignoranz rechtsstaatlicher und bislang gültiger gesellschaftlicher Wertmaßstäbe im gegenseitigen Umgang.
Mobbing wird weitestgehend in einen stresstheoretischen Kontext gestellt. Dies ist sinnvoll, weil ein zentraler Aspekt von Mobbing in der Verknüpfung einer betrieblichen Belastungssituation – nämlich Konflikte mit Mitarbeitern und/oder Vorgesetzten – und den zum Teil verheerenden gesundheitlichen Folgen für die Mobbingbetroffenen liegt. Auffällig ist, dass die pathogene Wirkung eskalierender Konflikte in der arbeits- und organisationspsychologischen Stressforschung ungewöhnlich stark vernachlässigt wird. So gibt es zwar eine große Anzahl von Publikationen zum Thema Stress, aber nur wenige, die soziale Stressoren in Betrieben untersuchen und noch weniger, die sich mit Mobbing auseinandersetzen (Zapf, 1999). Als Gegenbeispiel führt Zapf (2000) eine Studie von Schwartz und Stone (1993) an. In ihrer Tagebuchstudie kristallisierten sich negative emotionale Interaktionen mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten und Kunden als das mit Abstand belastendste Ereignis im Arbeitsleben heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobbing am Arbeitsplatz - Definition und Abgrenzung
- Auswirkungen von Mobbing
- Ursachen von Mobbing
- Prävention und Intervention
- Juristische Aspekte
- Systemisches Denken und Mobbing
- Handlungsmöglichkeiten für Betroffene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz und hinterfragt dessen Ursachen, Auswirkungen und Möglichkeiten der Prävention und Intervention. Dabei wird ein systemischer Ansatz verfolgt, um die Komplexität des Themas zu erfassen.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing im arbeitswissenschaftlichen Kontext
- Auswirkungen von Mobbing auf Betroffene, Unternehmen und Volkswirtschaft
- Analyse der Ursachen von Mobbing auf gesellschaftlicher, betrieblicher und individueller Ebene
- Vorstellung systemischer Denkweisen im Kontext von Mobbing
- Entwicklung eines Modells zur Handlungsfähigkeit Betroffener
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing am Arbeitsplatz ein und beschreibt die wachsende Bedeutung des Themas in den letzten Jahren. Sie begründet die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Mobbing am Arbeitsplatz - Definition und Abgrenzung: Dieses Kapitel definiert Mobbing detailliert im arbeitswissenschaftlichen Kontext und beschreibt die Grenzen zwischen alltäglichen Konflikten am Arbeitsplatz und Mobbing. Es differenziert zwischen verschiedenen Formen von Mobbing und deren Auswirkungen. Die Definition umfasst die Dauer, Häufigkeit und Intensität des unerwünschten Verhaltens. Es werden verschiedene Definitionen und Modelle von Mobbing vorgestellt und miteinander verglichen. Das Kapitel dient der Abgrenzung gegenüber Konflikten und bietet ein fundiertes Verständnis der Problematik.
Auswirkungen von Mobbing: Dieses Kapitel beleuchtet die schwerwiegenden Folgen von Mobbing für Betroffene, Unternehmen und die Gesellschaft. Es analysiert die physischen und psychischen Belastungen der Opfer, die sich in erhöhten Krankenständen, Fluktuation und Produktivitätsverlusten niederschlagen. Die Kosten für Unternehmen und die Volkswirtschaft werden detailliert dargestellt. Die Auswirkungen reichen von leichten Beeinträchtigungen bis hin zu schweren psychischen Erkrankungen. Die Kapitel beleuchtet auch die Langzeitfolgen und die Herausforderungen der Reintegration.
Ursachen von Mobbing: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von Mobbing auf gesellschaftlicher, betrieblicher und individueller Ebene. Es werden Faktoren wie Organisationskultur, Führungsstil, Arbeitsbedingungen und die Persönlichkeit der Beteiligten analysiert. Es werden gesellschaftliche Normen und Werte diskutiert, die zu einem toleranten Klima für Mobbing beitragen können. Betriebliche Strukturen und Prozesse, die Mobbing begünstigen, werden ebenso kritisch beleuchtet. Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse von empirischen Studien und liefert eine umfassende Ursachenanalyse.
Prävention und Intervention: Dieses Kapitel beschreibt Präventions- und Interventionsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Es werden Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Führungsstils und der Organisationskultur vorgestellt. Weiterhin werden Interventionsprogramme für Betroffene und Täter detailliert dargestellt. Es wird ein multifaktorieller Ansatz empfohlen, welcher auf der Vermeidung des Problems basiert, aber auch Wege aus bereits bestehenden Mobbingsituationen anbietet.
Juristische Aspekte: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Schutzes vor Mobbing am Arbeitsplatz. Es beschreibt die relevanten Gesetze und Rechtsprechung. Es klärt über die Möglichkeiten, rechtliche Schritte gegen Mobbing einzuleiten und die Erfolgsaussichten. Die Grenzen rechtlicher Möglichkeiten werden diskutiert und es werden Strategien zur rechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen aufgezeigt.
Systemisches Denken und Mobbing: Dieses Kapitel arbeitet die Bedeutung des systemischen Denkens für das Verständnis von Mobbing heraus. Es betrachtet Mobbing als ein Systemproblem, als systemische Interaktion und als komplexe Wirklichkeitskonstruktion. Der systemisch-konstruktivistische Blickwinkel ermöglicht es, Strukturen und Funktionszusammenhänge sowie die beteiligten Menschen mit ihren Wirklichkeitskonstruktionen zu betrachten.
Handlungsmöglichkeiten für Betroffene: Dieses Kapitel entwickelt ein Modell, das Betroffenen Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Mobbing bietet. Es erläutert Strategien zur Selbstbehauptung, Konfliktlösung und zum Schutz der eigenen Rechte. Es stellt verschiedene Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten vor.
Schlüsselwörter
Mobbing, Arbeitsplatz, Konflikt, Systemisches Denken, Prävention, Intervention, Juristische Aspekte, Belastung, Gesundheit, Arbeitsrecht, Führungsstil, Organisationskultur
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Mobbing am Arbeitsplatz"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über Mobbing am Arbeitsplatz?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Mobbing am Arbeitsplatz. Sie definiert Mobbing, untersucht dessen Auswirkungen auf Betroffene, Unternehmen und die Gesellschaft, analysiert die Ursachen auf verschiedenen Ebenen (gesellschaftlich, betrieblich, individuell), beschreibt Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, beleuchtet juristische Aspekte und entwickelt ein Handlungsmodell für Betroffene. Ein systemischer Ansatz wird verwendet, um die Komplexität des Themas zu erfassen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Abgrenzung von Mobbing, Auswirkungen von Mobbing (physisch, psychisch, wirtschaftlich), Ursachenanalyse auf verschiedenen Ebenen, Präventions- und Interventionsstrategien, juristische Aspekte, systemisches Denken im Kontext von Mobbing und Handlungsmöglichkeiten für Betroffene.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Definition und Abgrenzung von Mobbing, Auswirkungen von Mobbing, Ursachen von Mobbing, Prävention und Intervention, Juristische Aspekte, Systemisches Denken und Mobbing und Handlungsmöglichkeiten für Betroffene. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung.
Welche Definition von Mobbing wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine arbeitswissenschaftliche Definition von Mobbing, die Dauer, Häufigkeit und Intensität des unerwünschten Verhaltens berücksichtigt. Sie differenziert zwischen Mobbing und alltäglichen Konflikten und vergleicht verschiedene Mobbing-Definitionen und -Modelle.
Welche Auswirkungen von Mobbing werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Mobbing auf Betroffene (physische und psychische Gesundheit), Unternehmen (Krankenstände, Fluktuation, Produktivitätsverluste) und die Volkswirtschaft (Kosten). Langzeitfolgen und Reintegrationsherausforderungen werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Ursachen für Mobbing werden analysiert?
Die Ursachenanalyse betrachtet gesellschaftliche Normen und Werte, betriebliche Strukturen und Prozesse (Organisationskultur, Führungsstil, Arbeitsbedingungen) sowie individuelle Persönlichkeitsfaktoren.
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Führungsstils und der Organisationskultur sowie Interventionsprogramme für Betroffene und Täter. Ein multifaktorieller Ansatz wird empfohlen.
Welche juristischen Aspekte werden behandelt?
Das Kapitel zu den juristischen Aspekten beschreibt relevante Gesetze und Rechtsprechung, Möglichkeiten rechtlicher Schritte gegen Mobbing, Erfolgsaussichten und Strategien zur Durchsetzung von Ansprüchen.
Wie wird systemisches Denken im Kontext von Mobbing eingesetzt?
Der systemische Ansatz betrachtet Mobbing als ein Systemproblem, als systemische Interaktion und als komplexe Wirklichkeitskonstruktion. Er ermöglicht es, Strukturen, Funktionszusammenhänge und die beteiligten Personen mit ihren Wirklichkeitskonstruktionen zu betrachten.
Welche Handlungsmöglichkeiten werden Betroffenen angeboten?
Die Arbeit entwickelt ein Modell mit Handlungsmöglichkeiten für Betroffene, einschließlich Strategien zur Selbstbehauptung, Konfliktlösung, Schutz der eigenen Rechte und Vorstellung verschiedener Hilfsangebote.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobbing, Arbeitsplatz, Konflikt, Systemisches Denken, Prävention, Intervention, Juristische Aspekte, Belastung, Gesundheit, Arbeitsrecht, Führungsstil, Organisationskultur.
- Arbeit zitieren
- Heiko Sieben (Autor:in), 2004, Mobbing am Arbeitsplatz - ein Fehler im System?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28261