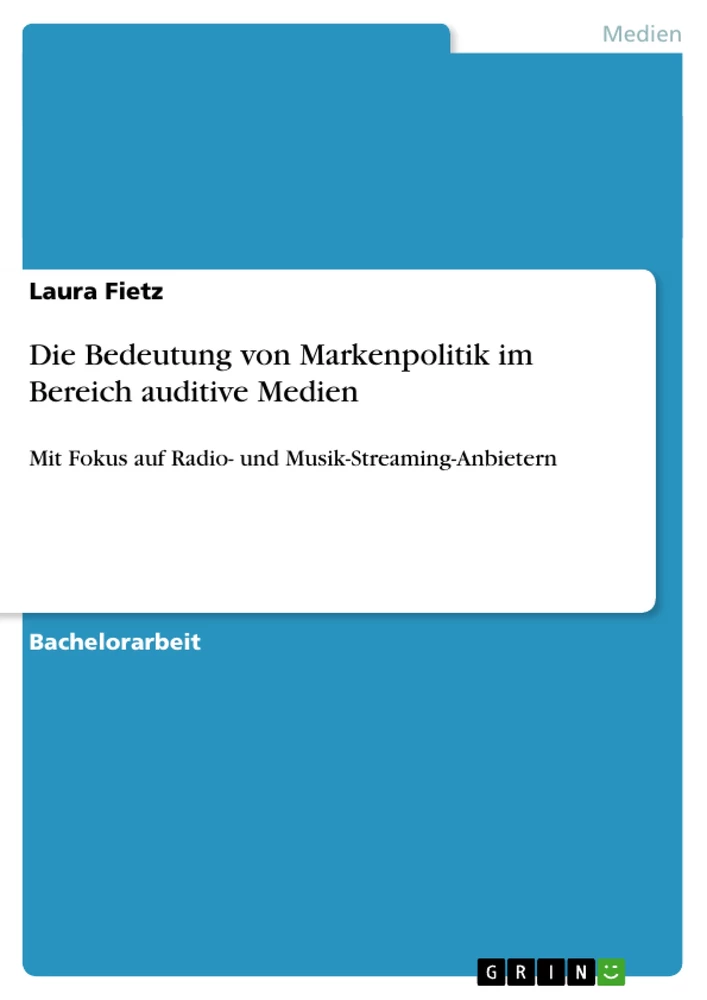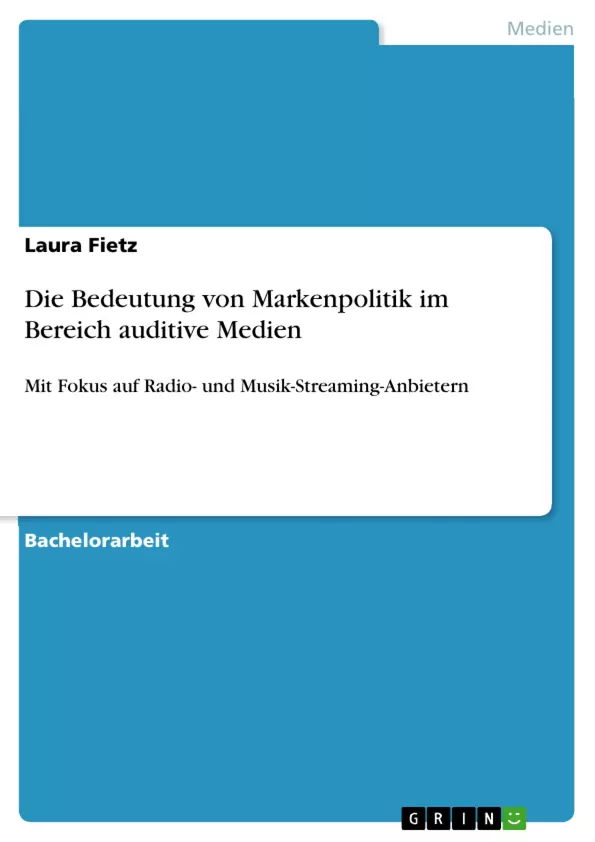Medien haben sich seit der ersten Radioübertragung im Jahr 1923 stark verändert. Das Medium Radio genießt schon lange keine Monopolstellung mehr und die Konkurrenz wird durch neue technische Entwicklungen immer größer. Das Internet ermöglicht den Rezipienten nicht nur regionale, sondern auch internationale Radiosender zu hören. Für Medienunternehmen ist es also sehr wichtig eine starke Marke zu präsentieren, die zwar dem Wandel der Zeit angepasst wird, bestimmte Wiedererkennungsmerkmale jedoch behält.
Was eine starke auditive Medienmarke ausmacht, die sich erfolgreich von der Konkurrenz abheben kann, erfahren Sie in dieser Arbeit.
Untersucht wurden zwei Radiosender sowie zwei Musik-Streaming-Portale. Außerdem wurde für diese Arbeit eine Umfrage zum Konsumverhalten auditiver Medien durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung der Bachelorarbeit
- Begriff der Marke
- Sicht der Gesetzgeber
- Sicht der Anbieter
- Sicht der Nachfrager: Kundenerwartungen/Erfolgsfaktoren
- Auditive Medien
- Radio
- Jugendradio
- Musik-Streaming-Dienste
- Radio vs. Musik-Streaming
- Vergleich ausgewählter Marken
- Name
- Radio
- Musik-Streaming-Dienste
- Logo, Typografie, Farbe
- Radioprogramme
- Musik-Streaming-Dienste
- Slogan/Claim
- Radio
- Musik-Streaming
- Sound Design
- Radio
- Musik-Streaming
- Online- und mobile Auftritte
- Website
- Musik-Streaming
- Player
- App
- Social Media
- Marketingaktionen
- Erlebnismarketing
- Gewinnspiele
- Plakate
- Sonstiges
- Umfrage/Auswertung
- Vorgehensweise
- Auswertung und Interpretation
- Konsumverhalten von Musik
- Erwartungen an eine auditive Medienmarke
- Resümee und Ausblick
- Handlungsempfehlung für Radiosender am Beispiel von planet radio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Markenpolitik im Bereich auditiver Medien, insbesondere im Kontext von Radio und Musik-Streaming-Diensten. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der Markenführung in dieser dynamischen Medienlandschaft zu untersuchen und die Bedeutung von Markenpolitik im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu beleuchten.
- Entwicklung und Bedeutung von Marken im digitalen Zeitalter
- Vergleichende Analyse der Markenpolitik von Radio und Musik-Streaming-Diensten
- Identifizierung von Erfolgsfaktoren für die Markenführung in auditiven Medien
- Analyse des Konsumverhaltens und der Erwartungen der Nutzer von auditiven Medien
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Markenführung im Bereich auditiver Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Bachelorarbeit. Kapitel 2 behandelt den Begriff der Marke aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich der Sicht der Gesetzgeber, der Anbieter und der Nachfrager. Kapitel 3 widmet sich auditiven Medien, insbesondere Radio und Musik-Streaming-Diensten, und analysiert deren Entwicklung und Bedeutung im digitalen Zeitalter. Kapitel 4 vergleicht ausgewählte Marken aus dem Bereich Radio und Musik-Streaming anhand verschiedener Markenelemente, wie Name, Logo, Slogan, Sound Design und Online-Auftritt. Kapitel 5 präsentiert eine Umfrage, die das Konsumverhalten von Musik und die Erwartungen an eine auditive Medienmarke untersucht. Schließlich fasst das Resümee die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Kapitel 7 enthält Handlungsempfehlungen für Radiosender am Beispiel von planet radio.
Schlüsselwörter
Markenpolitik, auditive Medien, Radio, Musik-Streaming, Markenführung, Konsumverhalten, Kundenerwartungen, digitale Medien, Wettbewerb, Markenelemente, Online-Marketing, Social Media.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Markenpolitik für Radiosender heute wichtiger denn je?
Durch das Internet und technische Entwicklungen hat das Radio seine Monopolstellung verloren. Ein starkes Markenprofil hilft Sendern, sich in einem internationalen Wettbewerbsumfeld abzuheben.
Welche Medienformate werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht klassische Radiosender (insbesondere Jugendradio) mit modernen Musik-Streaming-Portalen hinsichtlich ihrer Markenstrategien.
Was sind die zentralen Elemente einer auditiven Medienmarke?
Zu den untersuchten Elementen gehören der Name, das Logo, Slogans (Claims), das Sound Design sowie der Online- und mobile Auftritt via App und Social Media.
Welche Rolle spielt das Sound Design in der Markenführung?
Sound Design dient als akustisches Wiedererkennungsmerkmal, das die Markenidentität emotional verankert und die Marke auch ohne visuelle Reize identifizierbar macht.
Welche Marketingaktionen werden für Radiosender analysiert?
Die Analyse umfasst Erlebnismarketing, Gewinnspiele, Plakatwerbung und die Nutzung von Social Media zur Steigerung der Hörerbindung.
Gibt es konkrete Handlungsempfehlungen in der Arbeit?
Ja, die Arbeit enthält spezifische Handlungsempfehlungen für Radiosender zur Optimierung ihrer Markenführung, beispielhaft dargestellt am Sender „planet radio“.
- Arbeit zitieren
- Laura Fietz (Autor:in), 2014, Die Bedeutung von Markenpolitik im Bereich auditive Medien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282870