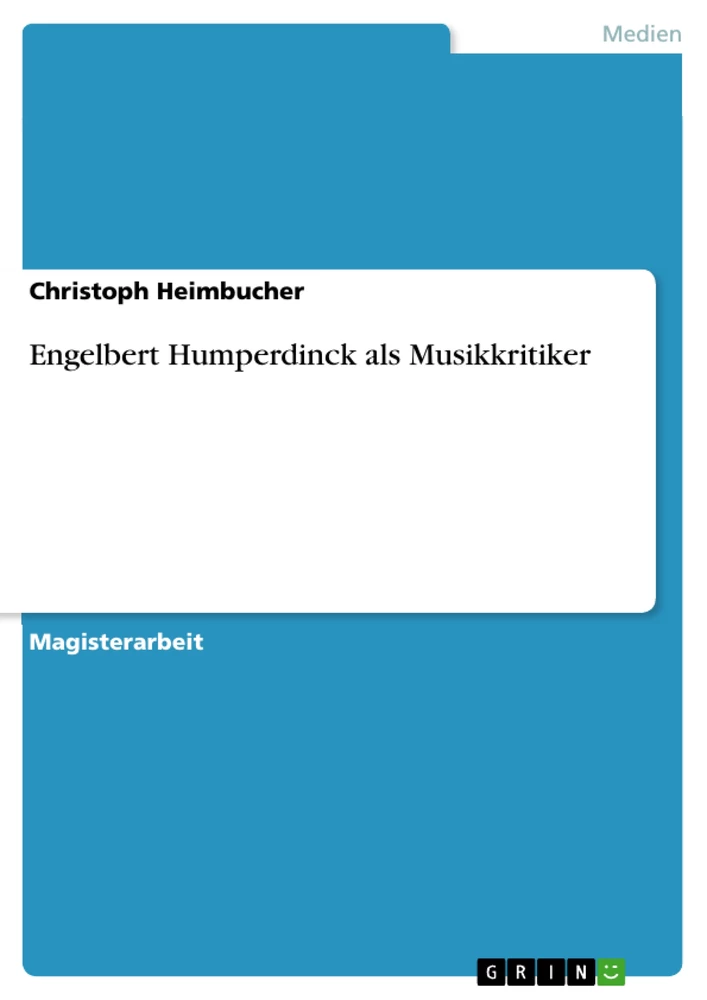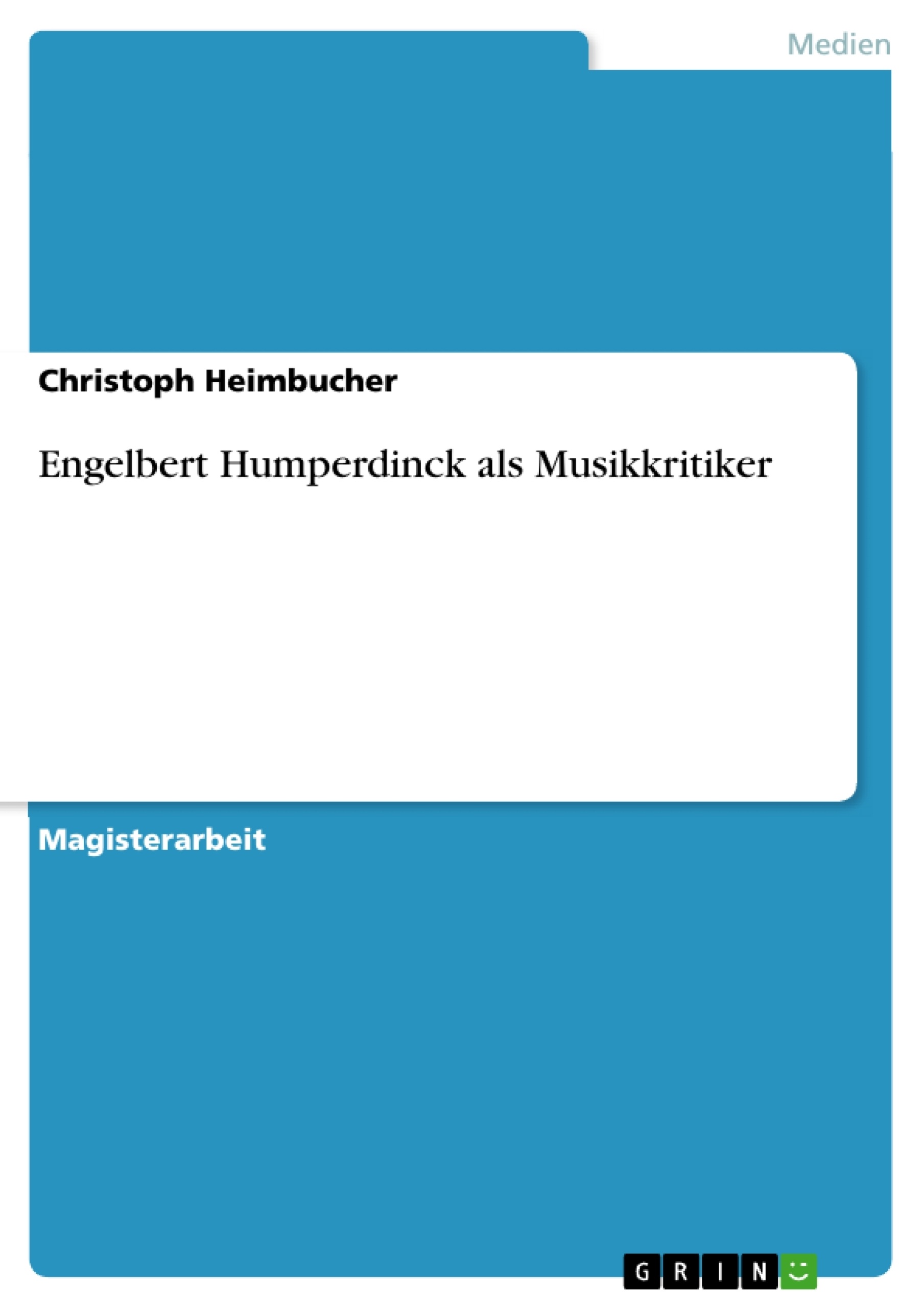Die vorliegende Arbeit hat versucht, auf ein wichtiges Element der Biographie und Persönlichkeit Engelbert Humperdincks, seine Tätigkeit als Musikrezensent, hinzuweisen.
Bei der Betrachtung und Auswertung eines Großteils der von ihm verfaßten Kritiken und Artikel wurden wesentliche Merkmale der Humperdinckschen Musikanschauung deutlich.
Hierbei lag ein besonderes Augenmerk auf der Frage nach dem Einfluß, den Richard Wagner sicher in vielem unbestreitbar auf Humperdinck ausgeübt hatte. Es ergab sich, daß gerade die Wagner-Rezensionen diesbezüglich am deutlichsten "wagnersche Prägung" erkennen ließen. Hier verstand sich Humperdinck als Verfechter der wagnerschen Ideen und Ideale. Nicht mit kopfloser Besessenheit, aber mit engagierter Beharrlichkeit setzte er sich für eine - in seinen Augen - angemessene Wiedergabe der Werke Wagners ein. [...]
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Abkürzungsverzeichnis
1. Die Geschichte der deutschsprachigen Musikkritik bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts
2. Das Kritikeramt Engelbert Humperdincks an der Frankfurter Zeitung
3. Die Frankfurter Oper
4. Die Rezensionen
4.1. Das 18. Jahrhundert
4.1.1. Gluck
4.1.2. Mozart
4.1.3. Cherubim
4.2. Die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts
4.2.1. Frz. Oper
4.2.1.1. Boieldieu und Auber
4.2.1.2. Meyerbeer
4.2.1.2.1. Meyerbeer als Komponist "seiner Zeit"
4.2.1.2.2. Meyerbeers "Eklektizismus"
4.2.1.2.3. "Wirkung ohne Ursache"
4.2.1.3. Berlioz
4.2.2. Ital. Oper: Rossini
4.2.3. Dt. Oper: Marschner
4.3. Richard Wagner
4.3.1. Exkurs: Engelbert Humperdinck und Richard Wagner; Biographisches
4.3.2. Vokabular und Sprachstil der Wagner-Rezensionen
4.3.3. Gesamtkunstwerk und Wagners Konzeption des musikalischen 64 Dramas
4.3.4. Zur Entwicklung Richard Wagners
4.3.5. Bayreuth
4.3.5.1. Cosima Wagner und die Bayreuther Festspiele 1892, 83 1894 und
4.3.5.2. Das verdeckte Orchester
4.3.6. Humperdinck - ein orthodoxer Wagnerianer?
4.4. Die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
4.4.1. Frz. Oper: Gounod
4.4.2. Ital. Oper: Verdi
4.4.3. Dt. Oper: Cornelius
4.5. Zeitgenössische Oper
4.5.1. Ital. Oper / Verismo
4.5.1.1. Mascagni
4.5.1.2. Leoncavallo
4.5.1.3. Spinelli
4.5.2. Dt. Oper
4.5.2.1. Kienzl
4.5.2.2. Weingartner
4.5.2.3. Richard Strauss
4.5.2.4. Schillings
4.5.2.5. Pfitzner
5. Engelbert Humperdinck als Musikkritiker - eine Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
6.1. Schriften von Engelbert Humperdinck
6.2. Sonstige Quellen
6.3. Sekundärliteratur
7. Anhang: Veröffentlichungsdaten der Rezensionen
7.1. Anhang I
7.2. Anhang II
Einleitung
Werk und Persönlichkeit Engelbert Humperdincks sind in ihrer Vielseitigkeit in weiten Teilen unbekannt. Hierzu trug nicht zuletzt eine Entwicklung bei, die schon zu Lebzeiten Humperdincks ihren Anfang nahm, um sich nach seinem Tode im September 1921 umso mehr zu verstärken: Der erfolgreiche Komponist, Dirigent, Musikschriftsteller, Kritiker und Hochschullehrer Humperdinck wurde mehr und mehr reduziert auf "den Hänsel und Gretel-Komponisten" (Wolfram Humperdinck 1966), bei dessen Werk die vermeintlich übermächtige Dominanz des Wagner-Einflusses die Vernachlässigung zu rechtfertigen schien.
Erst in neuerer Zeit ist in der musikwissenschaftlichen Literatur eine gegenläufige Tendenz zu verzeichnen, die Humperdinck wieder als eigenständige Persönlichkeit mit breitem künstlerischen Spektrum zu erfassen sucht, um hierbei auch die Impulse zu würdigen, die von seinem kompositorischen Schaffen - hier wäre z.B. die erste Fassung der Königskinder zu erwähnen - ausgingen. Humperdincks Einfluß auf einen Teil der jüngeren Komponistengeneration aus der Zeit um die Jahrhundertwende, ja selbst auf Arnold Schönberg ist mittlerweile unumstritten.
Das musikschriftstellerische Wirken Humperdincks ist jedoch bis heute weitgehend unberücksichtigt geblieben. Die Biographien (Besch 1914; W. Humperdinck 1965; Irmen 1975) geben hierzu einige allgemeine Hinweise und erst in allerjüngster Zeit entstanden zwei kurze Aufsätze ( Calm 1993; Cahn 1994), deren letzterer im Verlaufe der vorliegenden Arbeit erschien und unter gleichem Titel einen Überblick gebenden Abriß des Themas lieferte.
Über fünfzehn Jahre war Engelbert Humperdinck in Köln, Bonn, Mainz und Frankfurt als Musikkritiker tätig, davon beinahe 10 Jahre in fester Anstellung. Oftmals nahm dabei im Laufe dieser Zeit die Kritikertätigkeit breiteren Raum in seinem Leben ein als das musikalische Schaffen. Die Betrachtung der, wie sich zeigen wird, mit großer Gewissenhaftigkeit verfaßten Rezensionen eröffnet somit die Möglichkeit, einen Beitrag zur Biographie, Persönlichkeit und besonders zur Musikanschauung Engelbert Humperdincks zu liefern.
Über diesen Aspekt der Humperdinckschen Rezeption hinausgehend bemüht sich die vorliegende Arbeit weiterhin, die Humperdincksche Sicht musikalischer Phänomene im Vergleich mit zeitgenössischen oder zeitlich naheliegenden Rezensionen zu betrachten, um gleichzeitig ein Bild der Musikrezeption um die Jahrhundertwende zu bieten.
Aufgrund des umfangreichen Quellenmaterials war eine Beschränkung auf die Opernrezensionen Humperdincks aus seiner siebenjährigen Zeit als Kritiker der Frankfurter Zeitung notwendig. Auch hierbei konnten nicht sämtliche, in den Rezensionen erwähnten Komponisten und Werke behandelt werden, so daß nach Maßgabe von Umfang und Häufigkeit der Rezensionen zu einem Thema eine Auswahl getroffen werden mußte. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Humperdinck grundsätzlich jedes Werk rezensierte, das aufgeführt wurde. Die Prioritäten, die die vorliegende Arbeit zu setzen hatte, entsprechen also letztlich den Gewichtungen des Frankfurter Opern-Spielplans.
In einem einleitenden Kapitel versucht die Arbeit, die Grundzüge der Geschichte der Musikkritik bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts nachzuzeichnen, um die Einordnung der Kritiken Humperdincks in den musik-literarhistorischen Kontext zu ermöglichen.
Die folgenden Kapitel zum Kritikeramt an der Frankfurter Zeitung und zur Frankfurter Oper verstehen sich als notwendige Hintergrundinformation für den die Rezensionen behandelnden Hauptteil der Arbeit.
Der zweiteilige Anhang soll als Dokumentation erstmalig den Zugang zu den Rezensionen Humperdincks aus der Frankfurter Zeitung ermöglichen.
Die Sichtung des gesamten Quellenmaterials wurde ermöglicht durch die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn und der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt/Main. Wertvolle Hinweise gab Frau Dr. Eva Humperdinck.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Werktitel werden den Rezensionen Humperdincks entsprechend meist in ihrer deutschen Übersetzung zitiert.
1. Die Geschichte der deutschsprachigen Musikkritik bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts
Der Musikkritiker in seiner Funktion als vermittelnde Instanz zwischen Künstler und Publikum ist eine Erscheinung des Zeitalters der Aufklärung. Gleichzeitig mit der Entwicklung eines öffentlichen, vom Bürgertum getragenen Konzertlebens, welches in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhundert vorerst in England, dann aber bald auch in Frankreich und Deutschland[1] aus dem Rahmen der privaten bzw. halbprivaten Veranstaltungen heraustrat, stieg der Bedarf des nun vermehrt am Musikleben anteilnehmenden Konzertpublikums nach Klärung verschiedenster musikpraktischer, musiktheoretischer und musikästhetischer Fragestellungen.
Es erscheint kennzeichnend für die Bestrebungen der Zèit, daß sich gerade auf kulturellem und nicht etwa auf politischem Gebiet die Anfänge des Journalismus manifestieren.
War musikalische Kritik im etymologisch vom griechischen κρίνω (sichten, unterscheiden, auswählen, urteilen, auslegen) hergeleiteten Sinneschön vor dem 18. Jahrhundert als Reflexion über musikalische Phänomene bei Konfuzius, Pythagoras, Aristoxenes, Augustinus, Boethius und später bei Tinctoris, Glarean, Präto- rius, Morley u.a. in Erscheinung getreten, so findet die eigentliche Musikkritik als eine "periodische Berichterstattung über musikalische Gegenstände"[2] [3] ihren Anfang in Johann Matthesons Critica Musica[3] von 1722.
Mattheson (1681-1764), der sich in seinem "Vortrab" ausdrücklich auf die seit 1682 in Leipzig erscheinenden Acta eruditorum, die erste Gelehrten-Zeitung Deutschlands (bis 1782), bezieht, hielt es für ratsamer, seine Schrift in mehreren Lieferungen, bis 1725 waren es 24, erscheinen zu lassen, da "gar selten ein ganzes Buch; leicht aber ein paar monathliche Bogen / aus / und recht zu Ende gelesen werden. "[4]
Neben der Übersetzung, Zusammenfassung und Kommentierung fremder musikliterarischer Schriften finden sich in der Crìtica Musica Kompositionskritiken, so z.B. die Besprechungen von G.F. Händels Johannespassion oder J.S. Bachs Kantate Ich hatte viel Bekümmernis, die ein frühes Beispiel eingehender analytischer Werkkritik darstellen.
Als musikalischer Fachmann und umfassend gebildeter Künstler formulierte Mat- theson das satztechnische Wissen seines Jahrhunderts. So war für die Qualität eines Werkes vorrangig die satztechnische Richtigkeit bestimmend, doch wandte sich Mattheson gegen eine Überbewertung mathematischer Verhältnisse als Grundlage der Musik. Sie erstrebe vielmehr die "Erregung des empfindlichsten Wohlgefallens"*.
Diese Überzeugung und ihre Verfechtung stellte er, neben den im 18. Jahrhundert maßgeblichen Problemen - dem stetigen Vergleich zwischen italienischer oder deutscher Musik, der Frage nach dem Wesen der wahren Kirchenmusik und der Unterscheidung der Musik in eine Verstandes-, Sinnen- oder Gefühlskunst[5] [6] - in den Vordergrund seiner publizistischen Arbeit.
Wie schon der Titel deutlich macht, knüpfte Johann Adolph Scheibe (ca. 17081776) mit seinem Critischen Musicus (1737-1740) an Matthesons Schrift an. In seiner trotz aller Polemik durchaus differenzierten Ablehnung der Kompositionen J. S. Bachs, verbunden mit der Förderung der Bach-Söhne und dem Streben nach Vereinfachung in der Musik, eröffnet er die erste große Kontroverse zwischen Kritiker und kritisiertem Künstler in der Geschichte der Musikperiodica.[7]
Scheibes Kritiken fanden in der Nachahmungstheorie der französischen Aufklärung und der Leibnizschen Philosophie ihre Grundlage. Wie bereits Mattheson vertrat er in der Mitte des 18. Jahrhundert die These, Kunst müsse die Natur nachbilden. Dabei ging es ihm nicht allein um eine rein mechanische künstlerische Nachahmung. Er propagierte vielmehr die Vernunft, den Scharfsinn als diejenige Instanz, an der die Wahrheit des nachahmenden Ausdruckes gemessen werden müsse.
Dem gesteigerten Interesse nach kritisch-belehrenden Musikzeitschriften kamen auch die Veröffentlichungen von Lorenz Mizler (1711-1778) und Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795) entgegen. Mizler, der bereits ein Jahr vor Scheibes
Crìtischen Musicus seine Neu eröffnete Musicalische Bibliothek (1736-1754) herausgegeben hatte, orientierte sich ebenso wie dieser am Vorbild Matthesons, verstand jedoch im Gegensatz zu diesem Musik vorwiegend als Teilgebiet der Mathematik. Diese Auffassung vertrat er auch in seinem allerdings nur für sieben Monate erscheinenden Musicalischen Staarstecher (1739).
Obwohl die Musikkritik seiner Zeit noch stark an den überlieferten Kompositionsregeln als einem auch für neue Kompositionen objektiven Wertekriterium festhielt, zeichnete sich bei Mizler und später auch in Marpurgs Kritischem Musicus an der Spree (1749/50), in den Historisch-kritischen Bey trägen zur Aufnahme der Musik (1754-1762; 1778) und den Kritischen Briefen über die Tonkunst (1759-1763) eine Entwicklung ab, die, Abstand nehmend von der rein theoretisch bestimmten Kompositionsanalyse, zu einer neuen kritischen Betrachtung führte: Die von England und Frankreich auf Deutschland übergreifenden Auswirkungen einer neuen Empfindsamkeit beeinflußten die kritische Haltung gegenüber dem Kunstwerk. Ausgangspunkt für die musikalische Kritik wurde nun mehr und mehr das Erlebnis des aufgeführten Werkes. So rückte der Bericht von örtlichen Musikveranstaltungen, die um die Mitte des 18. Jahrhundert einen regelmäßigen Platz im Musikleben, etwa in Hamburg oder Leipzig, einnahmen, immer deutlicher in den Blickpunkt.
Als eine erste Konsequenz dieser Entwicklung sind die in den Jahren 1766-1770 erschienenen Wöchentlichen Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend von Johann Adam Hiller (1728-1804) zu nennen, die er anonym herausgab und die sich als erstes wöchentliches Periodicum mit einer Gleichstellung von Aufführungskritik[8] - erstmalig auch von Opernaufführungen - und Kompositionskritik bewußt und direkt an den musikalisch interessierten Laien wandten.[9]
Ebenso wie für Marpurg wurde auch für Hiller Musik durch den Ausdruck von Empfindungen gekennzeichnet. So kam es in dieser Phase der Musikkritik, die - u.a. bedingt durch die stärkere Bewertung des Erlebens von Musik - das Gefühl und damit den individuellen Geschmack in den Vordergrund stellte, zu Irritationen, die sich vor allem an solchen Werken manifestierten, welche
"mit ihrer aus der Sicht des Spätbarock gewollten Abweichung von den Regeln (...) das alte Formenwesen als überholt [beiseiteschoben, d.h.] (...) satztechnisch falsch und trotzdem (die Anhänger des neuen Systems würden hier gerade deshalb sagen!) voll sprühender Musikalität sein"[10] konnten.
Konsequenz dieser Irritationen war vor dem Hintergrund der Kantschen Kritik der Urteilskraft von 1790 eine nahezu "erdrutschartige Werteverschiebung"[11], in deren Folge von den Kantianern, so z.B. bei dem mit Kant befreundeten Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) im Musikalischen Kunstmagazin (1782/1791), jedwede die Kunst betreffenden Bewertungsmaßstäbe mit Verbindlichkeitscharakter negiert wurden. Ausschlaggebend blieb nun allein der individuelle Geschmack der fundiert musikalisch gebildeten Kritikerpersönlichkeit.
War bisher das Entstehen der Musikzeitschriften durch das Vorbild der Gelehrtenzeitschriften universalwissenschaftlichen Gharakters mit Blick auf eine Beförderung der musikalischen Wissenschaft durch Rezensionen älterer und neuerer Literatur geprägt gewesen, so rückt nun - schon vorbereitet durch Hillers Wöchentliche Nachrichten - der Gedanke an die Möglichkeit einer "veredelnden Wirkung"[12] von Musik auf die breite Masse des Publikums immer mehr in den Vordergrund. Musikkritik verstand sich nunmehr weniger als eine philologische, in ihrer Methodik gewollt objektive, mehr oder minder unter Kennern geführte Diskussion kompositorischer Techniken, sondern sah ihre Aufgabe zunehmend in der Wahrnehmung ihrer Vermittlerstellung zwischen schaffendem Künstler und breitem, sich nach den Ereignissen in Frankreich von 1789 durch neue Hörerschichten noch vergrößernden Publikum bezüglich eines vom Handwerklich-Technischen abgehobenen, persönlich zu erlebenden musikalisch-künstlerischen Gehalts von Musik.
Vor diesem Hintergrund wurde bei Reichardt die Forderung nach einer Öffnung des Musiklebens auf ganzer Breite laut. Er kämpfte für die Einrichtung öffentlicher Singschulen, neuer Theater- und Konzertgebäude und setzte sich für "echte" Volkslieder und "guten" Kirchengesang[13] ein. Ähnliche Bestrebungen fanden sich auch in der Musikalisch-kritischen Bibliothek (1778/79) von Johann Nicolaus Forkel (1749-1818), der als erster Musikhistoriker musikalische Werke der Gegenwart vor dem Hintergrund der Musikgeschichte besprach, daneben Organisationskritik zu einem entscheidenden Bestandteil seiner Besprechungen machte.
Die zunehmende Orientierung der Musikperiodika kritischen Charakters auf den musikliebenden Dilletanten hin hatte eine Reihe von weiteren Zeitschriftengründungen zur Folge, die jedoch weitgehend rasch wieder aus dem Blickfeld verschwanden.
Erst die in Leipzig erscheinende Allgemeine musikalische Zeitung (1798-1848, danach mehrfaches Wiederaufleben) mit ihrem ersten Herausgeber Friedrich Rochlitz (1769-1842) konnte im zeitgenössischen Musikleben wieder eine bedeutende Stellung einnehmen, mit der sie den Höhepunkt in der Musikpublizistik des 18. Jahrhundert markierte. Als erste Allgemeine musikalische Zeitung, die im Gegensatz zu Reichardt nicht auf eine einzige Stadt begrenzt blieb, sondern im "Zentrum des Nachrichtenkreuzes Berlin - St.Petersburg - Berlin - Wien"[14] ein breites Korrespondentennetz aufgebaut hatte und erstmalig einen großen Stab von zeitweise bis zu 130 Mitarbeitern beschäftigte, eröffnete die AmZ die zweite Epoche der musikalischen Kritik, die nach der philologisch objektiven Kritik des 18. Jahrhundert und einem Übergang in der "Geschmackskritik"[15] (Reichardt) für das anbrechende 19. Jahrhundert eine neue kritische Methode begründete.
Diese neue kritische Methode, um die es in den ersten Jahrgängen der AmZ ging und der sich die Rezensenten mit mehr oder minder großer Überzeugung anschlossen, war von einem psychologisierenden Vorgehen[16] des Kritikers geprägt. Seine Aufgabe sollte nun darin bestehen, das Werk des schaffenden Künstlers nachzuempfinden, "den Vorstellungen des Komponisten nachzugehen und dann (...) Übereinstimmungen und Nichtübereinstimmungen dieser Vorstellungen in der Realität der Erscheinung des Kunstwerkes festzustellen und zu begründen"[17].
Nun half bei der Bewertung eines Werkes nicht mehr der objektive Regelkanon, es galt vielmehr in den Rezensionen jetzt vorrangig die "geistigen Regeln" zu erkennen, die sich der Komponist selbst auferlegt hatte. Am Beispiel der Kritiken E. Th. A. Hoffmanns (1776-1822) zu den Werken Mozarts, Glucks und Beethovens wird jedoch schnell deutlich, worin die Schwierigkeiten dieser psychologisierenden, am Vorbild der poetischen Kritik Jean Pauls geschulten Methode der Besprechung künstlerischer Werke lag:
"Dort, wo sprachgewaltige Dichter (...) ihren subjektiven Empfindungen über Jahrhundertgenies (...) freien Lauf ließen, entstanden Rezensionen, die selbst wieder Literaturgeschichte machten"[18]
Diese Rezensenten suchten und fanden zumeist in dem zu rezensierenden Werk den Anstoß für ein eigenes kreatives Schaffen.
Kennzeichnend für die Kritiken dieser Periode ist die Auffassung, die Rochlitz über die Aufgabe einer Musikkritik äußert:
"Wahre Kritik hält sich mehr bey den Vortrefflichkeiten, als bey etwannigen kleinen Unvollkommenheiten auf; sucht die verborgenem Schönheiten der Werke aufzufinden, und stellt der Welt Dinge zur Betrachtung auf, welche auch wirklich betrachtenswerth sind."[19]
So fanden oftmals allein die Werke eine Besprechung, die den Kritiker zu begeistern vermochten, diejenigen aber, die aus ihrer Wirkung heraus nicht den Anklang eines Rezensenten fanden, wurden häufig nicht berücksichtigt.
Eine weitere Diskrepanz ist für diese Phase der musikalischen Kritik kennzeichnend. Auf der einen Seite kam es zu einer sprachlichen Darlegung eines romantischen Musikerlebnisses, welche "ohne Scham vor persönlicher Ergriffenheit das Kunstwerk als Gebilde aus höherer Welt"[20] betrachtete und verherrlichte, auf der anderen Seite steigerte sich aber gerade dadurch das Bedürfnis der musikalischen Laien ohne ausgeprägte künstlerische Bildung, ebenso wie der Fachmann den Empfindungen und Gefühlen literarischen Ausdruck zu verleihen. Vor diesem Hintergrund konnte von Jahr zu Jahr ein "ernsthaft auftretendes subkulturelles Konzertleben"[21] Raum greifen, welches auf die begeisterte Zustimmung bei einem Großteil der Dilletanten, jedoch auf überwiegende Ablehnung aus den Reihen der Fachleute stieß.
An diesem Punkt manifestierte sich die erste Krise der psychologisierenden Musikkritik. Dadurch, daß satztechnische Normen kein kritisches Regulativ mehr darstellten, daß allein die Frage des "öffentlichen" Geschmacks über die Popularität eines Kunstwerkes zu entscheiden und damit Beweiskraft über dessen Qualität zu erhalten schien, sowie durch das in fachlicher Minderkenntnis der kritisierenden Dilletanten begründete Unvermögen, den Vorstellungen des Komponisten nachzugehen, und somit also durch den Rückschritt in eine reine Geschmackskritik mit den Kategorien "schön" und "nicht schön", war die grundlegende Frage nach der prinzipiellen Möglichkeit von Wertunterschieden erneut offen.
So stellten sich der AmZ, die nach dem Ausscheiden von Rochlitz im Jahre 1818 unter seinen Nachfolgern Gottfried Härtel (1763-1827), Gottfried Wilhelm Fink (1783-1846), Carl Ferdinand Becker (1804-1877), Moritz Hauptmann (1792-1868) und Johann Christian Lobe (1797-1881) nicht mehr das alte geistige Niveau und internationale Ansehen erreichen konnte, zu der sie Rochlitz geführt hatte, 1824 zwei Neugründungen entgegen, die für ihre Rezensionen die eingehende Begründung des jeweiligen Kritikers forderten. Es sollte nun nicht mehr ausreichen, die persönliche Meinung in Form einer Besprechung zu veröffentlichen, sondern es wurde weitergehend gefordert, auch den Standpunkt darzulegen, von welchem aus der Kritiker diese Meinung gefaßt hatte.
Gerade in der Offenlegung dieses persönlichen Standpunktes[22], der stets als ein rein subjektiver Ausgangspunkt für die Wertebestimmung zu erkennen war und sich dadurch eben auch entscheidend vom Standpunkt anderer Fachleute unterscheiden konnte, lag eine Relativierung der subjektiv psychologisierenden Meinungskritik, die bald wiederum nach neuen kritischen Methoden verlangte.
Während die in Mainz von Gottfried Weber (1779-1839) herausgegebene Zeitschrift Caecilia (1779-1839) nur solche mehrseitigen, ausführlichen Aufsätze oder kurze von Fachleuten geschriebene bzw. sich auf einen solchen berufende Rezensionen druckte, um sich bald gänzlich aus dem Gebiet der aktuellen Tageskritik zurückzuziehen und nur noch musikwissenschaftlich zu agieren, ließ die Berliner allgemeine musikalische Zeitung (1824-1830) von Adolf Bernhard Marx (1799-1866) allein professionelle Kritiker zu. Hiermit versuchte man einen Anspruch auf tendenzielle Richtigkeit der Besprechungen zu begründen. Da jedoch gerade A. B. Marx zu einem musikalischen Gegenstand oftmals mehrere Kritiker mit in diesem Sinne "richtigen" Urteilen zu Wort kommen ließ, die sich jedoch voneinander grundsätzlich unterschieden bzw. gegenseitig ausschlossen, war die Verwirrung, die von dieser Form des musikalischen Journalismus ausging, groß.
Die ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts waren sowohl in den Fachzeitschriften als auch in den universalen Musikzeitschriften weitgehend geprägt durch den Willen, dem sich stetig aus weitenden und in ausgeprägter Subkultur ausufernden Konzertleben pädagogisch entgegenzutreten.[23] Geschmacksbildung und -Verbesserung sollten wieder einen breiteren Raum im musikkritischen Wirken der Zeitschriften einnehmen.
Unter diesen Voraussetzungen gründete Robert Schumann 1834 im Verein mit Friedrich Wieck (1785-1873), Ludwig Schunke (1810-1834) und Julius Knorr (1807-1861) die Neue Zeitschrift für Musik (1834-1943; 1950-heute). Sie war programmatisch als Gegenmodell zur AmZ konzipiert und stellte gleich zu Anfang den "schlechten Geschmack der Gegenwart"[24] bloß.
"Die Zeit der unnützen Complimente sei vorbei, formulierte er [Schumann]. Salonkomponisten, neuneapolitanische Opernkomponisten, der ganze Bereich des 'hohlen' Pathos eines Meyerbeer und der Pariser ’Großen Oper' waren im Visier, aber mit ihnen, und das war das Neue daran, auch das Publikum, das sich an solchen Sachen ergötzte. "[25]
Mit Schumann erreichte die psychologisierende Kritik ihren Höhepunkt.[26] Für ihn war das Kunstwerk unmittelbar mit dem schaffenden Künstler verbunden. Besprechungen von Werken eines Künstlers ohne den Blick auf diesen und sein Inneres verurteilte er als eine rein oberflächliche Wahrnehmung. Adäquate Kritik eines Werkes bedeutete für ihn gleichzeitig auch Kritik der künstlerischen Gesinnung seines Verfassers[27], eine Einstellung, die bereits Rochlitz vertrat. Bloße Empfindungen als Reflex auf ein gehörtes Werk, ohne eine Prüfung ihrer Qualität hielt er für kritikuntauglich. Unabhängig von Empfindungen und Geschmack durfte die künstlerische Wertigkeit nicht vernachlässigt werden, zu deren Feststellung allein der Fachmann befähigt sein sollte.
Für Schumann war dabei die entscheidende Kategorie im Prozeß des Herantretens an ein Kunstwerk die Frage nach seinem poetischen Gehalt.[28]
Mit dem an der Kunsttheorie Jean Pauls und Friedrich Schlegels geprägten Begriff des Poetischen und dessen Anwendung auf die musikalische Ästhetik verband sich nicht die Ausrichtung zum literarischen Programm. Vielmehr bezeichnete der in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts existierende Doppelbegriff Poesie neben der Dichtung als einer Kunstform wie Musik oder Malerei, das allen Kunstformen gemeinsame Wesen der Kunst. Dieses Wesen, d.h. das Poetische der Kunst zu erkennen, ein musikalisches Werk also als poetisch oder im Gegensatz dazu prosaisch zu beurteilen, stellte nun die Hauptaufgabe der Kritik nach Schumannschem Verständnis dar. Der Kritiker bemühte sich, die durch das Kunstwerk ausgelöste Stimmung poetisch zu paraphrasieren, was bei einem "prosaischen" Werk, da es keinen Ausgangspunkt zur poetischen Paraphrase, zum Poetisieren als "subjektivem Reflex des poetischen Gehaltes der Musik"[29] bot, beinahe unmöglich war und daher oftmals in der NZfM keinen Platz fand.
Diese Form der poetisierenden Kritik, wie sie sich auch in den Hoffmannschen Kritiken für die AmZ zeigte, ging einher mit einem Mißtrauen der Neuromantiker gegen eine technische Analyse. Schumann selbst vertrat den Standpunkt, daß das ganze "Mechanische" gerade dann am besten seinen Zweck erfüllte, wenn es völlig verborgen und unauffällig blieb.[30] Die Skepsis gegen diese nach der ersten vom Eindruck bestimmten Empfindung eintretende zweite Stufe der Reflexion begründete sich in der Annahme, daß der Pragmatismus der analysierenden Reflexion die "humanere" erste Regung in der sinnlichen Aufnahme eines Kunstwerkes zunichte mache.
Da aber die Feststellung von "gut" und "schlecht" bzw. "falsch" und "richtig", auf die nicht verzichtet werden konnte, auch bei den musikalischen Fachleuten nun dennoch von geschmacklichen Imponderabilien und darüberhinaus von ihrer Fähigkeit, sich bei "richtiger" Empfindung adäquat dichterisch auszudrücken, oder einfach von ihrer vielleicht fehlenden Sensitivität für Stimmungen bei großer Sprach- gewalt abhängig war, fanden Begriffe wie "edel, aufrichtig, echt, wahr" oder "seicht, geschmacklos, verlogen, hohl" Eingang in das Vokabular der Kritik, mit denen man, wie das Beispiel Fink in der AmZ zeigt, auch einigen Schaden anrichten konnte.[31]
Gleichzeitig mit diesen Entwicklungen griff eine Form der Kritik Raum, die ihren Platz allein in den Tageszeitungen finden konnte: der musikalische Feuilletonismus.
Als Mitarbeiter sowohl der Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung als auch der Caecilia war Ludwig Rellstab (1799-1866) einer der bedeutendsten Musikkriti- ker seiner Zeit. Sein Vater Johann Carl Friedrich Rellstab (1759-1813) war als Rezensent der Königlich berlinischen priviligierten Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, der sogenannten "Vossischen Zeitung" (1785-1934), und später bei den Berliner Abendblättern (1810-1811) der erste Kritiker, der für eine Tageszeitung schrieb. Ludwig Rellstab setzte diese Tradition fort. Neben den Rezensionen für die Berliner allgemeine musikalische Zeitung und die Caecilia schrieb er u.a. Beiträge für die Vossische und gab eine eigene Zeitschrift heraus, die Iris im Gebiete der Tonkunst (1830-1841). Die Anforderungen der Tageszeitung nach Aktualität und ausgeprägter Allgemeinverständlichkeit mit Blick auf ein breites, musikalisch mindergebildetes Publikum ließen Rellstab einen durch witzige, gefällige und geistvolle Formulierungen geprägten Stil schreiben, der gegenüber der Fachkritik rein musikalischer Zeitschriften oftmals feuilletonistischen Charakter annahm. Später wurde dieser Stil durch Heinrich Heine, der 1836-1847 als Musikkritiker in Paris tätig war und hauptsächlich für die Augsburger Allgemeine Zeitung (18101882) schrieb, sowie durch Richard Wagner, so z.B. in seinen Pariser Briefen für die Dresdner Abendzeitung (1798-1929), aber auch durch Berlioz, Börne (17861837) und Bülow (1830-1894) wieder aufgegriffen.
Zum Rang einer eigenen Kunstgattung verhalf Eduard Hanslick (1825-1904) dem musikalischen Feuilletonismus. Seine Rezensionen waren "Meisterwerke der Bildungskritik, erstaunlich in der Fülle von historischen Einzelheiten und Vergleichsmaterial, anschaulich in der Formulierung, immer das Positive gegen das Negative vorsichtig abwägend."[32]
Anfänglich der Musik Wagners noch positiv gegenüberstehend, war sein Weg bis zur Position als erster Kritiker der Neuen Freien Presse (1864-1939) eine immer entschiedenere, in der konsequenten Anwendung des von ihm vertretenen Prinzip einer Autonomie der Musik[33] begründeten Abwendung von Wagner und den seit 1859 im Allgemeinen Deutschen Musikverein zusammengeschlossenen Anhängern der Neudeutschen Gruppe um Franz Liszt in Weimar. Unter dem Schumann-Nachfolger Franz Brendel (1811-1868) wurde die NZßl immer mehr zu deren publizistischen Organ und so zu einem in den 50er Jahren des Jahrhunderts die öffentliche Meinung stark bestimmenden Faktor. Bei seiner Übernahme der Redaktion versuchte Brendel die geschichtliche Entwicklung der musikalischen Kritik in einem einleitenden Artikel festzuhalten, um vor diesem Hintergrund für die Zukunft der Zeitung neue Akzente setzen zu können. Hierbei erkannte er den
"(...) namentlich durch Rochlitz begründeten und entwickelten Standpunkt der psychologischen Beschreibung, der psychologischen Analyse [als den] (...) in der Hauptsache [noch] (...) gegenwärtig herrschenden".[34]
Gleichzeitig manifestierte er jedoch, daß es der musikalischen Kritik "an einem festen und sicheren Fundament"[35] fehle. Diese Lücke wollte Brendel mit Hilfe der Wissenschaft schließen:
"Jetzt ist es die Aufgabe, sollen die großen Werke der Vergangenheit in das denkende Bewußtsein der Nation aufgenommen werden, soll die Musik der Gegenwart sich ihrer wahren Bestimmung wieder nähern, daß Alle, welche über Musik zu schreiben vermögen, dahin wirken, daß die Kluft, die die Wissenschaft, Literatur und Musik trennt, überbaut wird. Die Resultate der modernen Wissenschaft, die großen Fortschritte der Aesthetik, müssen auch der Tonkunst zu Gute kommen (...). Es muß dahin gewirkt werden, daß jede Kunsterscheinung in ihrer relativen Berechtigung erkannt wird (...).[36]
Mit der Forderung Brendels nach einer "Parteikritik" in seinem Leitartikel Zum Neuen Jahr[37] (1852) trat die musikalische Kritik in eine Phase, die sich über den Zeitraum der gesamten zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert erstreckte.
"Mehr und mehr scheiden sich jetzt zwei bestimmte Parteien, die Gegensätze des ruhigen Beharrens in dem, wie unsere musikalischen Zustände einmal sind, aber auch der Gedankenlosigkeit und Trägheit, der Indifferenz, und andrerseits des energischen Drängens nach Fortschritt. (...) Entschiedenere Parteinahme demnach ist der neue Grundsatz, welchen ich ausspreche (...). Der Rüchsichtslosigkeit der Kritik im Gegentheil gegenüberzutreten ist immer mein Wunsch gewesen. (...) Ich kann der Kritik nur dann Berechtigung zugestehen, wenn sie, zwar unerbittlich, ernst und streng, zugleich aber mit Liebe auf die Erscheinungen einzugehen sucht, und habe mich dem entsprechend stets bemüht, zuerst das Gute herauszufinden, bevor ich mich dem Verfehlten zuwandte. Die Kritik soll nicht, wie sie es häufig thut, vernichten, die Keime zertreten, sie soll fördern aufbauen. (...) Wohl aber muß die Rüchsichtsnahme endlich einmal aufhören, wenn man beharrlich, schonend und mild auf vorhandene Uebelstände aufmerksam gemacht hat, und zuletzt in Erfahrung bringt, daß Alles beim Alten bleibt. "[38]
Brendel, der selbst die Leipziger Musikwissenschaft begründete, setzte sich, wie schon in seinem oben erwähnten Artikel deutlich wurde, für eine Parteinahme bzgl. eines Werkes auf wissenschaftlich kritischer Basis ein, unabhängig von dessen Erfolg oder Mißerfolg beim Publikum. Sein Aufruf hierzu wurde jedoch bald - teilweise in extremen Ausmaßen - "als Freibrief für eine Anhänger- und Gegnerschaft ohne Distanz"[39] mißverstanden.
Als ein gegenüber der Brendelschen NZfM "unabhängiges, keinerlei persönlichen oder Partei-Interesse dienendem Blatt"[40] war die neue Folge der AmZ (1866-1869: Leipziger allgemeine musikalische Zeitung), über den gesamten Zeitraum ihres Erscheinens 1863 bis 1882 betrachtet, einer der letzten Vertreter der universalen Musikzeitschriften. Sie verstand sich als Fortsetzung der 1798 bis 1848 erschienenen ersten AmZ und, so zumindest in den Augen ihres Redakteurs Selmar Bagge (18231896), ebenso als Fortsetzung der Deutschen Musikzeitung (1860-1862).[41] Sie konnte jedoch auch unter der Redaktion von Robert Eitner (1832-1905) und Friedrich Chrysander (1826-1901) nicht wieder den Ruf erlangen, der ihr in der Rochlitz-Zeit zukam. Während unter Bagges Redaktion das Hauptgewicht der Zeitung auf das Musikschaffen der Gegenwart gelegt wurde, setzte Chrysander größere Akzente auf dem Gebiet der musikwissenschaftlichen Forschung als Fortsetzung seiner Jahrbücher für die musikalische Wissenschaft (1863/1867).
Neben den bisher erwähnten Zeitschriften erschienen im 19. Jahrhundert eine Fülle von weiteren, mehr oder weniger wichtigen Publikationen, so z.B. solche von eher regionalem Interesse, wie die für die lokalen Musikzentren Berlin, Leipzig, Wien, Brüssel, Paris oder London. Eine für Berlin wichtige Publikation wie die Berliner allgemeine musikalische Zeitung fand bereits Erwähnung, zu der sich die Berlinische musikalische Zeitung (1805-1806) und 1844 die - später durch die im Verlag Bote & Bock erscheinende Neue Berliner Musik-Zeitung (1847-1896) abgelöste - Berliner musikalische Zeitung (1844-1847), gesellten. Für Leipzig ist besonders auf die von Bartholf Senff (1815-1900) seit 1843 herausgegebenen Signale für die musikalische Welt hinzuweisen, die bis 1941 erschienen und
"(...) schnelle Nachricht von Allem, was nur irgend Interesse hat, [sowie] (...) gründliche Besprechung hervorragender musikalischer Erscheinungen, regelmäßige Kritiken der Leipziger Concerte u.s.w." versprach.[42]
Einige der von den Signalen veröffentlichten Nachrichten und Daten waren hierbei absichtlich falsch, da sie sich aus kaufmännischen Gründen bewußt an eine "oberflächliche Musikamüsiergesellschaft"[43] wandte und als Verlagszeitung oftmals allein das für gut erklärte, was im eigenen Verlag erschien.
Im Rheinland waren die Rheinische Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler (1850-1859) und die Niederrheinische Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler (1853-1867) des Kölner Kritikers Ludwig Bischoff (1794-1867) maßgebend. Erst im Jahre 1900 trat dann wieder eine Musikzeitschrift, die Rheinische Musik- und Theaterzeitung (1900-1937), an die Öffentlichkeit.
In Stuttgart erschien das Musikalische Volksblatt (1842), welches eine der wenigen musikkritischen Quellen der Zeit aus dem Stuttgarter Raum darstellt.
Die erste Wiener Musikzeitschrift ist die 1813 gegründete Wiener allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat (1817-1824), nachdem die Wiener Theater-Zeitung (1806-1808; 1811-1860) und die Zeitschrift Thalia (1810-1811) bereits gelegentlich über lokale Musikveranstaltungen berichtet hatten. Ihr folgten der Allgemeine musikalische Anzeiger (18291840), die Allgemeine Wiener Musik-Zeitung (1841-1848) und die Neue Wiener Musik-Zeitung, die von 1852 bis 1860 wöchentlich über die Hofoper und über andere musikalische Ereignisse berichtete, aber auch musikhistorische Beiträge veröffentlichte.
Seit den 40er Jahren des 19. Jahrhundert war mit dem sich stetig ausbreitenden öffentlichen Musikleben auch eine Tendenz der zunehmenden Spezialisierung auf musikalischem Gebiet zu beobachten. Ebenso nahm die Zahl der Zeitungsgründungen für spezielle musikalische Belange deutlich zu.[44]
So entstanden parallel zu den Gründungen von Gesangvereinen und Liedertafeln sowie den Veranstaltungen von großen Sängerfesten spezielle Zeitschriften für den Chorgesang. Erwähnenswert sind hier u.a. die vom Märkischen Central-Sänger- bunde herausgegebene Deutsche Männer-Gesangs-Zeitung (1860-1868), die Sängerhalle (1861-1908), das Sängerblatt aus dem Jahre 1861[45], der Anzeiger für Gesangvereine (1888-1902) oder àie Akademische Sänger-Zeitung (1895-1934)[46].
Auch die Veränderungen im kirchenmusikalischen Bereich[47] forderten Zeitschriftengründungen zum Zwecke der Verbreitung der neuen Ideen heraus. So erschie- nen z.B. die Fliegenden Blätter für Katholische Kirchenmusik (1866-1937; 1949- heute)[48], Der Kirchenchor (1871-1916), Der Chorwächter (seit 1876), das Grego- rius-Blatt (1876-1922; 1924-1937)[49], das Korrespondenzblatt des Evangelischen Kirchengesangvereins für Deutschland (1887-1920; 1925-1933)[50] u.v.a.
Einem breiten, alle Gattungen umfassenden Musikleben entsprach auch eine umfangreiche Spezialliteratur, die von der Klaviermusik (Allgemeine Pianoforte-Zeitung 1859-1863), über die Orgel- (Die Orgel 1889-1897; 1909-1914) und Kammermusik (Die Kammermusik 1897-1901) bis zur Militärmusik (Deutsche MilitärMusiker-Zeitung 1879-1944; Neue Militär-Musik-Zeitung 1894-1914, etc.) alle Bereiche des musikalischen Lebens abdeckte.
Weiterhin erschienen Zeitschriften zu pädagogischen Themen (Der Klavierlehrer 1878-1931), zu Fragen des Instrumentenbaus (Zeitschrift für Instrumentenbau 1880-1943) und zu einzelnen Komponisten (Bayreuther Blätter 1878-1938).
Auch der zunehmenden Konsolidierung der Musikwissenschaft als anerkannte wissenschaftliche Disziplin trugen einige Fachzeitschriften Rechnung - so neben den bereits erwähnten Jahrbüchern für musikalische Wissenschaft (1863/67) Friedrich Chrysanders, die in dieser Beziehung den ersten Versuch eines Fachorgans darstellten, und den musikwissenschaftlichen Bemühungen in der AmZ auch das Musikalische Wochenblatt (1870-1910) und die von Guido Adler (1855-1941) mitbegründete Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft (1885-1894), deren Nachfolge die von der Internationalen Musikgesellschaft herausgegebenen Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft (1899-1914) und die Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft (1899-1914) waren.
Neben dieser großen, hier natürlich nur in Auswahl dargestellten Zahl der speziellen Fachzeitschriften ist darauf hinzuweisen, daß die schon bei Reilstab ihren Anfang nehmende Feuilletonkritik seit der Mitte des Jahrhunderts als Standardausstattung Einzug in beinahe jede politische und Wirtschafts-Zeitung gehalten hatte. Eine direkte Wirkung auf Komponisten, Interpreten oder Musikleben konnte die Feuilletonkritik im Vergleich zu den Fachzeitschriften jedoch nur im begrenzten Maße oder bei besonderen Kritikerpersönlichkeiten verzeichnen. Als unmittelbar reagierende Tageskritik nahm die Feuilletonkritik gegenüber dem Leser der Zeitung vor allem die Funktion wahr, zu werben, zu warnen, zu vermitteln oder zu beeinflussen. Kirchmeyer hält in diesem Zusammenhang fest:
"Die Feuilleton-Tageskritik (...) wurde zur Klärung der künstlerischen Sache geistesgeschichtlich bedeutungslos. Die Bedeutung dieser Art von Kritik (...) ist anderer Art. Sie bekommt eine kulturpolitische Werbe- und Abwerbe- ftmktion. "[51]
Ist es auch sicherlich richtig, daß die musikalische Kritik - zumal die Feuilletonkritik - in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts praktisch keine "musikkritischen Grundlagenauseinandersetzungen"[52] mehr bot, so stellt sie doch ein wesentliches Element musikliterarischer Rezeptionsgeschichte dar. Sie gibt, wie jede Form der Rezeption, nicht nur Einblick in eine Facette der zeitgenössischen Musikauffassung, sondern bietet darüberhinaus durch das einer jeden Kritik eigene Element der Subjektivität die Möglichkeit zur musikanschaulichen Charakterisierung des Rezensenten.
2. Das Kritikeramt Engelbert Humperdincks an der Frankfurter Zeitung
"Daß das musikalische Referententum bisweilen, oder leider meistens in so ungenügender Weise vertreten ist, daran ist das Amt selber doch nicht schuld, sondern nur der Umstand, daß die Künstler selber sich bis jetzt der öffentlichen Kritik enthielten und zwar zu ihrem eigenen Nachteile. Wie oft habe ich nicht Wagner darüber klagen hören, daß die Kritik von den unberufensten Leuten ausgeübt würde (...)."*
Wie dieses Zitat aus einem Brief Humperdincks an seinen Schwager Hermann Wette aus dem Jahre 1884 zeigt, hat sich Humperdinck schon früh mit den Möglichkeiten und Aufgaben der musikalischen Kritik auseinandergesetzt. Ein ebenfalls an Wette gerichteter Brief, aus dem gleichzeitig ein großes Maß an Selbstironie spricht, zeigt, daß er in diesem Zusammenhang auch darüber nachdachte, sich selbst als Künstler im Bereich der musikalischen Kritik zu engagieren:
"Wenn ich, in meiner permanenten Schlaftrunkenheit, an den nächsten Winter denke mit etwaigen Theaterarbeiten und Aufregungen, so überläufts mich eiskalt und ich möchte dann am liebsten die ganze Musik an den Nagel hängen, um Journalist oder gar Romanschreiber zu werden (...)"[53] [54]
Bereits zu dieser Zeit muß Humperdinck damit begonnen haben, verschiedentlich Rezensionen zu verfassen. Zwei Jahre später (1886) nämlich schrieb er an seine Eltern:
"Nachdem noch kürzlich mein vor zwei Jahren [?] erschienener Bericht in dem Musikalischen Wochenblatt die Ehre einiger Zitate erfahren hat, fange ich an, mir auf meine Feder etwas einzubilden. "[55]
Die Hoffnung aber, die er sich im gleichen Jahr auf eine Rezensentenstelle an der Kölner Zeitung gemacht hatte[56], zerschlug sich. Allerdings eröffnete sich in Mainz, wo Humperdinck ab Oktober 1888 als Lektor beim Verlag B. Schott's Söhne tätig war, eine neue Perspektive:
"Dr. [?] schrieb mir gestern, ob ich die Concert- und Opernberichte im 'Mainzer Tageblatt' übernehmen wolle; obschon nur (?) Freiplätze dafür vergütet werden, riet er mir dazu an, weil ich auf diese Weise großen Einfluß auf die musikalische Lage (?) in Mainz gewinnen würde, was mich denn auch dazu bestimmte, den Posten anzunehmen."[57]
Zu diesem Zeitpunkt hatte Engelbert Humperdinck bereits für knapp ein Jahr[58] das Amt des Konzertkritikers an der Bonner Zeitung bekleidet und nebenbei Artikel in anderen Zeitungen, darunter auch die Kölner Zeitung, veröffentlicht.
1890 lud Cosima Wagner Humperdinck für einige Monate nach Frankfurt ein, um die musikalische Erziehung ihres Sohnes Siegfried zu übernehmen. Dort begann Humperdinck, sich um eine Kritikerstellung an der Frankfurter Zeitung zu bemühen. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte jedoch von Seiten der Zeitung:
"Ein paar Tage später frug man bei mir an, ob ich die Musikreferate für die Fr. Z. [Frankfurter Zeitung] übernehmen würde, worauf ich einging, unter der Voraussetzung, daß sie anständig honoriert würden. Es ist zwar zwecklos, schon jetzt überhaupt davon zu reden, da ich noch keine offizielle Anfrage erhalten habe, aber wenn es dazu käme, so wäre es mir schon ganz recht, ich würde dann den Dirigenten an den Nagel hängen und mich ganz auf das Federführen (?) verlegen (...)."[59]
Wenig später bemerkte er:
"Von der Frankfurter Zeitung habe ich bis heute nichts vernommen und es scheint, als ob aus der Geschichte einstweilen nichts wird."[60] [61]
Gleiches schrieb er an seinen Schwager Hermann Wette. Hier wird jedoch noch deutlicher, inwieweit er sich selbst für die Anstellung einsetzen möchte:
"Von der Frankfurter Zeitung habe ich auch nichts gehört, obschon ich Ende dieser Woche Näheres erfahren sollte. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, so muß ich mich schließlich wohl entschließen, den Berg persönlicher Erkundung zu erklettern, was eigentlich mir gegen den Strich geht. "9 '
Die Verhandlungen mit der Frankfurter Zeitung verzögerten sich weiterhin:
"Ich erhielt Nachricht, daß die Sache geordnet werden solle, wenn Herr Sonnemann, der Verleger der Frkf. Ztg. von England zurückgekommen sein wird. Woche um Woche verging, und ich hörte nichts, obschon Herr S. längst zurück war, während der Gen. Anzeiger einen Brief nach dem anderen schrieb. Endlich ging ich vor einigen Tagen zu Sonnemann, und erfuhr dorten, daß er gar nichts von meinem Vorhaben wußte. Die betr. Redaktion, die die Sache in die Hand genommen, hatte ihm nichts davon gesagt (...). Herr S. ersuchte mich, meine früheren Arbeiten ihm vorzulegen, und versprach mir in wenigen Tagen Antwort zu schicken. Sehr entzückt bin ich nicht davon, denn voraussichtlich wird das Honorar nicht größer sein, als vom (?) Gen. Anzeiger außerdem müssen die Artikel noch in derselbigen
Nacht abgeliefert werden. So lebe ich also im Ungewissen: In jeder Hand einen Spatz und auf dem Dache ein anmutiges Taubenpaar.''[62]
Der erwähnte Frankfurter General-Anzeiger war bereits mehrere Male an Humperdinck mit der Bitte herangetreten, er möge das Konzertreferat der Zeitung übernehmen. Noch im Oktober 1890, als Humperdinck schließlich doch die Anstellung als Rezensent der Frankfurter Zeitung erhalten hatte, erneuerte der General-Anzeiger sein Angebot, doch verzichtete Humperdinck auf das "Mehreinkommen von 1000 M."[63] nach Rücksprache mit dem Verleger der Frankfurter Zeitung Sonnemann, der ihn bat, "davon abzustehen"[64], da er Kollisionen zwischen den beiden Aufgabenbereichen befürchtete. Trotzdem schrieb Humperdinck im November des gleichen Jahres an Hedwig Taxer: "Ich habe jetzt auch angefangen für die Köln. Ztg. zu schreiben (...)."[65]
Es ist daher anzunehmen, daß Humperdinck in seiner Frankfurter Zeit gelegentlich Artikel in anderen Zeitungen, wahrscheinlich auch im Frankfurter General-Anzeiger und im Mainzer Tageblatt, veröffentlichte.[66]
Die Frankfurter Zeitung war 1856 gegründet worden, zunächst als ein reines Wirtschaftsblatt. Unter der Leitung Leopold Sonnemanns wurde 1866 das Feuilleton als eigenständige Redaktion eingerichtet.[67] 1889 übernahm der Theaterkritiker Fedor Mamroth die Leitung des Feuilletons als Nachfolger von Wilhelm Mayer (18671879) und dem Reinecke-Schüler Gustav Erlanger (1879-1889).[68]
"Die Ausweitung des Feuilletons auf etwa den doppelten Umfang und eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber den Tendenzen der Moderne bilden den Rahmen, in den sich Humperdincks Arbeit einfügt."[69]
Neben Humperdinck waren in der Feuilleton-Redaktion im Bereich Musik vor allem Fritz Schaum und Hans Pfeilschmidt tätig, die Humperdinck bei Abwesenheit vertraten.[70] Über die Opernkritik hinaus rezensierte Humperdinck ab 1893 die Opernhaus-Konzerte, aber auch die Aufführungen der Konservatorien.[71]
Es hat den Anschein, als habe Humperdinck die Möglichkeit gehabt, seinen Rezensentendienst relativ freizügig einzuteilen. Neben den Sommerpausen machen sich immer wieder Unterbrechungen bemerkbar, die auf längere Abwesenheit Humperdincks schließen lassen, und in denen Schaum und Pfeilschmidt als Opernkritiker in Erscheinung treten.[72] Mehrmals waren die Reisen Humperdincks auch Thema in Gesprächen zwischen ihm und Leopold Sonnemann. So schrieb er z.B. im November 1891:
"Heute war ich an der Zeitung, um mein Geld zu erheben und wurde zu Sonnemann berufen, der mit mir wegen Theaterangelegenheiten zu reden hätte. Ich bereitete mich schon auf einen Faustkampf vor, um ihm mal gehörig die Wahrheit zu sagen, als er damit begann, ich hätte durch meinen Urlaub der Zeitung viel Geld gekostet, die durch meine vielen Reisen nach Bonn und die nötigen Vertretungen Schaden an ihrem Geldbeutel erlitten hätte, indess hoffe er, daß es diesen Winter anders damit würde (...)."[73]
Seine kritisch-handwerklichen Fähigkeiten schätzte Humperdinck selbst relativ gering ein.[74] Darüberhinaus bemerkt er:
"Ist es nicht merkwürdig, daß ich gerade in dem Fache am meisten zu tun bekomme, das mir immer am wenigsten sympathisch war? Und doch fangt es nun an, mich mehr zu interessieren als früher; das kommt daher, weil ich für vielgelesene Zeitungen schreibe, da weiß man doch, daß es nicht ganz vergebene Arbeit ist. "[75]
Auch Wolfram Humperdinck macht auf diese Bemerkung seines Vaters aufmerksam und hält im weiteren fest, daß Engelbert Humperdinck sein Rezensentenamt immer mit großer Gewissenhaftigkeit versah,
"(...) unablässig bemüht, eine Leistungssteigerung zu fördern (...). Die Anregungen und Zensuren, die Humperdinck in seiner Art schonend, aber mit Bestimmtheit gab, trugen zu dem Aufschwung bei, den die Oper im Lauf der 90er Jahre nahm. "[76]
Ein maßvolles, aber dennoch angemessenes Urteil war dabei, wie sich im Folgenden zeigen wird, ein Hauptanliegen Humperdincks:
"Mit meinen kritischen Bestrebungen (wenn überhaupt davon die Rede sein darf, da ich im Grunde genommen gar keinen Beruf dazu in mir verspüre, sondern nur durch äußere Verhältnisse dazu gekommen bin), bin ich seit einiger Zeit in ein anderes Fahrwasser geraten. (...) Die Kritik, namentlich die musikalische, sollte endlich damit beginnen, ihre negative nörgelnde Seite weniger zu betonen und die positive hervorzuheben. Sie sollte ihre Aufgabe vorzugsweise darin erblicken, vermittelnd zwischen dem Künstler und dem Publikum einzutreten; statt überall mit dem Finger in den wunden Stellen herumzufahren, sollte sie das Verständnis für die Einzelheiten vorbereiten und Unterstützen. Denn das Publikum, urteilslos wie es ist und daran gewöhnt, sich alles von den Zeitungen vorkauen zu lassen, bedarf nun einmal des Führers, und man tut wirklich nicht wohl daran, es in seiner Gleichgültigkeit und Kritiklosigkeit (?) zu bestärken. Ich gebe zwar zu, daß diese Rolle nicht so leicht durchzuführen ist. Es ist weit interessanter zu lesen, wie einer nach allen Regeln der Kunst abgemurkst wird, als sich belehren zu lassen. Derselbe bestialische Instinkt der Schadenfreude, der vor zwei Jahrtausenden den süßen Pöbel in den Circus trieb, um das Gemetzel der Gladiatorenkämpfe mit anzusehen, wirkt noch heute in dem Zeitungspöbel nach, der keinen größeren Jux kennt, als wenn so ein armer Sünder in der Zeitung erbarmungslos zerfleischt wird. Dieser Skandalsucht zu fröhnen, darin sollen die Kritiker ihren Beruf erkennen! Ich bin lange genug bei der Stange gewesen, um das zu wissen. Jedesmal, wenn ich einem eins versetzte, hieß es allenthalben: Bravo, ausgezeichnete Kritik! Wenn ich mich bemühte, mich in das, was der Betreffende dem Publikum sagen wollte, hineinzudenken, krähte kein Hahn darnach. ”[77]
Deutlich wird hier das Selbstverständnis Humperdincks als Musikkritiker. Er wendet sich ab von der reißerischen Kritik als Selbstzweck und propagiert eine Form der Kritik, die sich mit jedem Werk aufs Neue einer intensiven Auseinandersetzung stellt. Gleichzeitig sieht sich Humperdinck als Vermittler zwischen Künstler, Kunstwerk und Publikum, der das Verständnis des Werkes auf Seiten des Publikums vorzubereiten hat.
"Zerfleischende"[78] Kritiken finden sich bei Humperdinck nie. Vielmehr beschränkte er sich in manchen Fällen eher auf eine reine Aufführungskritik, als ein vernichtendes Urteil auszusprechen.
Ein solches Bewußtsein der Verantwortung gegenüber dem Publikum, aber auch gegenüber den Künstlern äußert sich in einem prinzipiellen anfänglichen Wohlwollen. Humperdincks Anliegen war eine, wenn auch schwerlich zu erreichende Unvoreingenommenheit gegenüber den von ihm zu rezensierenden Werken.
3. Die Frankfurter Oper und ihr Repertoire
Im Jahre 1782 eröffnete in Frankfurt am Main das erste Theatergebäude. In den vorangegangenen Zeiten hatten Wandertruppen aus dem In- und Ausland, vornehmlich also fahrende Komödianten, das Theaterleben geprägt.[79] 1792 wurde erstmalig ein festes Theaterensemble engagiert, so daß die Wandertruppen fortan nicht mehr in Erscheinung traten. Wenig später bereits genoß das "Nationaltheater" schon einen besonderen Ruf, der es weit über die Stadtgrenzen hinaus berühmt machte.[80] Die steigenden Bevölkerungszahlen der Stadt ließen das 1000 Personen fassende Theater 1855 als zu klein erscheinen, und man entschloß sich zu einem Umbau. Dieser wurde jedoch durch verschiedenste Umstände hinausgezögert und schließlich 1866 nach dem Einmarsch preußischer Truppen in die Stadt vorerst gänzlich fallengelassen.
Daß es am 20. Oktober 1880 dennoch möglich war, einen zwischen 1872 und 1880 allein für die Oper geschaffenen Neubau in Anwesenheit Kaiser Wilhelm I. mit einer Festaufführung von Mozarts Don Giovanni einzuweihen, verdankte die Stadt vor allem dem großen finanziellen Engagement der Frankfurter Bürger.[81]
Das allgemeine Frankfurter Musikleben war zu dieser Zeit durch einen eher konservativen Zug gekennzeichnet. Hierbei spielten die Frankfurter Museumskonzerte eine besondere Rolle, deren konservative Haltung, so Peter Calm, in erster Linie auf die Person des Dirigenten Carl Müller, darüberhinaus aber auch auf das Frankfurter Publikum und die Übersiedlung Clara Schumanns nach Frankfurt, verbunden mit ihrem regelmäßigen Auftreten "als Solistin im 'Museum'" zurückgeführt werden kann.[82] Auch das Hoch'sehe Konservatorium war vorrangig Träger einer klassisch-romantischen Musiktradition, welche Frankfurt als "eine Insel, unberührt von den musikalischen Richtungen der damaligen Zeit"[83] erscheinen ließ.
Das Repertoire der Oper[84] war weitgehend bestimmt durch Mozarts Hauptwerke, Beethovens Fidelio, durch Cherubini und Spontini. Im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten darüberhinaus hinzu: Rossini, Bellini, Donizetti, Marsch- ner, im bescheidenen Maße Lortzing und schließlich Verdi. In den 50er und 60er Jahren erlebte das Frankfurter Publikum mit Tannhäuser (1853), dem Fliegenden
Holländer (1854) und Lohengrin (1862), letzterer unter der Leitung des Komponisten, die ersten Aufführungen Wagnerscher Werke. Gleichzeitig fanden weitere Opern Verdis (Der Troubadour, Ri goletto, La Traviata und Ein Maskenball) Aufnahme in den Spielplan.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verschob sich das Schwergewicht deutlich zugunsten der Werke Richard Wagners. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung manifestiert sich in den Einzelaufführungen der Werke des Ring des Nibelungen in den Jahren 1882/83 mit den wesentlich erweiterten Möglichkeiten des neuen Hauses, sowie in den Aufführungen des ersten Ring-Zyklus 1883.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts läßt sich eine Tendenz verzeichnen, die zeitgenössischen Werken mehr und mehr Platz im Spielplan einräumte. Diese, sich neueren Entwicklungen öffnende Situation fand Humperdinck vor, als er 1890 das Kritikeramt an der Frankfurter Zeitung übernahm. Ein allgemeiner Artikel über die Frankfurter Oper gab ihm 1891 Anlaß, sich auch über das gegenwärtige Repertoire zu äußern:
"Wir kommen zum Schluß auf das Repertoir zu sprechen, das uns um so weniger beschäftigen wird, als die Theaterleitung sicherlich bestrebt ist, das Publikum mit den hervorragendsten Erscheinungen der älteren und neueren Zeit vertraut zu machen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß das Füllhorn der Novitäten der Oper nicht so ergiebig sein kann, wie im Schauspiel, selbst wenn die Produktion auf diesem Gebiete fruchtbarer wäre, als sie es thatsächlich ist. Dessenungeachtet möchten wir auf eine vorhandene Lücke im Repertoire hinweisen. (...) Findet man nicht für gut, einen bis jetzt gänzlich übersehenen französischen Tonsetzer nachträglich zu Worte kommen zu lassen, dessen Werke, wie anderwärts der Erfolg lehrte, unter günstigen Umständen wohl fähig sind, große Wirkungen zu erzielen, nämlich Berlioz, so möge man es einmal wieder mit einem Deutschen versuchen, z. B. mit Cornelius (...). Auch wäre in Betracht zu ziehen das neue Werk des jungen Italieners Mascagni, das jetzt fast überall von sich reden macht, die 'Cavalleria rusticana'. Und wenn keine höheren Rücksichten als der Kassenerfolg maßgebend wären, dürfte Liszt's 'Legende von der heiligen Elisabeth' nicht länger unberücksichtigt bleiben (...). Daß ein Tonmeister wie Gluck seit längerer Zeit von unserer Bühne verbannt bleibt, ist um so mehr zu bedauern, als gerade für dessen HauptOpern 'Orpheus' und 'Alceste' (...) hier recht gute Vertreterinnen der Titelpartie vorhanden sind. Auch die Spieloper bedarf ausgiebiger Pflege; der Beifall, den verschiedene Auber'sehe Werke in diesem Winter fanden, beweist, daß die angewandte Mühe keine vergebliche ist. So würde z.B. Cherubini's 'Wasserträger' gewiß freudig begrüßt werden, ebenso gehören der Barbier von Sevilla, die weiße Frau, auf der anderen Seite Euryanthe, Jessonda, Hans Heiling in das ständige Repertoir eines jeden Opern-Theaters."[85]
Hier zeigen sich bereits wesentliche Charakteristika des Humperdinckschen Rezeptionsverhaltens, wie sie sich in der näheren Betrachtung der einzelnen Rezensionen wiederfinden werden. Hervorzuheben ist dabei vor allem ein auf umfassende Breite ausgerichtetes Denken Humperdincks, welches die beinahe vergessenen Werke Glucks ebenso für den Spielplan zu gewinnen sucht wie "das neue Werk des jungen Italieners Mascagni". Sicherlich ist bei Humperdinck eine deutliche Betonung "älterer" Werke zu beobachten, doch begründet er dieses selbst mit dem Umstand, daß "das Füllhorn der Novitäten der Oper nicht so ergiebig" und die so entstehende Lücke durchaus mit erprobten, aber eben auch "vergessenen" oder "übersehenen" älteren Werken zu schließen sei. Daß man es dabei "wieder einmal mit einem Deutschen versuchen" möge, zeugt sicherlich nicht von antifranzösischen oder - italienischen Ressentiments, was die übrigen Rezensionen bekräftigen.
Auch wenn das größere Gewicht hier eher auf den Werken der älteren Opernliteratur liegt, so zeigt sich dennoch eine prinzipielle Offenheit Humperdincks auch gegenüber den Erscheinungen der neueren, zeitgenössischen Musik, wie sie im ersten Absatz des zitierten Abschnittes andeutungsweise thematisiert wird.
4. Die Rezensionen
4.1. Das 18. Jahrhundert
4.1.1. Gluck
In einer Besprechung der Oper Annida aus dem Jahre 1894 manifestiert sich in kurzen Bemerkungen das Gluck-Bild Engelbert Humperdincks.[86] Im Vordergrund steht hierbei die Auffassung Humperdincks, Gluck habe "neue Pfade der Kunst gewiesen", wobei er als "eigentlicher Begründer des musikdramatischen Stiles" und somit als Ausgangspunkt für das Wagnersche Musikdrama zu gelten habe. Mit dieser Beurteilung reiht sich Humperdinck in eine Gluckrezeption ein, die den Komponisten als den frühen Reformator auf dem Gebiet der Oper versteht.[87] Hierbei werden "der 'Reformator' Gluck und der 'Revolutionär' Wagner"[88] oftmals in Analogie gesetzt, wie es auch in der Humperdinckschen Rezension anklingt. So schreibt etwa Edgar Istel: "(...) nach vorwärts zeichnen Glucks Bestrebungen deutlich die Bahnen vor, die in Richard Wagners 'Gesamtkunstwerk' ihren endgültigen Ausdruck finden sollten. "[89]
Schon der Gluck-Biograph A. B. Marx wies auf die Bedeutung der "Frage vom musikalischen Drama"[90] für das kompositorische Schaffen Glucks hin. Richard Wagner selbst stellte sich gerne in die Nachfolge Glucks und sah dessen Werk als "Ausgangspunkt für eine allerdings vollständige Veränderung in der bisherigen Stellung der künstlerischen Faktoren in der Oper zueinander."[91]
Zeigt sich demnach, daß das Bild des Reformators Gluck, wie es Humperdinck in seiner Kritik aufgreift, durchaus dem Verständnis der Zeit entsprach, so macht sich in der weiteren Besprechung der Gluckschen Werke und hier speziell der Oper Armida eine Distanz bemerkbar, die die oftmals enthusiastischen Einschätzungen der Zeitgenossen etwas zurücknimmt. Ganz anders nämlich als Istel, der noch nach der Jahrhundertwende Glucks Reformopern "als 'modern' im besten Sinne des Wortes" bezeichnet, da sie "noch heute ohne Vermittlung historischer Kenntnisse rein menschlich"[92] zum Publikum sprächen, macht Humperdinck die Probleme der zeitlichen Distanz geltend:
"(...) um eine Oper aus jener Zeit würdigen zu können, müssen wir uns[-er] ganzes Tonempfinden einer vergangenen Gefühlswelt anpassen, die noch nichts von den schrillen Dissonanzen unserer Tage wußte und in einem schlichten verminderten Septimenakkord den Ausdruck höchster Leidenschaft oder tiefsten Schmerzes gewahrte. "[93]
Allein bei Eduard Hanslick finden sich ähnliche Vorbehalte gegenüber den Gluck- schen Werken:
"Kurz, wir Kinder des 19. Jahrhunderts stehen Gluck zwar ebenso ehrfurchtsvoll, aber nicht mehr so arm gegenüber, wie unsere Ururgroßeltern. Täusche sich niemand darüber, welche entfremdende Macht im Ablaufe einer langen Zeitperiode und gerade dieser Periode liegt. "[94]
In dieser zeitlichen und musikhistorisch bedingten Distanz liegt für Humperdinck der Hauptgrund dafür, daß die Gluckschen Opern nicht mehr zu Repertoireopern werden können.[95] Die Bewunderung für den "Genius"[96] Gluck, die trotz aller Vorbehalte stets im Vordergrund der Besprechungen bleibt, resultiert somit für Humperdinck deutlich aus einem "rein historischen Interesse"[97], das sich den "reformatorischen" Neuerungen in den Gluckschen Werken zuwendet. Glucks Opern stellen "der gegenwärtigen Generation (...) eine terra incognita"[98] dar und liegen für Humperdinck jenseits des Theaterhorizontes, der "in musikalischen Dingen in der Regel nicht über ein Jahrhundert hinaus[geht]; dort, gewissermaßen an den Säulen des Herkules, halten Mozarts Werke die Wacht (...).”[99]
4.1.2. Mozart
Den Mozartschen Opern und dem Komponisten Mozart begegnet Humperdinck mit einer Bewunderung, wie sie allein in den Rezensionen zu Wagner erneut wiederkehrt.[100] Ein Artikel zum 100. Todestag Mozarts im Jahre 1891 macht dies deutlich:
"Ein zweiter Gedenktag steht bevor, rührender und ernster ais der erste [100 Jahre Zaubetflöte], dessen Feier wir nicht ohne Wehmut begehen, der Tag der einst vor hundert Jahren dem reichsten und begnadetsten Künstlerleben auf der Höhe des Schaffens ein vorzeitiges Ende brachte. Welche Empfindungen knüpfen sich an (...) [den] Todestag Mozarts, an welchem er (...) seine große reine Seele aushauchte (...). Zeit seines Lebens (...) vollbrachte er in der kurzen Spanne des ihm beschiedenen Daseins das Außerordentlichste und hinterließ der Nachwelt unermeßliche Schätze seiner schöpferischen Tätigkeit, deren Reichtum uns in Erstaunen setzt. Die Bedeutung dieses Genius für die Entwicklung der Musik näher erörtern können wir uns wohl erlassen. Die einfache Tatsache, daß fast alle seine zahlreichen hinterlassenen Werke (...) noch heute, nach einem vollen Jahrhundert, von jedem in ihrer unverwelkten Jugendfrische genossen werden, der Sinne hat, ihre Schönheit zu erfassen und ein Herz, sie zu empfinden, spricht lauter und beredter als ganze Bände von ästhetischen Abhandlungen. "[101]
Es fallt auf, daß eine kritische Auseinandersetzung Humperdincks mit den Opern Mozarts fast an keiner Stelle stattfindet. Hierbei kommt sicherlich das zum Tragen, was H. J. Kreutzer schon für die Mozart-Rezeption um 1800 festhält: "(...) der Götterjüngling ist (...) unproblematisch, und er gibt keinen Anlaß zu Auseinandersetzungen. (...) Mozart ist (...), nach Rang wie Eigenart, eine unbestreitbare Größe."[102]
Verstärkend tritt zu diesem Phänomen der Mozartrezeption die Tatsache hinzu, daß sich früh ein Kanon von Mozart-Opern bildete, die den Spielplan mehr oder minder bestimmten, die aber keineswegs einen Überblick über das gesamte Opernwerk Mozarts boten. Dieser "glänzende Irisbogen Mozartscher Opern"[103] findet bei Humperdinck mit der Entführung aus dem Serail, Figaros Hochzeit, Don Giovanni, Cosi fan tutte und der Zaubetflöte Besprechung. Darüberhinaus erwähnt er kurz Bastien und Bastienne, schenkt aber der "wohlgelungenen kleinen Operette"[104] des weiteren keine Beachtung.
Obwohl die Humperdinckschen Mozart-Rezensionen eine kritische Auseinandersetzung weitgehend vermissen lassen, bleiben einige Phänomene erwähnenswert, die Humperdinck wie selbstverständlich in sein Mozart-Bild aufnimmt.
So ist hier die Behandlung der Rezitative in Figaros Hochzeit von Bedeutung. Humperdinck plädiert dafür, die Rezitative zugunsten einer größeren Deutlichkeit und einer gesteigerten Spannung durch Dialoge zu ersetzen[105]:
"Zunächst war der Ballast der Seccorezitative entfernt und durch den flüssigeren Dialog ersetzt worden, eine Neuerung, der wir unbedenklich zustimmen, da die ersteren keinen eigentlichen Kunstwerth haben, und, wie 'Entführung' und 'Zauberflöte' zeigen, lediglich als ein Zugeständniß Mozart's an die italienische Oper aufzufassen sind."[106]
Es überrascht, daß Humperdinck, der "Pietät" gegenüber einem Komponisten weitgehend über den Grad der Werktreue definiert[107] und diese auch für Mozart einfordert[108], den Rezitativen geradewegs den künstlerischen Wert abspricht und den Austausch gegen einen Dialog fordert. Dennoch macht gerade dieser Vorschlag deutlich, wie sehr im 19. Jahrhundert ein Mozart-Bild gefestigt war, welches sich gerne auf den "Komponisten der Entführung und der Zauberflöte" zum Zwecke der "Propagierung einer nationalen Musikkultur, speziell für die Oper"[109] berief. Rezi- tative als "Zugeständnis an die italienische Oper" entsprachen diesem Bild keineswegs. So strich man diese aus dem gleichen Grund, aus dem heraus man auch bis auf die bereits erwähnten sogenannten Meisteropern keine anderen Mozartschen Opern, etwa die scheinbar so altertümlichen Seria-Opern, auf den Spielplänen erscheinen ließ.
Das 19. Jahrhundert sah Mozart als "angeblich entwicklungslos, als ein von Anbeginn Vollendeter gleichsam vom Himmel auf die Erde gesandt"[110]. Eine offensichtliche stilistische Uneinheitlichkeit war dieser Vorstellung abträglich. Diesbezüglich hält Kreutzer fest:
"Es ist aber, denke ich, hinlänglich deutlich, daß Mozart dem seit Beethoven geltenden und seither flir selbstverständlich gehaltenen Künstlerbild des Personalstils mit einheitlicher Grundkonstante gar nicht entspricht. Mozart bietet nicht nur eine Fülle von Stilen, sein Werk steckt tatsächlich voller innerer Widersprüche und Spannungen. "[111]
Humperdinck sah Mozart vor allem als Komponisten, dessen
"(...) Sinnen und Trachten zeitlebens vornehmlich auf (...) die Erzielung eines nationalen deutschen Kunstwerkes" gerichtet war, das ihm "(...) von jeher als das höchste Ideal seines Schaffens vorschwebte. (...) Die beiden deutschen Opern 'Entführung aus dem Serail' und 'Zauberflöte' bilden nicht nur Anfang und Beschluß der höchsten Glanzperiode Mozarts als dramatischer Tonsetzer, sondern zugleich auch den Ausgangspunkt unserer nationalen deutschen Oper. ”[112]
[...]
[1] Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die ersten öffentlichen Konzerte der Academy of Ancient Music 1710 in London, die seit 1725 von A. D. Philidor in Paris initiierten Concerts spirituels oder auf die frühen Konzerte Telemanns mit städtischen Musikern in Hamburg.
[2] vgl. Stuckenschmidt 1961, Sp. 1131.
[3] Der vollständige Titel lautet: Critica Musica, d. i. Grundrichtige Untersuch- und Beurtheilung / Vieler / theils vorgefaßten / theils einfältigen Meinungen / Argumenten und Einwürjfe / so in alten und neuen / gedruckten und ungedruckten / Musicalischen Schrijften zu finden. Zur müg- lichsten Ausräutung aller groben Irrthümer / und zur Beförderung eines besseren Wachsthums der reinen harmonischen Wissenschaft / in verschiedene Theile abgefasset / und Stück-weise heraus gegeben Von Mattheson. (Hamburg 1722)
[4] vgl. Mattheson 1722, Bl. A 2v.
[5] vgl. Stuckenschmidt 1961, Sp. 1132.
[6] vgl. Faller 1929, 86.
[7] vgl. hierzu die Auseinandersetzung mit J. A. Birnbaum 1737/38.
[8] Als ersten Punkt nennt das Inhaltsverzeichnis des ersten Stückes "Nachrichten von musikalischen Begebenheiten und berühmten Musikern (...)”, womit Hiller alles bezeichnete, "was die musikalischen Schaubühnen, die Capellen an Höfen, die Kirchen=Musik, und die öffentlichen musikalischen Gesellschaften, oder sogenannte Concerte in großen Städten angehet. " (Hiller 1776, 6.)
[9] "Kurz, wir werden uns bey allen unsem Anzeigen und Beurtheilungen an die Stelle der Liebhaber setzen und gerade so viel von einer Sache sagen als sie nothwendig wissen müssen. ” (ebd.)
[10] Kirchmeyer 1990, XVII.
[11] ebd.
[12] vgl. Faller 1929, 88.
[13] ebd.
[14] Kirchmeyer ebd., XVIII.
[15] vgl. ebd.
[16] Um im Folgenden das Vorgehen des Kritikers, i.e. die kritische Methode hervorzuheben, verwende ich den Terminus "psychologisierende Kritik" gegenüber "psychologische Kritik", wie er schon bei Brendel 1845, 2, aber auch bei Kirchmeyer 1990, XIX zu lesen ist.
[17] Kirchmeyer 1990, XIX.
[18] ebd.
[19] Rochlitz 1799/1800, Sp. 631.
[20] Schering 1929, 17.
[21] Kirchmeyer 1990, XIX.
[22] Kirchmeyer bezeichnet diese von der subjektiven psychologisierenden Kritik wegführende Übergangsphase als Phase der Standpunktskritik, ebd., XXIII.
[23] Marx etwa gab als Konsequenz aus dieser Situation seine Zeitung auf, um nur noch Pädagoge zu sein.
[24] Kirchmeyer 1990, XXI.
[25] ebd.
[26] vgl. hierzu u.a. auch seine Rezensionen in der AmZ, im Komet und im Leipziger Tageblatt.
[27] vgl. Schering 1929, 19.
[28] vgl. Dahlhaus 1970, 39.
[29] vgl. ebd.
[30] vgl. ebd.
[31] Felix Mendelssohn-Bartholdy schreibt über die AmZ: "Sie wissen am Vortrefflichen eine mangelhafte Seite herauszukehren und das Stümperhafte nicht ganz ohne Verdienst zu finden! " (Schering 1929, 19).
[32] Stuckenschmidt 1961, Sp. 1140.
[33] vgl. Hanslick 1990.
[34] Brendel 1845, 2f.
[35] ebd., 4.
[36] ebd., 11.
[37] vgl. Brendel 1852, Iff.
[38] ebd.
[39] Kirchmeyer 1990, XXVI.
[40] Hier zeigt sich schon eines der wohl noch harmloseren Mißverständnisse.
[41] Mitarbeiter der Deutschen Musik-Zeitung, die sich zur Aufgabe machte, das musikalische Wien nach innen und nach außen zu vertreten, waren u.a. Eduard Hanslick, Gustav Nottebohm (1817-1882), Joseph von Wasielewsky (1822-1896) und Arrey von Dommer (1828-1905).
[42] Signale für die musikalische Welt, zit. nach Fellinger 1968, 20.
[43] Kirchmeyer 1990, ΧΧΠ.
[44] vgl. im folgenden Fellinger 1968, 21ff; llOff.
[45] seit 1962 als Schweizerisches Sängerblatt, von 1879 bis 1937 als Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt und dann unter dem Titel Schweizerische Musikzeitung (Revue Musicale Suisse) erscheinend.
[46] seit 1924 als Deutsche Sängerschaft bis 1934 weitergeführt.
[47] So z.B. die katholische Reform der Liturgie, die Gründung von Cäcilienvereinen, oder die evangelischen Bestrebragen zu einer Belebung des lutherischen Kirchenliedes, sowie der protestantischen Liturgie.
[48] seit 1911: Cäcilienvereinsorgan, nach der Vereinigung mit Musica sacra 1929 bis 1937: Cäcilienvereinsorgan. Musica sacra, 1949-1956: CVO Zeitschrift für Kirchenmusik und seitdem: Musica sacra.
[49] seit 1932 als Gregorius-Blatt und Gregorius-Bote.
[50] seit 1925 als Evangelischer Kirchengesangverein für Deutschland.
[51] Kirchmeyer 1990, XXVI.
[52] ebd.
[53] EH an Hermann Wette, 1884, zit. nach Innen 1975, 66.
[54] EH an Hermann Wette, 19.06.1884, zit. nach ebd., 65.
[55] EH an die Eltern, 10.06.1886, StUBF.
[56] vgl. EH an die Eltern, 28.01.1886, StUBF.
[57] EH an die Eltern, 17.08.1888, StUBF.
[58] seit dem Winter 1887/88.
[59] EH an Hedwig Taxer, 14.06.1890, StUBF.
[60] EH an Hedwig Taxer, 24.06.1890, StUBF.
[61] EH an Hermann Wette, 05.07.1890, StUBF (maschinenschriftl. Abschrift).
[62] EH an Hedwig Taxer, 17.07.1890, StUBF.
[63] ebd.
[64] EH an Hedwig Taxer, 18.10.1890, StUBF.
[65] EH an Hedwig Taxer, 06.11.1890, StUBF.
[66] Diese Annahme konnte jedoch leider im Zusammenhang mit dieser Arbeit nicht verifiziert werden.
[67] vgl. Cahn 1994, 62.
[68] vgl. Geschichte der Frankfurter Zeitung, 158/421/427/1029.
[69] Cahn 1994, 63.
[70] vgl. ebd.
[71] vgl. ebd., 69.
[72] vgl. Anhang.
[73] EH anHedwig Taxer, 30.11.1891, StUBF.
[74] vgl. EH an Hedwig Taxer, 25.07.1891, StUBF; EH an die Eltern, 19.02.1893, StUBF.
[75] EH an Hedwig Taxer, 06.11.1890, StUBF.
[76] WH 1965, 200f.
[77] EH an Hermann Wette, 04.12.1892 (?), StUBF.
[78] s.o.
[79] vgl. Mohr 1980, 11.
[80] vgl. ebd.
[81] vgl. ebd., 9.
[82] vgl. Calm 1979, 57ff.
[83] Hirtler 1940, 23.
[84] vgl. Hálasz 1992, 286ff.
[85] Rez. 26.04.1891
[86] vgl. Rez. 07.12.1894
[87] Die heutige Forschung beginnt mehr und mehr die Bedeutung Glucks für die Opemgeschichte zu relativieren. So stellt U. Schreiber fest: "Der Ritter von Gluck war nicht der große Opernreformator, als der er besonders in deutschen Werken der Musikgeschichte grassiert, seine direkten Nachwirkungen sind geradezu verschwindend." (Schreiber 1988, 300.); vgl. hierzu besonders auch: Kunze 1989, 390.
[88] Istel 1919, 7.
[89] ebd.
[90] Marx 1863, 6. .
[91] zit. nach Schreiber 1988, 292.
[92] Istel 1919, 7.
[93] Rez. 07.12.1894
[94] Hanslick 1888, 107.
[95] vgl. Rez. 21.08.1893
[96] Rez. 07.12.1894
[97] ebd.
[98] ebd.
[99] ebd.
[100] vgl. hierzu Kap. 4.3.
[101] Rez. 03.12.1891
[102] Kreutzer 1987, 13.
[103] Hanslick 1877, 29.
[104] Rez. 08.02.1893
[105] vgl. Rez. 07.12.1891
[106] Rez. 27.11.1893
[107] Es wird sich zeigen, daß dieser Aspekt für die Wagner-Rezensionen von äußerster Wichtigkeit ist. (vgl. Kap. 4.3.)
[108] vgl. Rez. 30.11.1896
[109] Kreutzer 1987, 15.
[110] ebd.,23.
[111] ebd.
[112] Rez. 03.12.1891
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Engelbert Humperdinck in der Musikkritik?
Engelbert Humperdinck war über 15 Jahre lang als Musikkritiker tätig, davon fast 10 Jahre in fester Anstellung bei der Frankfurter Zeitung. Er war ein gewissenhafter Rezensent, dessen Arbeit wesentliche Einblicke in seine Musikanschauung und die Rezeption der Zeit um die Jahrhundertwende bietet.
Wie beeinflusste Richard Wagner Humperdincks Kritiken?
Humperdinck war stark von Richard Wagner geprägt. In seinen Rezensionen verstand er sich als Verfechter der wagnerschen Ideen und Ideale und setzte sich beharrlich für eine angemessene Wiedergabe von Wagners Werken ein.
Warum wurde Humperdincks Tätigkeit als Kritiker oft übersehen?
Humperdinck wurde oft auf seine Rolle als Komponist von "Hänsel und Gretel" reduziert. Seine vielseitigen Tätigkeiten als Dirigent, Kritiker und Hochschullehrer traten dadurch in den Hintergrund der musikwissenschaftlichen Wahrnehmung.
Wann entstand die moderne Musikkritik in Deutschland?
Die periodische Berichterstattung über Musik begann im frühen 18. Jahrhundert, maßgeblich durch Johann Matthesons "Critica Musica" (1722), als Reaktion auf das wachsende öffentliche Konzertleben der Aufklärung.
Welche Komponisten behandelte Humperdinck in seinen Frankfurter Rezensionen?
Er rezensierte ein breites Spektrum, von Klassikern wie Mozart und Gluck über Zeitgenossen wie Richard Strauss und Pfitzner bis hin zu Vertretern des italienischen Verismus wie Mascagni und Leoncavallo.
- Quote paper
- Christoph Heimbucher (Author), 1994, Engelbert Humperdinck als Musikkritiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282890