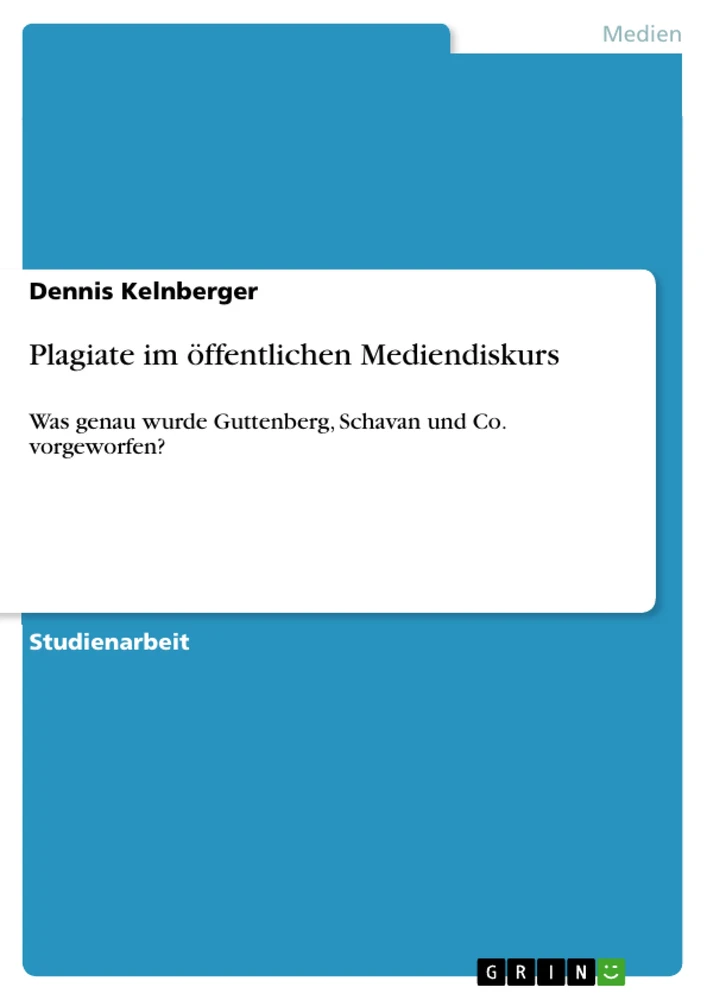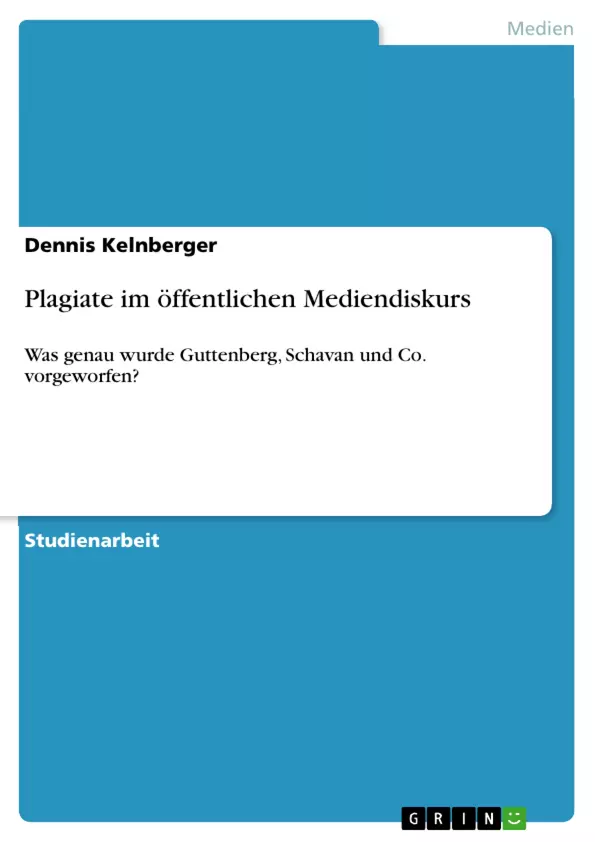Obwohl das Thema „Plagiate“ die Wissenschaft schon lange beschäftigt, wird diese Problematik erst seit einigen Jahren von den Medien konsequent aufgegriffen. Freilich hängt dies vor allem mit der Plagiatsaffäre von Karl-Theodor zu Guttenberg zusammen, die den „Stein ins Rollen brachte“. Nach und nach wurde über immer mehr z.T. hochrangige Politiker berichtet, die unter Verdacht standen, bei ihren Dissertationen unerlaubt abgeschrieben zu haben. Die vorgegebene Themenstellung umfasst daher einen nicht näher abgegrenzten Personenkreis, weshalb in diesem Gliederungspunkt eine Auswahl einiger vermeintlicher Plagiatoren angesprochen wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese noch deutlich weiter fortgeführt werden könnte und kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.
Zunächst sei Frank-Walter Steinmeier, der ehemalige Kanzlerkandiat der SPD, als einer der aktuellsten Fälle zu erwähnen. Uwe Kamenz, ein Münsteraner Universitäts-Professor, sprach in Zusammenhang mit Steinmeiers Doktorarbeit „Bürger ohne Obdach“ im September 2013 von „umfangreichen Plagiatsindizien“ und leitete so eine Untersuchung an dessen Heimathochschule in Gießen ein. Diese gab im November bekannt, dass Steinmeier der Doktortitel nicht entzogen werde, da zwar handwerkliche Schwächen in seiner Dissertation vorhanden seien, allerdings keine Täuschungsabsicht, welche für den Entzug des Titels relevant gewesen wäre.
Etwas anders ist der Fall von Deutschlands ehemaliger Familienministerin Kristina Schröder zu betrachten, denn bei ihr geht es nicht um den „bloßen“ Vorwurf des Abschreibens, sondern darum, dass wissenschaftliche Hilfskräfte möglicherweise beträchtliche Teile ihrer Promotion „Gerechtigkeit als Gleichheit“ verfassten. Laut ihrer eigenen Aussage handelte es sich dabei um das komplette Erstellen zweier Fragebögen, deren Auswertung und das Formatieren und Layouten der gesamten Arbeit – gegen Bezahlung auf Minijob-Basis, dennoch sprach Mainz' Universitäts-Professor Georg Krausch davon, dass keine Hinweise auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten in ihrer Arbeit vorhanden seien, weshalb auch sie ihren Doktortitel behalten durfte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wer ist eigentlich „und Co.„?
- 2 Relevanz des Themas und Vorstellung der Fälle „Guttenberg“ und „Schavan“
- 3 Definition eines Plagiats
- 4 Einflüsse, die Plagiate fördern
- 5 Arten von Plagiaten
- 6 Arbeitsweise der „Plagiatsjäger“
- 6.1 Korrektur mit Hilfe einer Software
- 6.2 Öffentliche Wikis zum gemeinsamen Plagiate enttarnen
- 6.3 Plagiatsjäger - was treibt sie an?
- 7 Beispiele für Plagiate
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik von Plagiaten im öffentlichen Mediendiskurs, insbesondere im Kontext der Fälle Guttenberg und Schavan. Ziel ist es, die Relevanz des Themas darzulegen, Plagiate zu definieren und die Faktoren zu beleuchten, die sie begünstigen. Die Arbeit analysiert auch die Methoden der „Plagiatsjäger“ und präsentiert ausgewählte Beispiele.
- Definition und Arten von Plagiaten
- Die Rolle der Medien im Kontext von Plagiatsaffären
- Methoden der Plagiatserkennung
- Ausgewählte Fälle von Plagiaten im politischen Kontext
- Rechtliche und ethische Implikationen von Plagiaten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Wer ist eigentlich „und Co.“?: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und benennt verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, die in den Verdacht des Plagiats gerieten. Es werden die Fälle Steinmeier, Schröder und Koch-Mehrin angesprochen, um die Bandbreite und Häufigkeit des Problems zu verdeutlichen. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung unterschiedlicher Reaktionen von Universitäten und der Öffentlichkeit auf die jeweiligen Vorwürfe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
2 Relevanz des Themas und Vorstellung der Fälle „Guttenberg“ und „Schavan“ : Dieses Kapitel betont die juristische und gesellschaftliche Bedeutung von Plagiaten. Es analysiert im Detail die Fälle Guttenberg und Schavan, zwei prominente Beispiele, die weitreichende politische Konsequenzen hatten. Die Diskussion der unterschiedlichen Reaktionen auf die Vorwürfe, der Prozess der Titelablehnung und die darauf folgenden juristischen und politischen Entwicklungen werden eingehend untersucht. Der Fokus liegt auf der Illustration der politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Plagiatsaffären.
3 Definition eines Plagiats: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition von Plagiat, sowohl im allgemeinen als auch im spezifischen Kontext wissenschaftlicher Arbeiten. Es werden unterschiedliche Definitionen und Perspektiven vorgestellt und die Problematik der Abgrenzung von "harmlosen" Übernahmen und wissentlichem Plagiat diskutiert. Der Text verdeutlicht den Unterschied zwischen einer allgemeinen Definition des geistigen Eigentums und einer textbezogenen Definition, die speziell für wissenschaftliche Arbeiten relevant ist.
Schlüsselwörter
Plagiat, Mediendiskurs, Guttenberg-Affäre, Schavan-Affäre, Urheberrecht, Wissenschaftsethik, Plagiatserkennung, Hochschulpolitik, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Plagiate im öffentlichen Diskurs - Die Fälle Guttenberg und Schavan
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Problematik von Plagiaten im öffentlichen Diskurs, insbesondere anhand der Fälle Guttenberg und Schavan. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas, definiert Plagiate, untersucht die Faktoren, die sie begünstigen, und analysiert die Methoden der "Plagiatsjäger". Zusätzlich werden ausgewählte Beispiele präsentiert und rechtliche sowie ethische Implikationen diskutiert. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Definition von Plagiaten, eine Analyse der Fälle Guttenberg und Schavan, eine Beschreibung der Methoden der Plagiatserkennung, und ein Fazit.
Welche Fälle werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail die Fälle Guttenberg und Schavan. Diese Fälle dienen als prominente Beispiele für die weitreichenden politischen Konsequenzen von Plagiaten. Zusätzlich werden die Fälle Steinmeier, Schröder und Koch-Mehrin erwähnt, um die Bandbreite und Häufigkeit des Problems zu verdeutlichen.
Wie wird ein Plagiat definiert?
Die Arbeit liefert eine präzise Definition von Plagiat, sowohl im allgemeinen als auch im wissenschaftlichen Kontext. Sie diskutiert unterschiedliche Definitionen und Perspektiven und die Problematik der Abgrenzung von "harmlosen" Übernahmen und wissentlichem Plagiat. Der Unterschied zwischen einer allgemeinen Definition des geistigen Eigentums und einer textbezogenen Definition für wissenschaftliche Arbeiten wird verdeutlicht.
Welche Methoden der Plagiatserkennung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Plagiatserkennung, darunter die Verwendung von Software zur Korrektur, die Nutzung öffentlicher Wikis zum gemeinsamen Aufdecken von Plagiaten und eine Betrachtung der Motivation der "Plagiatsjäger".
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Arten von Plagiaten, die Rolle der Medien im Kontext von Plagiatsaffären, Methoden der Plagiatserkennung, ausgewählte Fälle von Plagiaten im politischen Kontext und die rechtlichen und ethischen Implikationen von Plagiaten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit folgenden Fragen befassen: Wer ist eigentlich „und Co.„? (Einleitung mit weiteren Beispielen), Relevanz des Themas und Vorstellung der Fälle „Guttenberg“ und „Schavan“, Definition eines Plagiats, Einflüsse, die Plagiate fördern, Arten von Plagiaten, Arbeitsweise der „Plagiatsjäger“, Beispiele für Plagiate, und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plagiat, Mediendiskurs, Guttenberg-Affäre, Schavan-Affäre, Urheberrecht, Wissenschaftsethik, Plagiatserkennung, Hochschulpolitik, öffentliche Meinung.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Relevanz des Themas Plagiat darzulegen, Plagiate zu definieren und die Faktoren zu beleuchten, die sie begünstigen. Die Arbeit analysiert die Methoden der „Plagiatsjäger“ und präsentiert ausgewählte Beispiele, um die Problematik im öffentlichen Mediendiskurs zu untersuchen.
- Citation du texte
- Dennis Kelnberger (Auteur), 2014, Plagiate im öffentlichen Mediendiskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282895