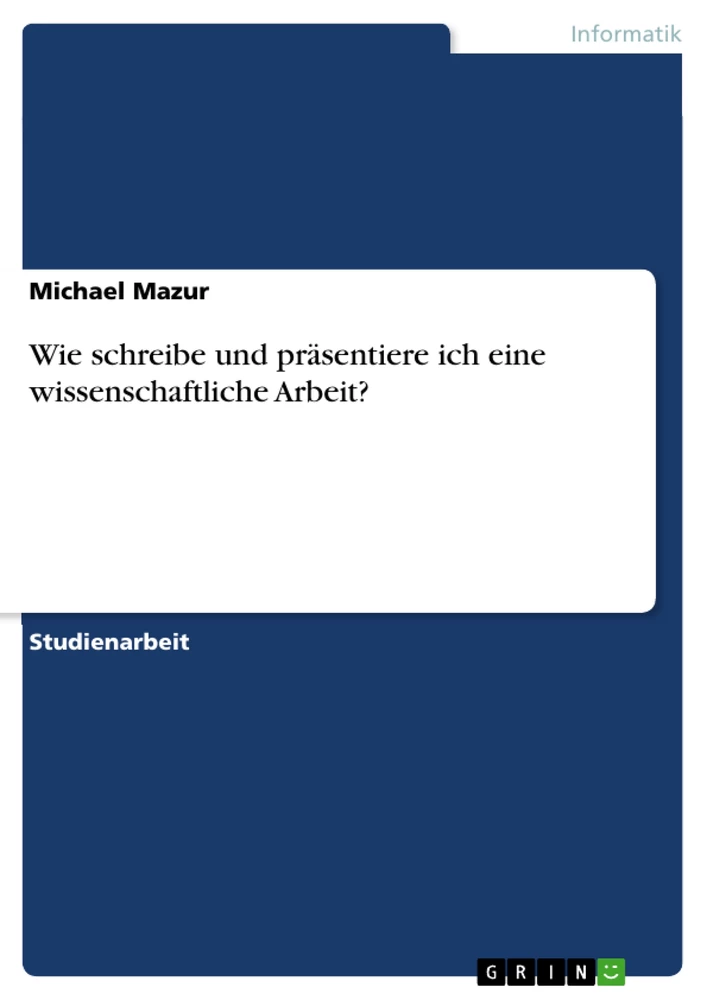Das Schreiben und Präsentieren von wissenschaftlichen Arbeiten stellt für die meisten Studenten eine gewisse Herausforderung dar. Diese Arbeit dient als Hilfestellung zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten, indem sie die wichtigsten Aspekte für das Erstellen und Präsentieren einer wissenschaftlichen Arbeit näher erläutert. Diese Aspekte lassen sich auch in die Arbeitsphasen der notwendigen Vorbereitungen, der Manuskripterstellung sowie dem Präsentieren der Ergebnisse aufteilen. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht nur auf den formalen Richtlinien, sondern auch auf den Schlüsselkompetenzen und Arbeitstechniken, die für eine erfolgreiche Ausarbeitung und Präsentation hilfreich sind.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Vorarbeiten
2.1 Arbeitsorganisation
2.2 Themenabgrenzung und -formulierung
2.3 Literaturrecherche
2.4 Literaturbewertung und -auswahl
2.5 Literaturbeschaffung
2.6 Literaturauswertung
3 Erstellen des Manuskriptes
3.1 Einleitung
3.2 Hauptteil
3.3 Schluss
3.4 Aufbau des Inhaltsverzeichnis
3.5 Zitate im Fußnotenapparat
3.6 Formatierung
3.7 Überprüfung und Korrektur
4 Präsentieren der Ergebnisse
4.1 Vorbereitung der Präsentation
4.2 Ausarbeitung
4.3 Präsentation
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zeit- und Terminplan
Abbildung 2: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Arbeitsstätten
Abbildung 3: Mind-Map wissenschaftliche Arbeit
Abbildung 4: Schritte zum Verstehen von Texten
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Phasen beim Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit unterteilt sich in die Phasen der Vorbereitung (Recherche/Organisation), der Manuskripterstellung und der Präsentation der Ergebnisse.
Wie gehe ich bei der Literaturrecherche am besten vor?
Wichtige Schritte sind die Themenabgrenzung, die gezielte Suche, die Bewertung der Quellenqualität und schließlich die systematische Auswertung der Literatur.
Wie ist ein wissenschaftliches Manuskript klassisch aufgebaut?
Es besteht aus einer Einleitung (Problemstellung), einem Hauptteil (Argumentation/Analyse) und einem Schluss (Fazit/Zusammenfassung).
Was muss beim Zitieren beachtet werden?
Alle fremden Gedanken müssen belegt werden, beispielsweise durch einen Fußnotenapparat, um Plagiate zu vermeiden und die wissenschaftliche Sorgfalt zu wahren.
Wie bereite ich eine erfolgreiche Präsentation vor?
Neben der inhaltlichen Ausarbeitung sind die visuelle Unterstützung, Zeitplanung und die Übung des freien Vortrags entscheidend.
- Quote paper
- Michael Mazur (Author), 2013, Wie schreibe und präsentiere ich eine wissenschaftliche Arbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282990