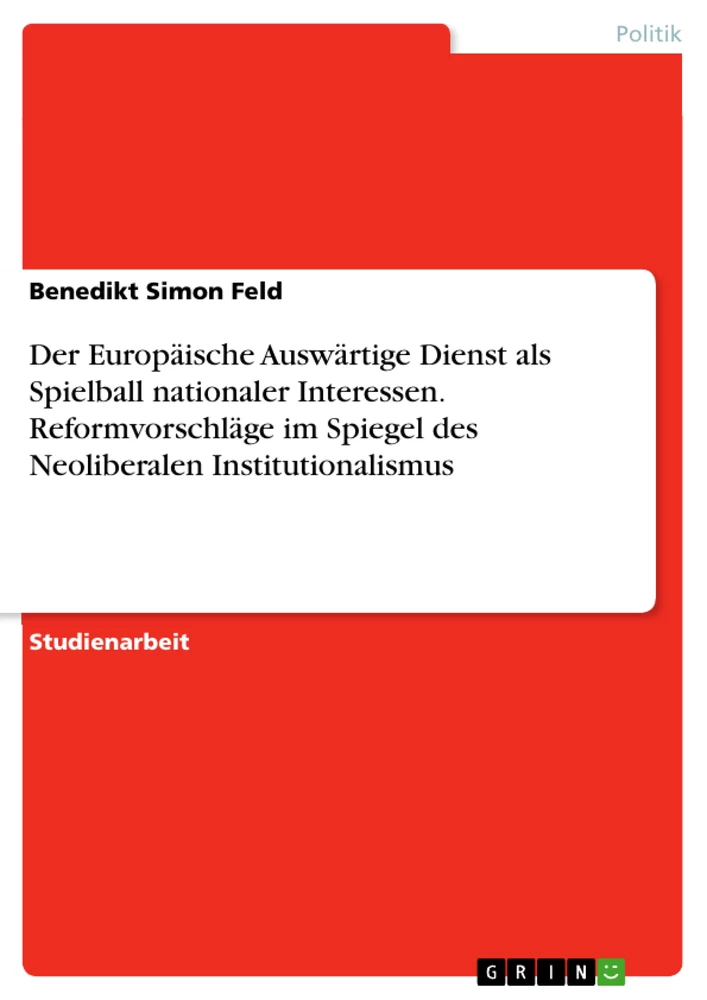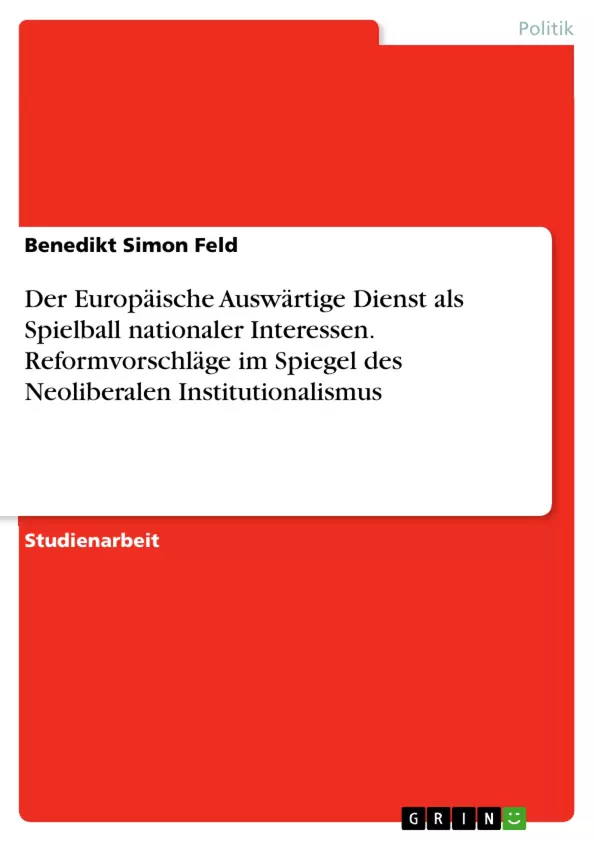Die Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) für eine kohärente Außen- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union ist eine Gelegenheit, die sich nur einmal in jeder Genration bietet. So bewertet es zumindest Catherine Ashton, die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik (Im Folgenden Hohe Vertreterin).
Ein Statement, das den Stellenwert und die politischen Erwartungen an das Projekt beschreibt. Gut zweieinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme ist die Zwischenbilanz jedoch ernüchternd. Die bisherige Entwicklung des Dienstes ist geprägt von inneren Streitigkeiten und Blockade. Die Mitgliedsländer sind hauptsächlich damit beschäftigt ihre nationalen Interessen abzusichern und zu verteidigen. Viele Fragen sind noch offen. Warum ist es der Europäischen Union (EU) mit dem Inkrafttreten des Lissabonvertrages nicht gelungen einen starken Dienst zu schaffen, der sie auf internationaler Ebene mit einer kohärenten Stimme vertreten kann? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den EAD zu einem funktionierenden Gebilde innerhalb der EU aufzubauen und wer sind die Akteure, die an einem solchen Prozess zu beteiligen sind? Diesen Fragen und Problemstellungen werde ich im folgenden nachgehen. Nach einer theoretischen Einführung in das Thema werde ich einen Blick auf die Entstehungsphase und rechtliche Grundlagen des EAD werfen. Anschließend wird untersucht, wo der Dienst innerhalb der Europäischen Union strukturell zu verorten ist.
Daraufhin folgt ein kurzer Überblick, wem Führungspositionen innerhalb des Dienstes zustehen und welche Schlüsse daraus gezogen werden können. Zu guter letzt möchte ich Möglichkeiten aufzeigen, wie es in Zukunft gelingen kann, den EAD als starke Institution zu etablieren, die unabhängig von vereinzelten Akteuren die Interessen Europas in der Welt vertreten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Ansatz
- Neoliberaler Institutionalismus
- Supranationalität versus intergouvernementale Zusammenarbeit
- Der Europäische Auswärtige Dienst
- Rechtliche Grundlage
- Entstehung
- Struktur innerhalb der EU
- Wege zu einem starken Europäischen Auswärtigen Dienst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Etablierung eines starken Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und analysiert die Gründe für dessen bisherige unzureichende Entwicklung. Das Hauptziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der EAD zu einer effektiven Institution werden kann, die die Interessen Europas kohärent vertritt.
- Der Einfluss nationaler Interessen auf die Entwicklung des EAD
- Der Neoliberale Institutionalismus als analytisches Werkzeug
- Die rechtlichen Grundlagen und die Struktur des EAD innerhalb der EU
- Möglichkeiten zur Stärkung des EAD und zur Überwindung interner Konflikte
- Die Rolle der Mitgliedsstaaten bei der Gestaltung des EAD
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die bisherige mangelnde Effektivität des Dienstes. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf behandelt werden. Catherine Ashton's Aussage über den Stellenwert des EAD wird als Ausgangspunkt genutzt, um die Diskrepanz zwischen den hohen Erwartungen und der ernüchternden Zwischenbilanz zu verdeutlichen. Die Arbeit untersucht die Rolle nationaler Interessen, die Notwendigkeit von Reformen und die Beteiligung verschiedener Akteure an dem Prozess der EAD-Entwicklung.
Theoretischer Ansatz: Dieses Kapitel präsentiert den Neoliberalen Institutionalismus als theoretisches Fundament der Arbeit. Es beschreibt die Entstehung dieser Theorie als Reaktion auf den Neorealismus und hebt die zentralen Vertreter und Werke hervor, insbesondere "Power and Interdependence" und "After Hegemony". Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Neoliberalem Institutionalismus und Neorealismus. Während beide von einem anarchischen internationalen System und rational handelnden Nationalstaaten ausgehen, betont der Neoliberale Institutionalismus die Rolle internationaler Institutionen als Mittel zur Kooperation und Interessendurchsetzung. Die Kapitel erläutert die Funktionen internationaler Institutionen wie Lastenausgleich, Informationsfunktion, Koordinationsfunktion und Disziplinarfunktion, die für deren Effektivität entscheidend sind.
Der Europäische Auswärtige Dienst: Dieses Kapitel befasst sich mit der rechtlichen Grundlage, der Entstehung und der Struktur des EAD innerhalb der EU. Es beleuchtet die Herausforderungen bei der Schaffung eines kohärenten außenpolitischen Handlungsvermögens der EU. Die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Entstehung des EAD zeigt die komplexen politischen Verhandlungsprozesse und die Schwierigkeiten bei der Abstimmung nationaler Interessen auf. Die strukturelle Verortung des EAD innerhalb der EU wird untersucht und deren Auswirkungen auf dessen Handlungsfähigkeit diskutiert.
Wege zu einem starken Europäischen Auswärtigen Dienst: Dieses Kapitel behandelt mögliche Wege zur Stärkung des EAD und zur Überwindung der bestehenden Probleme. Es wird darauf eingegangen, wie der EAD als starke Institution etabliert werden kann, die unabhängig von Einzelinteressen die europäischen Interessen in der Welt vertritt. Mögliche Reformvorschläge werden im Lichte des neoliberalen Institutionalismus analysiert, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit von Kompromissen und der Berücksichtigung nationaler Interessen.
Schlüsselwörter
Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD), Neoliberaler Institutionalismus, Supranationalität, Intergouvernementale Zusammenarbeit, nationale Interessen, Außenpolitik der EU, Internationale Beziehungen, Kooperation, Institutionen, Reformvorschläge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen bei der Etablierung eines starken Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und untersucht die Gründe für dessen bisherige unzureichende Entwicklung. Das Hauptziel ist die Aufzeigen von Möglichkeiten zur Stärkung des EAD, um eine effektive Vertretung europäischer Interessen zu gewährleisten.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit verwendet den Neoliberalen Institutionalismus als analytisches Werkzeug. Dieser Ansatz wird im Detail erläutert, seine zentralen Prinzipien werden im Kontext des EAD angewendet und im Vergleich zum Neorealismus dargestellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss nationaler Interessen auf die Entwicklung des EAD, die rechtlichen Grundlagen und die Struktur des EAD innerhalb der EU, Möglichkeiten zur Stärkung des EAD und zur Überwindung interner Konflikte, sowie die Rolle der Mitgliedsstaaten bei der Gestaltung des EAD.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Ansatz (Neoliberaler Institutionalismus), ein Kapitel zum Europäischen Auswärtigen Dienst (Rechtliche Grundlagen, Entstehung, Struktur), und abschließend ein Kapitel zu Wegen zur Stärkung des EAD. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Einleitung?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die mangelnde Effektivität des EAD. Sie verdeutlicht die Diskrepanz zwischen hohen Erwartungen und ernüchternder Zwischenbilanz und skizziert den Aufbau der Arbeit mit den zentralen Forschungsfragen.
Was wird im Kapitel zum Theoretischen Ansatz (Neoliberaler Institutionalismus) erläutert?
Dieses Kapitel beschreibt den Neoliberalen Institutionalismus als Reaktion auf den Neorealismus, untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze und beleuchtet die Rolle internationaler Institutionen (Lastenausgleich, Informationsfunktion, Koordinationsfunktion, Disziplinarfunktion) für effektive Kooperation.
Was wird im Kapitel zum Europäischen Auswärtigen Dienst behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Entstehung und die Struktur des EAD innerhalb der EU. Es untersucht die Herausforderungen bei der Schaffung eines kohärenten außenpolitischen Handlungsvermögens und die Auswirkungen der strukturellen Verortung auf dessen Handlungsfähigkeit.
Welche Wege zur Stärkung des EAD werden vorgeschlagen?
Das letzte Kapitel erörtert mögliche Wege zur Stärkung des EAD und zur Überwindung bestehender Probleme. Es analysiert Reformvorschläge im Lichte des neoliberalen Institutionalismus unter Berücksichtigung von Kompromissen und nationaler Interessen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD), Neoliberaler Institutionalismus, Supranationalität, Intergouvernementale Zusammenarbeit, nationale Interessen, Außenpolitik der EU, Internationale Beziehungen, Kooperation, Institutionen, Reformvorschläge.
- Quote paper
- Benedikt Simon Feld (Author), 2013, Der Europäische Auswärtige Dienst als Spielball nationaler Interessen. Reformvorschläge im Spiegel des Neoliberalen Institutionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283124