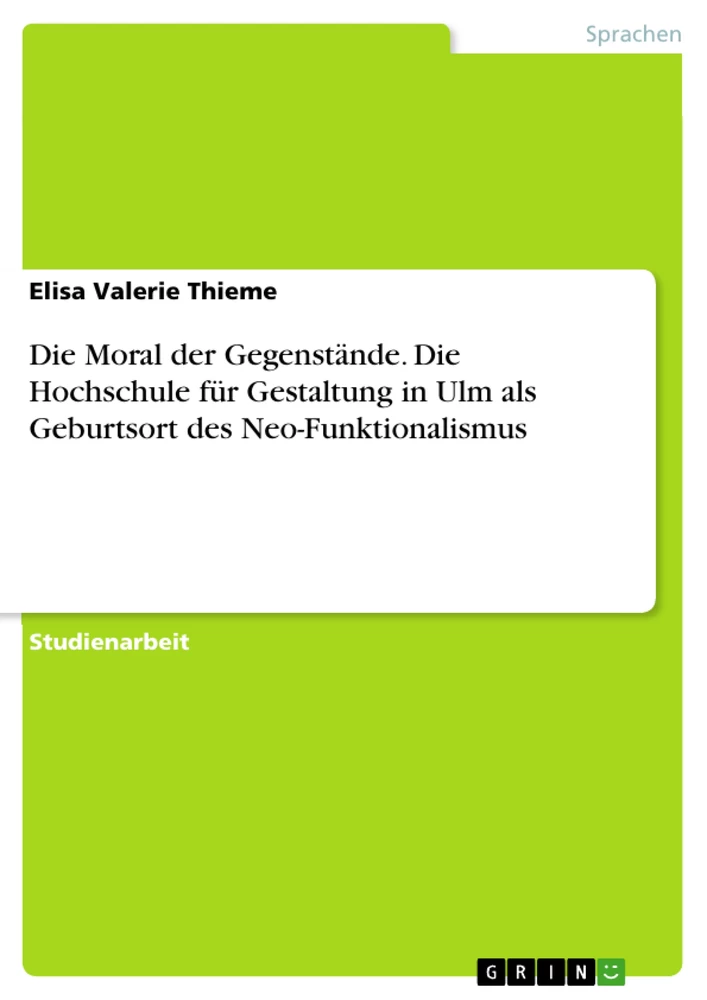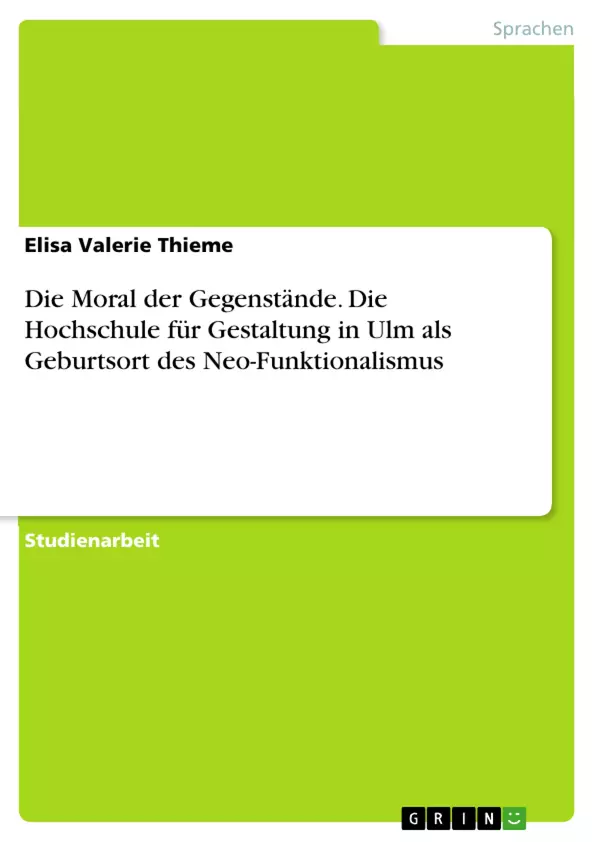Es gibt sie nicht mehr. Und es gab sie nicht lange. Mehr als fünfzig Jahre sind seit Gründung und auch Schließung der Hochschule für Gestaltung in Ulm vergangen. Trotz ihres relativ kurzen Bestehens von gerade einmal fünfzehn Jahren, ist sie bis heute eine international anerkannte Institution, die nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Berufsbildes des Designers hatte.
Es stellt sich die Frage, wie es dazu kam, dass eine in der Kleinstadt Ulm ansässige, private und nur für die Ausbildung von 150 Studierenden ausgelegte Bildungsstätte derartigen Ruhm erlangen konnte. Sie wird bis heute gerne mit Attributen wie „ausgesprochen progressiv“, „avantgardistisch“ oder auch „legendär“ versehen. Was war das Einzigartige dieser Institution? Welches ideologische Konzept lag ihr zugrunde und wie wurde es verwirklicht? Warum existiert sie nicht mehr?
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Besonderheiten der HfG Ulm als Ausbildungsort von Gestaltern, der Schaffungsstätte neuartiger, hochwertiger Produkte und dem Treffpunkt von bedeutender Personen wie beispielsweise dem Bauhäusler Max Bill, dem Maler und Kunsttheoretiker Johannes Itten und dem Designer Hans Gugelot auseinander.
Ausgangspunkt der Untersuchung bildet das der HfG zugrunde liegende pädagogische und ideologische Konzept und dessen Auswirkung auf das konkrete Ausbildungsprogramm der Studierenden. Am Beispiel des „Ulmer Hockers“ wird die am Produkt verwirklichte Ulmer Ideologie der moralisierenden Askese im Folgenden erläutert. Um die formalen Richtlinien bezüglich des Umfangs der Arbeit nicht überstrapazieren zu müssen, wird die Arbeit der Abteilungen „Visuelle Kommunikation“, „Information“, „Film“ und „Industrielles Bauen“ ausgeklammert.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsbericht
- Geschichtlicher Abriss
- Pädagogische und Ideologische Grundlage
- Die pädagogische und ideologische Grundlage der HfG
- Ulmer Modell
- Die verschiedenen Abteilungen der HfG
- Objekte
- Ulmer Stil oder: Die moralisierende Wirkung ästhetisch-asketischer Gebrauchsgegenstände
- Der „Ulmer Hocker“ als Verkörperung der Ulmer Ideologie der moralisierenden Askese:
- Ulm: Das grandiose Scheitern eines außerordentlichen Konzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm, ihre Entstehung, ihr pädagogisches und ideologisches Konzept sowie ihre Auswirkungen auf das Design. Sie analysiert die HfG als Ausbildungsort für Gestalter, als Schaffenstätte neuer Produkte und als Treffpunkt wichtiger Persönlichkeiten.
- Die pädagogische und ideologische Grundlage der HfG Ulm
- Die Rolle von Max Bill und die Entwicklung des „Ulmer Stils“
- Die Auswirkung der HfG auf das Berufsbild des Designers
- Die Gründe für die Schließung der HfG Ulm
- Die Bedeutung der HfG Ulm für die Designentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Forschungsbericht beleuchtet die HfG Ulm als einflussreiche Institution, die trotz ihres kurzen Bestehens nachhaltigen Einfluss auf die Designentwicklung hatte. Der geschichtliche Abriss zeichnet die Entstehung der HfG Ulm im Kontext der Nachkriegszeit nach, wobei die Rolle von Otl Aicher und Inge Scholl hervorgehoben wird. Das Kapitel über die pädagogische und ideologische Grundlage der HfG Ulm untersucht die Ziele der Hochschule, die sich auf die Ausbildung einer neuen Generation von Designern mit einem demokratischen und rationalen Verständnis von Design konzentrierten.
Schlüsselwörter
Hochschule für Gestaltung Ulm, Neo-Funktionalismus, Max Bill, Ulmer Stil, Gestaltung, Produktdesign, Designpädagogik, moralisierende Askese, demokratisches Denken, Nachkriegszeit.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Besondere an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm?
Sie galt als die progressivste Design-Schmiede der Nachkriegszeit, die das Berufsbild des Designers durch rationale und demokratische Ansätze (Neo-Funktionalismus) weltweit prägte.
Welche Rolle spielte Max Bill an der HfG Ulm?
Max Bill, ein ehemaliger Bauhäusler, war Mitbegründer und erster Rektor. Er prägte die pädagogische Grundlage und den ästhetischen Anspruch der Schule entscheidend mit.
Was symbolisiert der "Ulmer Hocker"?
Der Ulmer Hocker verkörpert die Ulmer Ideologie der "moralisierenden Askese": ein multifunktionaler, schlichter und hochwertiger Gebrauchsgegenstand ohne unnötiges Ornament.
Warum wurde die HfG Ulm 1968 geschlossen?
Die Schließung war das Resultat politischer Differenzen, finanzieller Probleme und interner Konflikte über die zukünftige ideologische Ausrichtung der Gestaltung.
Was versteht man unter dem "Ulmer Stil"?
Der Ulmer Stil steht für Neo-Funktionalismus: Design, das auf wissenschaftlichen Methoden, technischer Präzision und gesellschaftlicher Verantwortung basiert.
- Citation du texte
- B.A. Elisa Valerie Thieme (Auteur), 2011, Die Moral der Gegenstände. Die Hochschule für Gestaltung in Ulm als Geburtsort des Neo-Funktionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283210