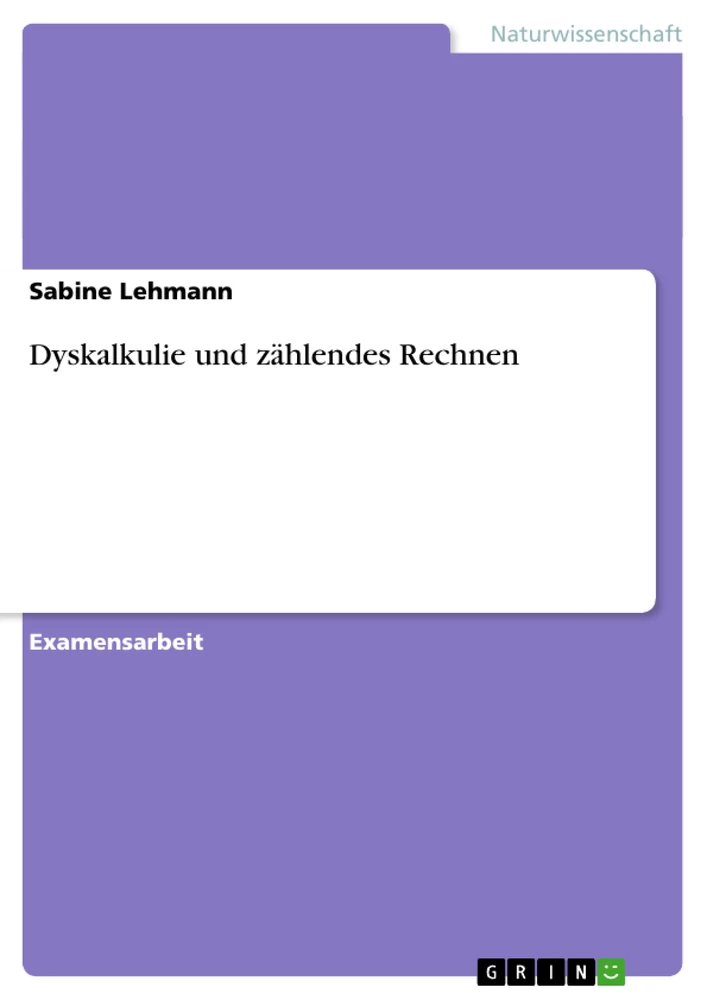Dyskalkulie ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer häufiger schon bei Grundschulkindern zu beobachten ist. Viele Menschen, sowohl Eltern als auch Lehrer1, zweifeln jedoch immer noch an seiner Existenz. Deshalb ist es wichtig vor allem Lehrer über die Existenz von Rechenschwäche aufzuklären, sie über Hintergründe und Ursachen zu informieren und ihnen allgemeine Präventions- und Fördermöglichkeiten zu zeigen. Ich hoffe, dass diese Arbeit dazu einen Beitrag leisten kann.
Im Sommersemester 2002 besuchte ich an der … die Veranstaltung „Fördern und Differenzieren im Mathematikunterricht der Grundschule“, welche von Herrn … geleitet wurde. Neben allgemeinen Grundsätzen, Methoden und Arbeitsformen differenzierenden und fördernden Unterrichts wurden spezielle Probleme dargestellt, die der Unterricht mit rechenschwachen Kindern bereitet. Zudem wurden besondere Methoden, Veranschaulichungen und Lernstandsfeststellungsmöglichkeiten dargestellt, ausprobiert und verglichen.
Im folgenden Semester besuchte ich dann die gleichnamige, praktische Übung mit rechenschwachen Kindern, in der ich die Möglichkeit erhielt, das erworbene theoretische Wissen auch in der Praxis zu erproben. Ca. 20 rechenschwache Schüler aus mehreren Grundschulen kamen während des Semesters einmal in der Woche und wurden von etwa 30 Studentinnen unter der Leitung von Herrn … beobachtet und gefördert. Die Kinder wurden in Zweiergruppen eingeteilt, in denen sie dann jeweils von zwei oder drei Studentinnen 60 Minuten lang betreut wurden. Die folgenden 30 Minuten des Seminars wurden zur Nachbesprechung genutzt.
Einige Zeit später vermittelte mir Herr … das Mädchen Nadine, das einer Förderung bedarf. Seitdem fördere ich Nadine jeden Freitag je eine Schulstunde.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in eine theoretische Grundlegung der Dyskalkulie und in die Fallstudie von Nadine. Im Detail ist die Arbeit in folgender Form aufgebaut:
Im zweiten Kapitel wird zunächst die Begrifflichkeit geklärt und einige Definitionen verschiedener Autoren angeführt, bevor einige Symptome der Dyskalkulie aufgezeigt werden und intensiv auf die Ursachenklärung eingegangen wird. Auch das dritte Kapitel, welches sich mit dem Teufelskreis beschäftigt, trägt zur Ursachenklärung bei. Anschließend wird im vierten Kapitel ein sehr häufig auftretendes Symptom der Dyskalkulie, das zählende Rechnen, genauer beschrieben.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dyskalkulie
- Begriffsklärung
- Definition
- Störungsbilder der Dyskalkulie
- Grundfähigkeiten des Rechnens und deren Störungen
- Weitere Ursachen für Dyskalkulie
- Ursachen aus dem Bereich der Schule
- Ursachen aus dem persönlichen Umfeld des Kindes
- Ursachen, die im Kind liegen
- Teufelskreis
- Erstes Stadium: Ein Defizit beginnt zu wirken
- Attribuierung (Stigmatisierung)
- Repression
- Darstellung der Situation im ersten Stadium
- Zweites Stadium: Bildung der ersten Reaktionen beim Kind
- Drittes Stadium: Leistungsstörungen treten auf
- Viertes Stadium: Aufbau einer stabilen misserfolgsorientierten Motivationslage
- Erstes Stadium: Ein Defizit beginnt zu wirken
- Zählendes Rechnen
- Lösungsstrategien beim Addieren/Subtrahieren im Zahlenraum bis 20
- Zählstrategien
- Heuristische Strategien
- Kennen der Grundaufgabe
- Vorzüge des zählenden Rechnens
- Probleme des zählenden Rechnens
- Ursachen des zählenden Rechnens
- Mögliche Prävention des zählenden Rechnens
- Simultane (gliedernde, nicht zählende) Erfassung der Anzahlen bis 10
- Simultane Anzahlenerfassung bei Punktemustern
- Systemischer Aufbau der simultanen Zahlenerfassung bis 10
- Handlungen und Vorstellungsbilder des Addierens/Subtrahierens im Zahlenraum bis 10
- Einführung des Zahlenraums bis 20
- Zehnerüberschreitung mit Zerlegung des Operationsschritte
- Lehrstrategie zur Automatisierung des kleinen Einsundeins
- Simultane (gliedernde, nicht zählende) Erfassung der Anzahlen bis 10
- Fördermöglichkeiten
- Lösungsstrategien beim Addieren/Subtrahieren im Zahlenraum bis 20
- Allgemeine Fördermaßnahmen
- Fallstudie Nadine
- Anamnese
- Die Person Nadine
- Die familiäre Situation
- Die schulische Situation
- Das Mathematikprofil von Nadine
- Darstellung des Testverfahrens
- Zahl- und Operationsverständnis
- Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20
- Beobachtungen
- Zusammenfassung der Testergebnisse
- Fördermöglichkeiten
- Darstellung des Testverfahrens
- Nadines Zählstrategien
- Förderverlauf und Hilfsmittel
- Eingesetzte Fördermaterialien
- Zwanzigerrechenrahmen
- Domino
- Steckwürfel
- Wechselspiel
- Darstellung einer Förderstunde
- Entwicklung von Nadines mathematischen Fähigkeiten
- Eingesetzte Fördermaterialien
- Anamnese
- Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Dyskalkulie, insbesondere mit der Problematik des zählenden Rechnens. Die Arbeit soll Lehrer über die Existenz von Rechenschwäche aufklären, Informationen zu Hintergründen und Ursachen liefern sowie allgemeine Präventions- und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
- Definition und Störungsbilder der Dyskalkulie
- Ursachen der Dyskalkulie, einschließlich schulischer, familiärer und individueller Faktoren
- Der Teufelskreis der Dyskalkulie und seine Auswirkungen auf das Lernen
- Zählendes Rechnen als ein häufiges Symptom der Dyskalkulie und seine Auswirkungen auf den Lernerfolg
- Fördermöglichkeiten für Kinder mit Dyskalkulie, insbesondere im Bereich des zählenden Rechnens
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die Begrifflichkeit der Dyskalkulie und erläutert verschiedene Definitionen. Es werden die Störungsbilder der Dyskalkulie dargestellt und intensiv auf die Ursachenklärung eingegangen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Teufelskreis der Dyskalkulie und trägt zur Ursachenklärung bei. Im vierten Kapitel wird das zählende Rechnen als häufiges Symptom der Dyskalkulie beschrieben, inklusive seiner Vor- und Nachteile. Es werden Ursachen des zählenden Rechnens untersucht und verschiedene Präventionsmöglichkeiten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, zählendes Rechnen, Fördermöglichkeiten, Prävention, Grundfähigkeiten des Rechnens, Zahlenraum, Teufelskreis, Mathematikunterricht, Fallstudie, Lernförderung.
Häufig gestellte Fragen zu Dyskalkulie
Was ist Dyskalkulie?
Dyskalkulie oder Rechenschwäche bezeichnet gravierende Schwierigkeiten beim Erlernen grundlegender mathematischer Fähigkeiten trotz normaler Intelligenz.
Warum ist zählendes Rechnen ein Problem?
Wenn Kinder Zahlen nur als Abfolge von Zählschritten verstehen, entwickeln sie kein echtes Mengen- und Operationsverständnis, was bei größeren Zahlenräumen zum Scheitern führt.
Was ist der „Teufelskreis der Dyskalkulie“?
Er beschreibt die Spirale aus fachlichen Defiziten, schulischem Misserfolg, Stigmatisierung und dem Aufbau einer stabilen Versagensangst beim Kind.
Wie kann man zählendes Rechnen verhindern?
Durch die Förderung der simultanen Anzahlerfassung (z. B. Punktemuster) und den Einsatz von strukturierten Materialien wie dem Zwanzigerrechenrahmen.
Welche Ursachen für Dyskalkulie gibt es?
Die Ursachen sind vielfältig und können im persönlichen Umfeld, in der schulischen Vermittlung oder in individuellen kognitiven Voraussetzungen des Kindes liegen.
- Citar trabajo
- Sabine Lehmann (Autor), 2003, Dyskalkulie und zählendes Rechnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28335