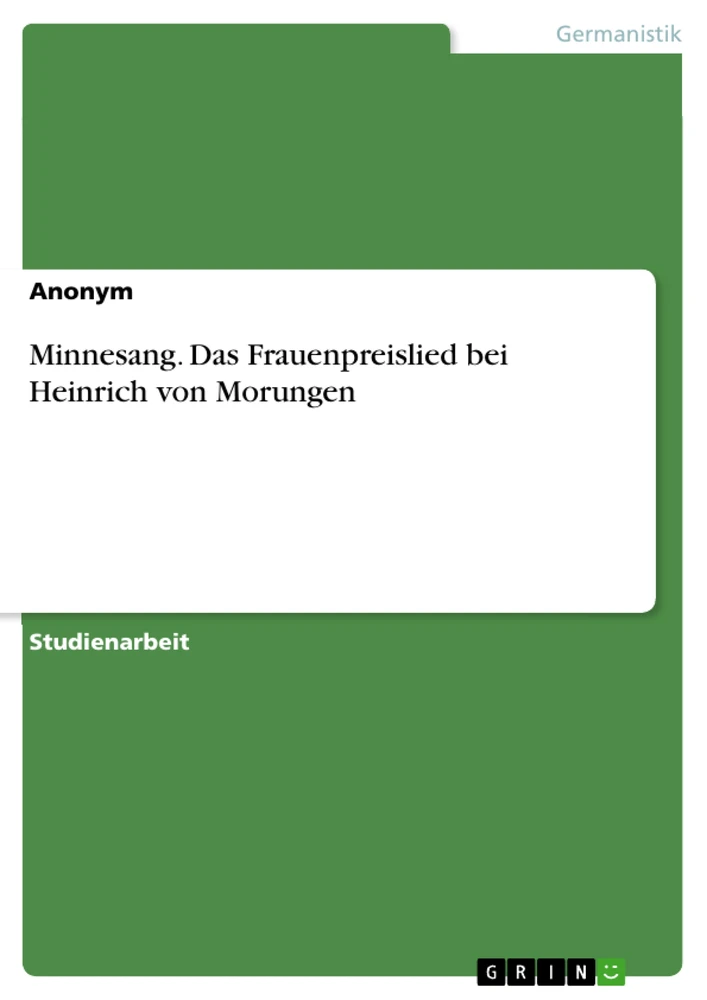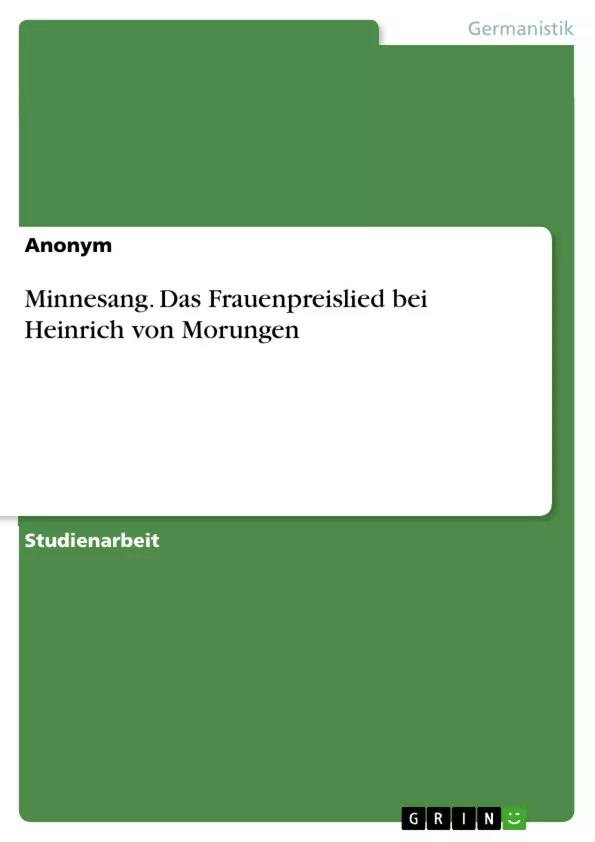Wer sich mit dem Minnesang des 12. Jahrhunderts und einem seiner Vertreter, Heinrich von Morungen, befasst, wird in der Forschungsliteratur immer wieder auf ein berühmtes Zitat aus einem seiner Liedern stoßen: „wan ich wart dur sî und durch anders niht geboren“ (MF 134,30) . Oft wird dieses Zitat als eine Selbstaussage des Dichters gedeutet, und in der Tat weist das Zitat ein Charakteristikum seines Œuvres auf. Das Zitat „Denn für sie allein wurde ich geboren“, das Helmut von Tervooren als „Kernsatz [Morungens] lyrischen Schaffen[s]“ bezeichnet, demonstriert das ausschließliche Thema seiner Lieder, nämlich die „fast monomanische Zentrierung des lyrischen Ichs auf die Minneherrin sowie seine als existenziell empfundene Abhängigkeit von ihr“. Denn die Existenz des Sängers beruht nur darauf, die Auserwählte zu preisen und um sie zu werben, selbst wenn es keinerlei Hoffnung darauf gibt, dass diese ihn erhört. Hierbei nimmt die angebetete Dame eine besondere Stellung bei Heinrich von Morungen ein. Denn anders wie bei den vorherigen Dichtern, ist Morungen der erste Dichter des deutschen Minnesangs, der die weibliche Schönheit der Frau in ihren Einzelzügen beschreibt, und auf sie nicht nur durch Beiwörter und kurze Vergleiche in seinen Liedern hindeutet. In der folgenden Arbeit soll nun diese Neuerung Morungens anhand einer Analyse zweier Lieder näher erläutert werden. Hierbei sollen vor allem die Lieder des sogenannten Frauenpreises untersucht werden, da hier der Sänger besonders ein Augenmerk auf die Schönheit der Herrin legt.
Zunächst wird jedoch ein kurzer Einblick in die wenig biographischen Informationen, die zu dem Dichter bekannt sind, erfolgen. Im zweiten Teil soll allgemein die Theorie der Minnelyrik erklärt werden. Im Anschluss daran soll auf ein spezifisches Thema der Minnelyrik eingegangen werden, nämlich den Frauenpreis, und inwieweit dabei Morungen eine Rolle spielt. Der letzte Teil der Arbeit wird sich schließlich ausschließlich der Analyse der Lieder 122,1 und 140,32 widmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Biographie Heinrich von Morungens
- Die Theorie von der Hohen Minne
- Der Frauenpreis in der Minnekanzone
- Der Frauenpreis bei Heinrich von Morungen
- Analyse der Lieder 122,1 und 140,32
- Lied 122,1
- Lied 140,32
- Die Lieder 122,1 und 140,32 im Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Frauenpreis bei Heinrich von Morungen, einem bedeutenden Vertreter des klassischen Minnesangs. Sie untersucht, wie Morungens Werk durch die Darstellung der weiblichen Schönheit in ihren Einzelzügen eine Neuerung im deutschen Minnesang darstellt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse zweier Lieder, die den Frauenpreis als zentrales Motiv aufweisen.
- Die Besonderheit des Frauenpreises bei Heinrich von Morungen
- Die Analyse zweier Lieder, die sich mit dem Frauenpreis befassen
- Die Einordnung des Frauenpreises in die Theorie der Hohen Minne
- Die Bedeutung der Biographie Heinrich von Morungens für sein Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Zitates „wan ich wart dur sî und durch anders niht geboren“ (MF 134,30) für das Werk von Heinrich von Morungen. Das zweite Kapitel bietet einen kurzen Einblick in die Biographie des Dichters, die aufgrund der wenigen verfügbaren Quellen nur lückenhaft ist. Der dritte Teil beleuchtet die Theorie der Hohen Minne und deren Bedeutung für das Verständnis des Minnesangs im 12. und 13. Jahrhundert. Im vierten Kapitel wird der Frauenpreis in der Minnekanzone untersucht, wobei auch auf die Rolle von Morungen im Kontext dieser Entwicklung eingegangen wird. Die Analyse der Lieder 122,1 und 140,32 im fünften Kapitel bildet den Kern der Arbeit und untersucht die Darstellung der weiblichen Schönheit und den Frauenpreis in den ausgewählten Liedern.
Schlüsselwörter
Heinrich von Morungen, Minnesang, Frauenpreis, Hohe Minne, Minnekanzone, Liedanalyse, weibliche Schönheit.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Neuerung von Heinrich von Morungen im Minnesang?
Morungen war der erste deutsche Minnesänger, der die weibliche Schönheit in ihren Einzelzügen detailliert beschrieb, anstatt sie nur durch allgemeine Beiwörter anzudeuten.
Was bedeutet das Zitat „wan ich wart dur sî und durch anders niht geboren“?
Es bedeutet „Denn nur für sie wurde ich geboren“. Es verdeutlicht die existenzielle Abhängigkeit des lyrischen Ichs von der Minneherrin, deren Preis das einzige Lebensziel des Sängers ist.
Was versteht man unter „Hoher Minne“?
Die Hohe Minne ist das Ideal einer unerreichbaren, meist adligen Dame, um die der Sänger wirbt. Der Dienst an der Dame dient der moralischen Veredelung des Mannes, auch wenn die Liebe unerfüllt bleibt.
Welche Rolle spielt der Frauenpreis in Morungens Liedern?
Der Frauenpreis ist ein zentrales Motiv, bei dem die physische und charakterliche Vollkommenheit der Herrin gepriesen wird, um die monomanische Zentrierung des Sängers auf seine Auserwählte auszudrücken.
Welche Lieder werden in der Arbeit detailliert analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Lieder 122,1 und 140,32, um Morungens spezifische Technik der Schönheitsbeschreibung und des Frauenpreises zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Minnesang. Das Frauenpreislied bei Heinrich von Morungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283565