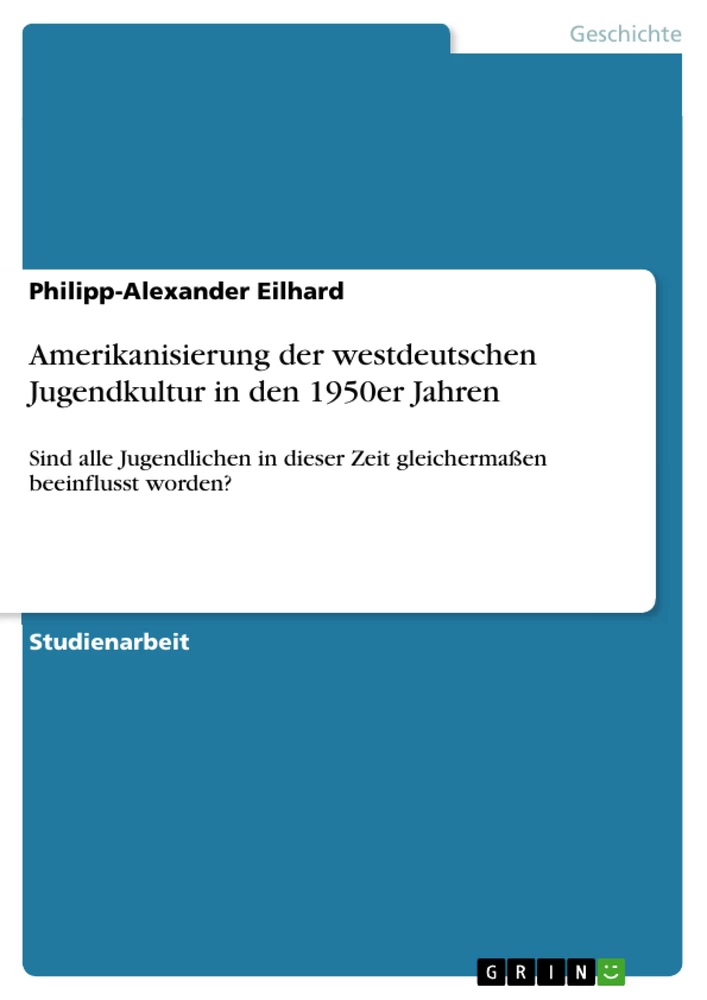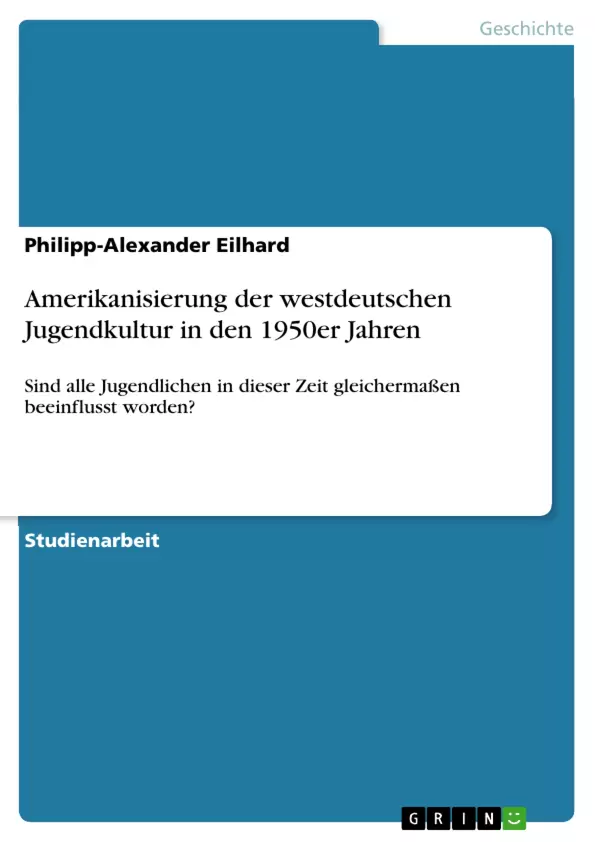Mit der Aufteilung Deutschlands durch die Alliierten nach Beendigung der Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges, nahm der Einfluss der Siegermächte in den jeweils besetzten Gebieten deutlich zu.
Die Vereinigten Staaten von Amerika waren für den westdeutschen Bereich nicht nur eine reine Besatzungsmacht, vielmehr galten die stationierten Truppen als wichtige Impulsgeber für eine durch Krieg, Hunger, Angst und Diktatur gezeichnete deutsche Bevölkerung. Die Menschen waren auf der Suche nach einer neuen Identität und folglich wurden demokratische Gesellschaften zum Vorbild der Bevölkerung der noch jungen Bundesrepublik auserwählt.
Die amerikanischen Truppen in den besetzten westdeutschen Gebieten lebten der ansässigen Bevölkerung stets ihren „American Way of Life“ vor, doch nicht nur ihre materielle Präsenz, sondern auch deren „Wohlgenährtheit“, ihre technisch überlegene Ausrüstung, die mitgeführten Nahrungsmittel sowie die stets souveräne Lässigkeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen, waren es, die die deutsche Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, an den Besatzungstruppen faszinierten.
Durch die amerikanische Präsenz und die gewollte gesellschaftliche „Umerziehung“ wurde die Alltagswelt der Bevölkerung in den 1950er-Jahren durch zahlreiche Importe von US-Populärkultur und -Produkten regelrecht überflutet, wodurch die Vereinigten Staaten von Amerika in relativ kurzer Zeit zu einer Leitfigur für die westdeutschen Bürger und speziell für die Kinder und Jugendlichen aufstieg.
Viele Familien wurden durch den Krieg getrennt: Frauen verloren ihre Ernährer, Kinder wuchsen ohne ihre Väter auf, da diese entweder im Krieg gefallen waren oder als vermisst galten und nicht mehr zurückkehrten. Diese Kinder waren nicht nur auf der Suche nach neuen Vorbildern, sondern vielmehr nach ihrer eigenen Identität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Amerikanisierung“ in Abgrenzung zur „Westernisierung“
- „Amerikanisierung“
- „Westernisierung“
- Die Gesamtgesellschaft Westdeutschlands in den 1950er-Jahren
- Überblick über die Jugend- und Subkultur der 1950er-Jahre
- Beschreibung der Subkulturen der Halbstarken & „Exis“
- Die Halbstarken
- Die Exis(-tentiellen)/Existentialisten
- Vergleichende Analyse der beiden Subkulturen
- Halbstarkenbewegung
- Die „Exis[tentiellen]“
- Vergleich der Merkmale beider Strömungen
- Exkurs „Mädchen & Junge Frauen“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Amerikanisierung der westdeutschen Jugendkultur in den 1950er-Jahren. Sie untersucht, inwieweit die Bewegungen der „Halbstarken“ und der „Exis[tentiellen]“ durch den „American Way of Life“ beeinflusst wurden und ob diese Bewegungen unterschiedliche Grade der Amerikanisierung aufweisen.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Amerikanisierung“ und „Westernisierung“
- Analyse der westdeutschen Gesamtgesellschaft in den 1950er-Jahren
- Beschreibung und vergleichende Analyse der Subkulturen der „Halbstarken“ und „Exis[tentiellen]“
- Untersuchung der Rolle von „Symbolizität“ und „Soziabilität“ in den genannten Subkulturen
- Beantwortung der Kernfrage: „Sind alle Jugendlichen der 1950er-Jahre durch den 'American Way of Life' gleichermaßen beeinflusst worden?“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt die Kernfrage der Arbeit ein. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Amerikanisierung“ und „Westernisierung“ und grenzt sie voneinander ab. Kapitel 3 bietet einen Überblick über die westdeutsche Gesamtgesellschaft in den 1950er-Jahren. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Jugend- und Subkultur der 1950er-Jahre. Kapitel 5 beschreibt die Subkulturen der „Halbstarken“ und „Exis[tentiellen]“. Kapitel 6 analysiert die beiden Subkulturen vergleichend und untersucht, inwiefern sie durch den „American Way of Life“ beeinflusst wurden. Kapitel 7 widmet sich dem Thema „Mädchen & Junge Frauen“ im Kontext der Jugendkultur der 1950er-Jahre.
Schlüsselwörter
Amerikanisierung, Westernisierung, Jugendkultur, Subkultur, Halbstarken, Exis[tentiellen], „American Way of Life“, 1950er-Jahre, Westdeutschland, Symbolizität, Soziabilität
Häufig gestellte Fragen zur Amerikanisierung in den 1950ern
Was ist der Unterschied zwischen Amerikanisierung und Westernisierung?
Amerikanisierung bezieht sich spezifisch auf den Import von US-Populärkultur, während Westernisierung die allgemeine Angleichung an westliche, demokratische Werte beschreibt.
Warum wurden die US-Truppen für Jugendliche zu Vorbildern?
Die Soldaten verkörperten den "American Way of Life" durch materielle Überlegenheit, Souveränität, lässige Kleidung und moderne Produkte, was faszinierend auf die deutsche Nachkriegsjugend wirkte.
Wer waren die "Halbstarken"?
Die Halbstarken waren eine Jugend-Subkultur der 1950er Jahre, die durch auffälliges Verhalten, Lederjacken und Rock 'n' Roll den Protest gegen die Elterngeneration ausdrückte.
Was zeichnete die Subkultur der "Exis" aus?
Die "Exis" (Existentialisten) waren eher intellektuell geprägt und orientierten sich an französischer Philosophie und schwarzer Kleidung, zeigten aber ebenfalls Abgrenzungstendenzen.
Waren alle Jugendlichen gleichermaßen amerikanisiert?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass der Grad der Beeinflussung durch den US-Lebensstil je nach sozialer Schicht und Subkultur variierte.
- Quote paper
- Philipp-Alexander Eilhard (Author), 2014, Amerikanisierung der westdeutschen Jugendkultur in den 1950er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283576