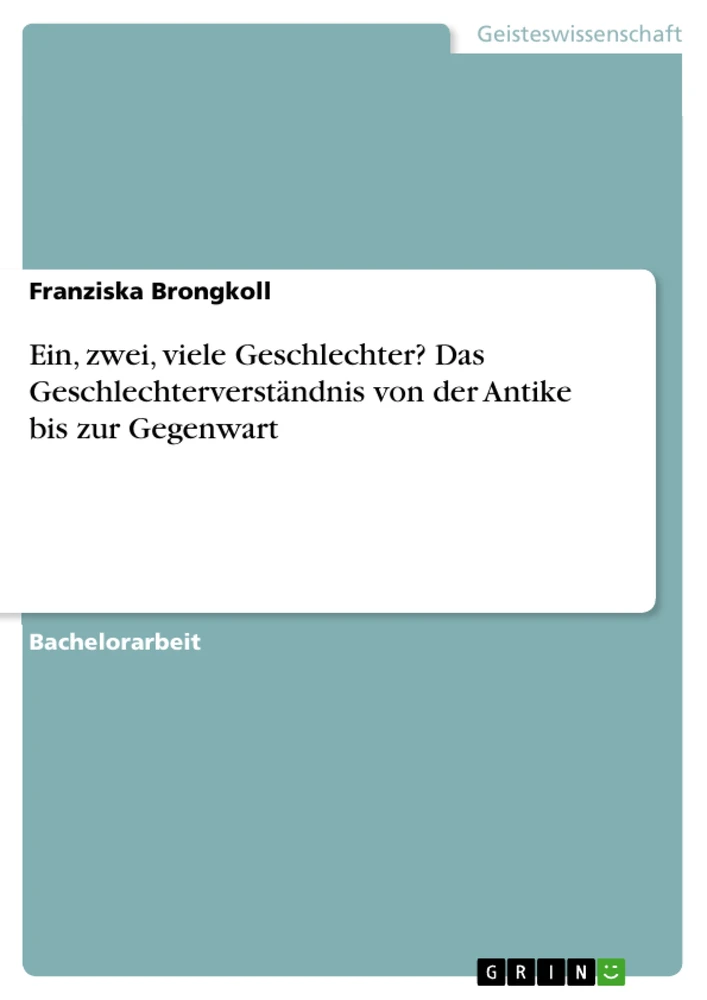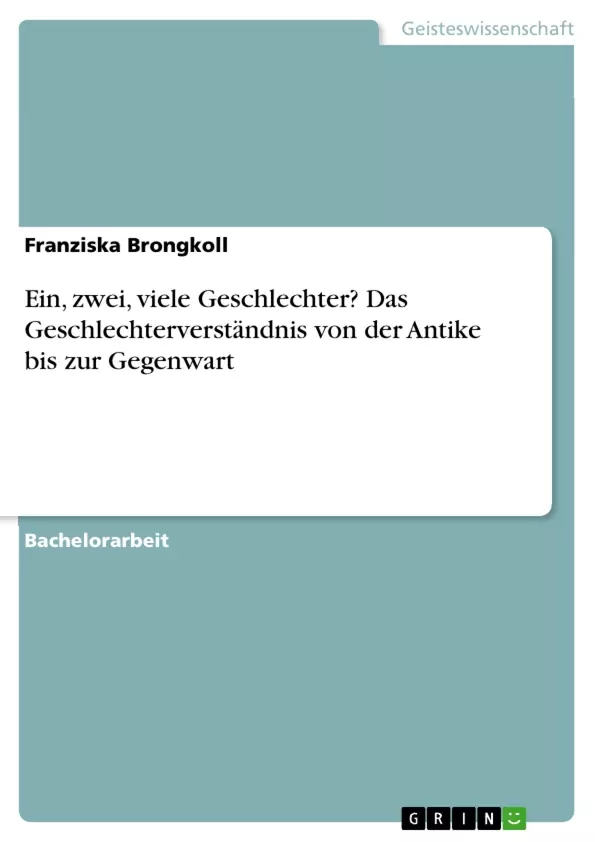Many People would agree […] that the sexes do not need to be explained and that, in fact, trying to explain the existence of two sexes can get in the way of understanding (Kessler und McKenna, 1978: VII).
As we got about our daily lives, we assume that every human being is either a male or a female. We make this assumption for everyone who ever lived and for every future human being (dies., 1978: 1)
Eigentlich ist das mit dem Geschlechterunterschied doch ganz einfach, oder nicht? Es gibt Frauen und es gibt Männer. Frauen haben eine Vagina, Männer einen Penis. Diese schlichte Unterscheidung nach dem biologischen Geschlecht (sex) war und ist bis heute aber nicht immer so simpel.
In der Geschlechterforschung ist oft von ‚Geschlechterkonstruktion‘ die Rede, die insbesondre in Anbetracht der historischen Entwicklung deutlich wird. In dieser Arbeit wird die Konzeption der Geschlechter von der Antike bis zur Gegenwart, gegliedert in vier nach Epochen unterteilten Kapiteln, betrachtet.
Als erstes wird die ‚Antike‘ behandelt, deren Gelehrte vor über zweitausend Jahren den Grundstein für die Geschlechterforschung gelegt haben. Wichtige Vertreter dieser Zeit waren zum Beispiel Aristoteles, der in seiner Einsamenlehre die Frau als ‚Missbildung‘ beschrieb, die lediglich eine Vorstufe des vollkommenen Mannes darstelle. Als zweites Beispiel dient Galen, der die Geschlechtsorgane von Frau und Mann als identisch definierte, die sich bloß in der Lage unterscheiden. Die weiblichen Genitalien seien dabei aufgrund von mangelnder Hitze nach innen gekehrt, die des Mannes hätten den perfekten, nach außen gekehrten Zustand erreicht.
Die zweite Epoche, die in dieser Arbeit behandelt wird, ist das ‚Mittelalter‘. In dieser Zeit bauten die Geschlechterkonstruktionen inhaltlich auf den antiken Theorien auf. Aufgrund der Sakralisierung wurden die Lehren durch religiöse, aber auch durch mystische Aspekte ergänzt.
Daran anschließend folgt in dieser Darstellung die Zeit der ‚Aufklärung‘. Damit geht ein Wendepunkt des Geschlechterverständnisses einher, der die altertümlichen Theorien mehr und mehr aus dem Diskurs vertrieb. Frauen und Männer werden nun als eigenständige Geschöpfe betrachtet, mit unterschiedlichen Geschlechtern. Die Forschung stützt sich größtenteils darauf, Differenzen anatomisch zu erklären. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Antike
- Die enkephalo-myelogene Samenlehre
- Die Wärmetheorie
- Die Rechts-Links-Theorie
- Die Pangenesislehre
- Die Hämatogene Samenlehre
- Die Zweisamenlehre
- Die Einsamenlehre
- Die weiblichen Hoden
- Die Lehre vom unterkühlten Mangelzustand der Frau
- Mittelalter
- Aufklärung
- Der natürliche Platz der Frau
- Präformationstheorien
- Epigenese
- Vollkommene weibliche Menschen
- Die chemische Physiologie
- Das evolutionsbedingte Geschlechterverständnis
- Das weibliche Skelett
- Gegenwart
- Das Geschlecht in der Embryonalentwicklung
- Hodenentwicklung
- Eierstockentwicklung
- Chromosomen und Gene
- Geschlecht als soziales Konstrukt
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Geschlechterrollen von der Antike bis zur Gegenwart. Sie untersucht die Entwicklung des Geschlechterverständnisses in vier Epochen und beleuchtet dabei die unterschiedlichen Theorien, die zur Erklärung der Geschlechterdifferenz aufgestellt wurden. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Frage, ob sich diese Theorien auf Analogien oder Differenzen der Geschlechter stützen und ob eine soziale Hierarchie der Geschlechter aus einem natürlichen, biologischen Unterschied resultiert.
- Historische Entwicklung des Geschlechterverständnisses
- Naturphilosophische und biologisch-medizinische Theorien zur Geschlechterdifferenz
- Analogien und Differenzen in der Geschlechterkonstruktion
- Soziale Konstruktion des Geschlechts im Kontext biologisch-medizinischer Theorien
- Bedeutung von antiken und aufklärerischen Theorien für das heutige Geschlechterverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Antike
Die Antike prägte das Verständnis von Geschlechterrollen mit dem sogenannten „Ein-Geschlecht-Modell“, welches die Frau als unvollkommene Version des Mannes betrachtete. Verschiedene Theorien, wie die enkephalo-myelogene Samenlehre, die Wärmetheorie und die Rechts-Links-Theorie, versuchten diese Hierarchie zu begründen und beeinflussten die Geschlechterordnung bis heute.
Mittelalter
Das Mittelalter baute auf den antiken Theorien auf und integrierte religiöse und mystische Aspekte in die Geschlechterkonstruktion. Die Frau blieb in dieser Zeit weiterhin als das „schwache Geschlecht“ definiert.
Aufklärung
Die Aufklärung brachte einen Wendepunkt im Geschlechterverständnis mit sich. Frauen und Männer wurden als eigenständige Geschöpfe mit unterschiedlichen Geschlechtern betrachtet. Die Forschung konzentrierte sich auf anatomische Unterschiede, wobei die Frau dennoch oft als „schwächer“ angesehen wurde. Die biologisch begründete Hierarchie war jedoch nicht mehr so stark ausgeprägt wie in früheren Jahrhunderten.
Schlüsselwörter
Geschlechterkonstruktion, Antike, Mittelalter, Aufklärung, Gegenwart, Ein-Geschlecht-Modell, biologisch-medizinische Theorien, soziale Konstruktion, Geschlechterrollen, Hierarchie, Anatomie, Embryonalentwicklung, Chromosomen, Gene.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Ein-Geschlecht-Modell“ der Antike?
Nach Galen und Aristoteles galt die Frau als unvollkommene Version des Mannes. Die Geschlechtsorgane wurden als identisch angesehen, nur dass sie bei der Frau nach innen gekehrt seien.
Wie veränderte die Aufklärung das Geschlechterverständnis?
In der Aufklärung setzte sich das „Zwei-Geschlechter-Modell“ durch. Frau und Mann wurden als anatomisch und physiologisch grundverschiedene Wesen definiert.
Welche Rolle spielten Chromosomen für das moderne Verständnis?
In der Gegenwart wird das biologische Geschlecht primär über Genetik (XX/XY) und die Embryonalentwicklung (Hoden- vs. Eierstockentwicklung) definiert.
Was bedeutet „Geschlecht als soziales Konstrukt“?
Es beschreibt die Theorie, dass Geschlechterrollen und -unterschiede nicht allein biologisch vorgegeben sind, sondern durch gesellschaftliche Erwartungen und Erziehung erzeugt werden.
Was besagte die „Wärmetheorie“ der Antike?
Man glaubte, Frauen fehle es an innerer Hitze, weshalb ihre Organe im Körperinneren blieben und sie dem Mann unterlegen seien.
- Quote paper
- Franziska Brongkoll (Author), 2014, Ein, zwei, viele Geschlechter? Das Geschlechterverständnis von der Antike bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283589