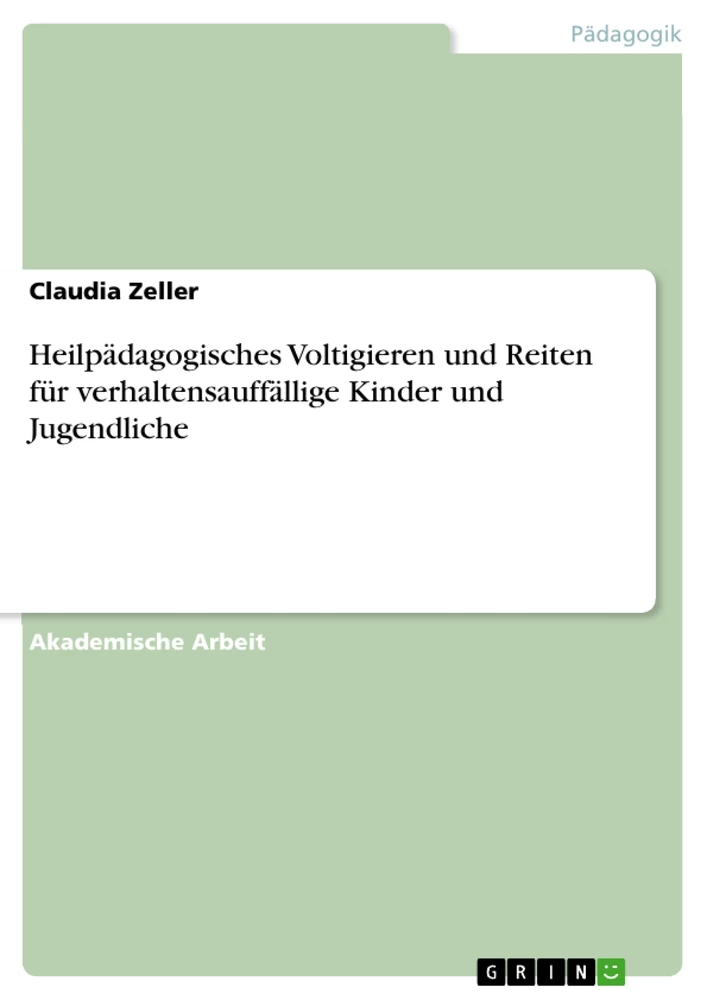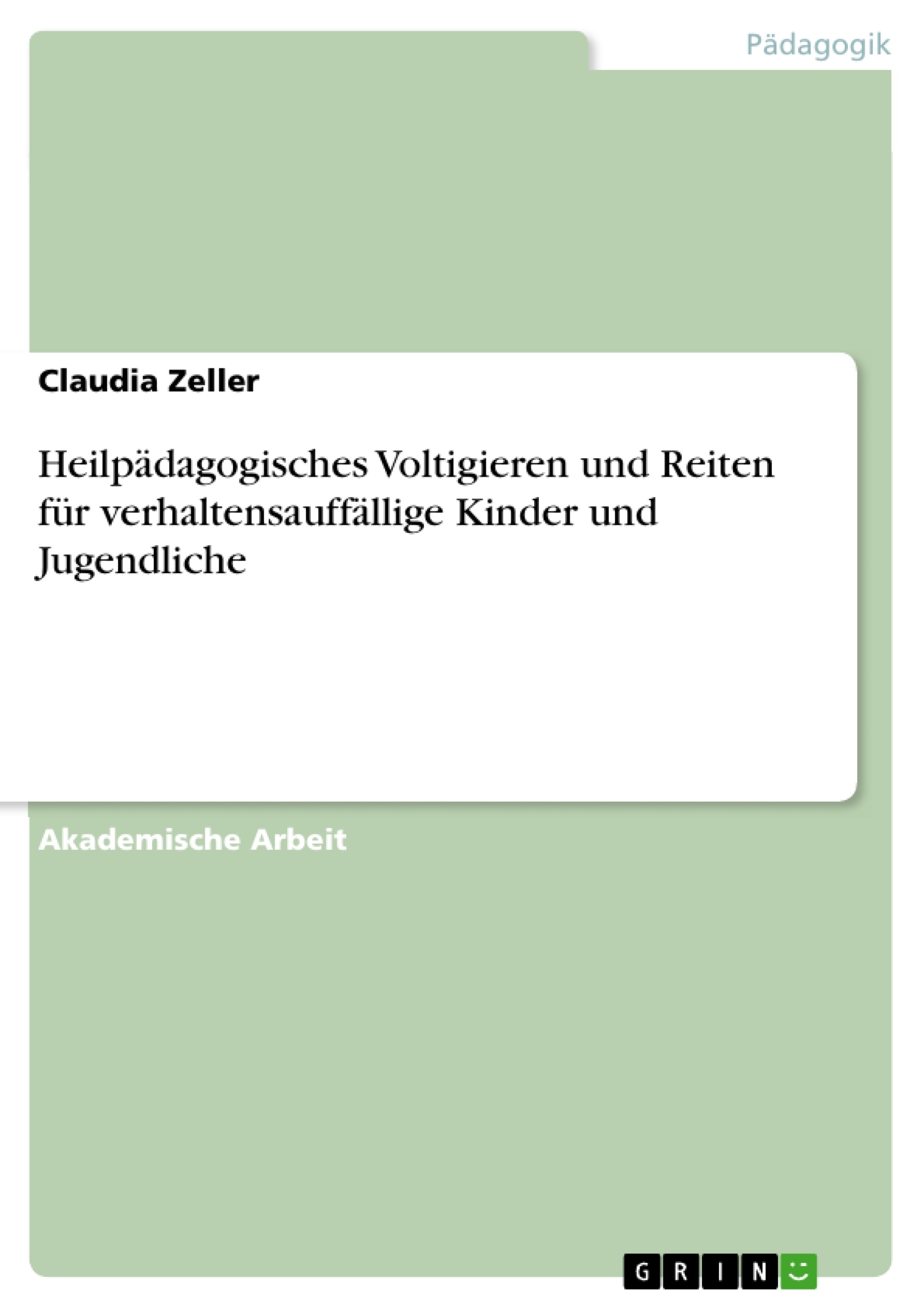In dieser Arbeit wird thematisiert, warum gerade Tiere und insbesondere Pferde in ihrem Einsatz zum Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten auf verhaltensauffällige Heranwachsende so stark wirken, daß die Heranwachsenden neue Verhaltensformen aufbauen können. Demgemäß begründet folgt eine detaillierte Schilderung Heilpädagogischen Reitens und Voltigierens. Seiner Entstehung, Geschichte und Definition schließen sich die beiden unterschiedlichen Ansätze des Einsatzes von Pferden in diesem Gebiet an. Außerdem wird den Ursachen der durch eine Kombination der beiden Ansätze zu erzielenden signifikanten Lernerlebnisse nachgegangen. Im zweiten Kapitel sind die sich aus dem humanistischen Verständnis ergebenden im Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren zu erfüllenden Grundvoraussetzungen, das übergeordnete Erziehungsziel des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens im Hinblick auf verhaltensauffällige Heranwachsende, das aus dem Erziehungsziel hervorgehende zu praktizierende Pädagogenverhalten, der wirksame Stundenstil und die durch ihn ermöglichte Lernmethode dargestellt. Das dritte Kapitel bezieht sich auf die Praxis Heilpädagogischen Reitens und Voltigierens. Die praktische Vorgehensweise, der Aufbau einer Voltigierstunde und die Möglichkeiten von Reiterspielen werden neben Voltigierübungen zur Schulung der Wahrnehmung bei verhaltensauffälligen Heranwachsenden geschildert. Des weiteren werden Überlegungen zu möglichen Durchführungsarten Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens angestellt und die Bedingungen, unter denen Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten an Schulen durchgeführt werden kann, aufgezeigt.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der materiellen Voraussetzungen des Heilpädagogischen Voltigierens/Reitens und einem abschließenden Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- Das Pferd als Lernhelfer für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche
- Darstellung tiergestützter Förderung und Therapie mit Hinweisen auf die besonderen Vorteile des Einsatzes von Pferden
- Heilpädagogisches Voltigieren als Durchführungsart psychomotorischer Übungsprogramme
- Heilpädagogisches Voltigieren und Heilpädagogisches Reiten
- Geschichte und Definition des Therapeutischen Reitens und des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens
- Zwei unterschiedliche Ansätze zur Nutzung des Einsatzes von Pferden: Heilpädagogisches Voltigieren und Heilpädagogisches Reiten
- Ursachen der durch eine Kombination des Heilpädagogischen Voltigierens und Heilpädagogischen Reitens gebotenen signifikanten Lernerlebnisse
- Klient-, Pferd- und Therapeutenzentrierung, das Erziehungsziel und das daraus hervorgehende Pädagogenverhalten, der Stundenstil und die Lernmethode
- Zur Praxis des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens
- Die praktische Vorgehensweise im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten, der Aufbau einer Voltigierstunde und die Möglichkeiten von Reiterspielen
- Voltigierübungen zur Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit bei verhaltensauffälligen Heranwachsenden
- Mögliche Durchführungsorte Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens zur Durchführung an Schulen
- Materielle Voraussetzungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Pferden im Bereich der Heilpädagogik, insbesondere im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten. Die Arbeit untersucht die besonderen Vorteile von Pferden als Lernhelfer für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche und analysiert die Entstehung und Entwicklung der beiden Ansätze. Darüber hinaus werden die pädagogischen und therapeutischen Aspekte des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens beleuchtet, einschließlich der Erziehungsziele, des Pädagogenverhaltens und der Lernmethoden.
- Die besonderen Vorteile des Einsatzes von Pferden im Bereich der Heilpädagogik
- Die Geschichte und Entwicklung des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens
- Die pädagogischen und therapeutischen Aspekte des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens
- Die praktische Umsetzung des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens
- Die Bedeutung des Tieres als Lernhelfer für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Darstellung tiergestützter Förderung und Therapie, wobei der Fokus auf die besonderen Vorteile des Einsatzes von Pferden liegt. Es wird die Entstehung und Entwicklung des Bereichs sowie die verschiedenen Ansätze des Einsatzes von Pferden in der Heilpädagogik erläutert.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die klient-, pferd- und therapeutenzentrierte Herangehensweise im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten. Es werden die Erziehungsziele, das Pädagogenverhalten, der Stundenstil und die Lernmethoden im Detail dargestellt.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Praxis des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens. Es werden die praktische Vorgehensweise, der Aufbau einer Voltigierstunde, die Möglichkeiten von Reiterspielen und die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit bei verhaltensauffälligen Heranwachsenden beschrieben.
Schlüsselwörter
Heilpädagogisches Voltigieren, Heilpädagogisches Reiten, tiergestützte Förderung, tiergestützte Therapie, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, Lernhelfer, Pferd, Mensch-Tier-Beziehung, Pädagogik, Therapie, Erziehungsziele, Pädagogenverhalten, Stundenstil, Lernmethoden, Wahrnehmung, Förderung, Kommunikation, Interaktion.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Pferde besonders gute Lernhelfer für verhaltensauffällige Kinder?
Pferde wirken durch ihre wertfreie Art und die notwendige Interaktion stark auf die Psyche, was den Aufbau neuer Verhaltensformen ermöglicht.
Was ist der Unterschied zwischen heilpädagogischem Voltigieren und Reiten?
Voltigieren konzentriert sich oft auf psychomotorische Übungen in der Gruppe, während beim Reiten die individuelle Einwirkung auf das Pferd im Vordergrund steht.
Welche Erziehungsziele verfolgt die heilpädagogische Arbeit mit Pferden?
Zu den Zielen gehören die Förderung der Wahrnehmung, die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit und die soziale Integration der Heranwachsenden.
Wie ist eine typische heilpädagogische Voltigierstunde aufgebaut?
Eine Stunde umfasst meist die Vorbereitung des Pferdes, gezielte Übungen auf dem Pferderücken sowie spielerische Elemente zur Wahrnehmungsschulung.
Kann heilpädagogisches Reiten auch an Schulen durchgeführt werden?
Ja, unter bestimmten materiellen und organisatorischen Voraussetzungen ist die Durchführung im schulischen Kontext möglich und sinnvoll.
- Citar trabajo
- Claudia Zeller (Autor), 2001, Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283738