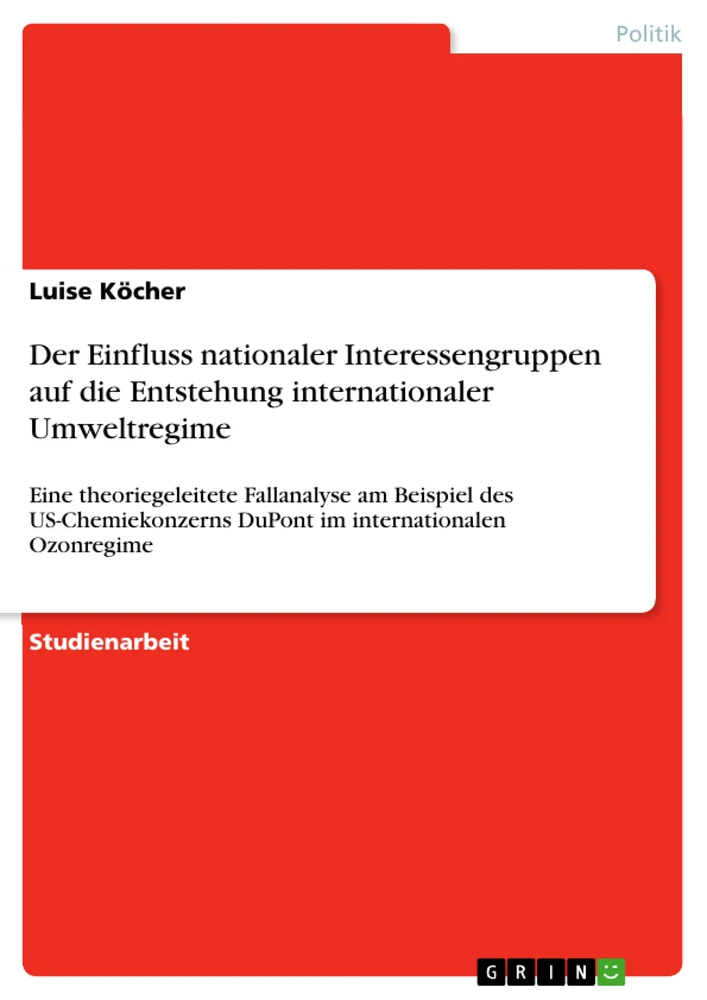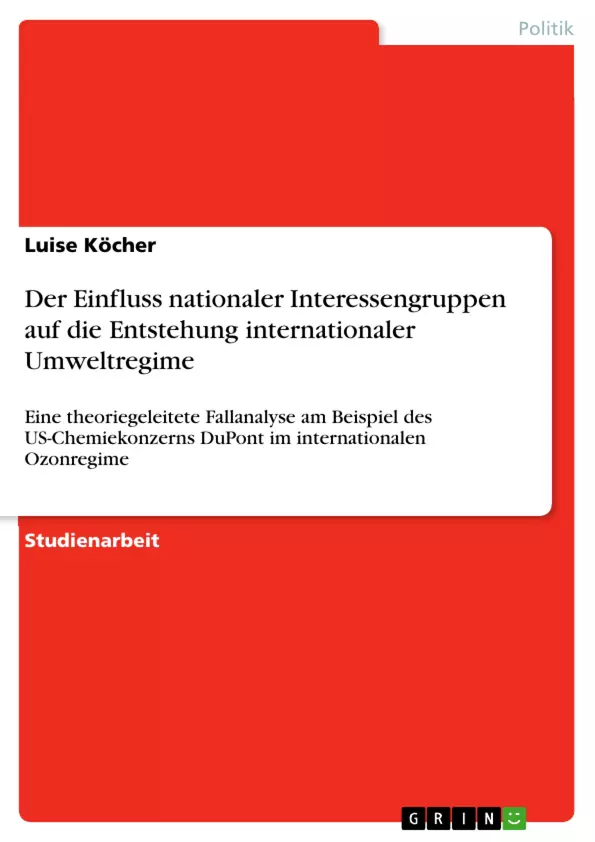Das im Jahre 1987 beschlossene Montreal-Protokoll, welches unter anderem eine Reduktion des weltweiten Verbrauches und der Herstellung von FCKW vorsieht, gilt bis heute als das
erfolgreichste internationale Umweltregime. Bei den Verhandlungen standen sich zwei Staatengruppen gegenüber, die jeweils divergierende nationale Interessen verfolgten. Insbesondere nahmen die USA mit einer reduktionsfreundlichen Haltung eine Führungsposition in den Verhandlungen ein. Sie bildeten gemeinsam mit einigen skandinavischen Ländern die sogenannte Toronto-Gruppe. Ihr gegenüber stand eine reduktionsfeindliche Fraktion, vornehmlich bestehend aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft.
Eine wichtige Voraussetzung für den Abschluss der Verhandlungen des Montreal-Protokolls war die Möglichkeit der Bereitstellung von FCKW-Substituten durch die nationalen
Chemieindustrien. Bis Mitte der 1980er Jahre war es jedoch keinem Land gelungen, marktfähige Emissionsminderungstechnologien und Ersatzprodukte zu entwickeln, da sie entweder zu teuer oder zu giftig waren. Das Fehlen dieser Stoffe übte ebenfalls einen Einfluss auf die jeweiligen staatlichen Haltungen gegenüber eines solchen Regimes aus. Kurz bevor die Verhandlungen zum Montreal-Protokoll im Dezember 1986 aufgenommen wurden, verkündete der amerikanische FCKW-Weltmarktführer DuPont jedoch die Entwicklung von günstigen Ersatzstoffen. Aufgrund dieses zeitlichen Zusammenhangs lässt sich vermuten, dass die US-Chemieindustrie eine bedeutende Rolle bei dem Abschluss des Montreal-Protokolls gespielt hat, indem sie die Position der
US-Verhandlungsführer wegweisend geprägt hat.
Die vorliegende Arbeit widmet sich, auch mit Hinblick auf die Universalität der Thematik, der Frage, welchen Einfluss nationale Interessengruppen auf die Entstehung internationaler
Regime haben. Am Beispiel des Montreal-Protokolls wird die Hypothese verfolgt, dass die Profitinteressen der US-amerikanischen Chemielobby, hier DuPont, die US-Position innerhalb der Verhandlungen zum Montreal-Protokoll, beeinflusst haben. Zur Überprüfung der Hypothese wird in einem ersten Schritt (Kapitel 2) ein Überblick über prominente Theorien Internationaler Regime gegeben. Für die Analyse wird hierbei der interessenbasierte Ansatz von zentraler Bedeutung sein. Daran anschließend werden drei themenrelevante
Werke, welche den Einfluss nationaler Interessen auf die Außenpolitik von Staaten zum Thema haben, zur Analyse herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theorien zur Entstehung internationaler (Umwelt-)Regime
- Liberalismus: Erklärungen für die Interaktion von Innen- und Außenpolitik in den Internationalen Beziehungen
- Interessenbasierte Entstehungsfaktoren internationaler Umweltregime: „Emissionsreduktionskosten“ und „Ökonomische Vulnerabilität“
- Die Zwei-Phasen-Genese der US-Ozonpolitik
- Phase I (1974 - 1982)
- Phase II (1982 - 1987)
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss nationaler Interessengruppen auf die Entstehung internationaler Regime. Am Beispiel des Montreal-Protokolls, welches die Reduktion des weltweiten Verbrauches und der Herstellung von FCKW vorsieht, wird die Hypothese verfolgt, dass die Profitinteressen der US-amerikanischen Chemielobby, hier DuPont, die US-Position innerhalb der Verhandlungen zum Montreal-Protokoll beeinflusst haben.
- Analyse der Entstehung internationaler (Umwelt-)Regime
- Bedeutung nationaler Interessen für die Positionierung von Staaten in internationalen Verhandlungen
- Der Einfluss von Interessenkonflikten zwischen Regierungen und Unternehmen auf die Gestaltung von Umweltabkommen
- Die Rolle der US-Chemieindustrie in der Entwicklung des Montreal-Protokolls
- Die Wechselwirkungen zwischen nationaler Politik und internationaler Zusammenarbeit im Umweltschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 liefert einen Überblick über prominente Theorien Internationaler Regime, wobei der interessenbasierte Ansatz im Mittelpunkt steht. Die Werke von Robert D. Putnam, Andrew Moravcsik, Detlef Sprinz und Tapani Vaahtoranta werden analysiert, um die Bedeutung von innerstaatlichen Interessen für die Gestaltung internationaler Politik zu beleuchten. Kapitel 3 analysiert die Entwicklung der US-Ozonpolitik in Bezug auf ein internationales FCKW-Verbot und beleuchtet die Rolle von DuPont als maßgeblichem Akteur innerhalb der US-Positionierung.
Schlüsselwörter
Internationale Regime, Umweltpolitik, Montreal-Protokoll, FCKW, DuPont, US-Ozonpolitik, Interessenbasierter Ansatz, Liberalismus, Neoliberalismus, Domestic Politics, Zwei-Ebenen-Spiel, Ökonomische Vulnerabilität, Emissionsreduktionskosten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Montreal-Protokolls von 1987?
Das Protokoll zielt auf die weltweite Reduktion und den schrittweisen Ausstieg aus der Produktion und dem Verbrauch von ozonschichtschädigenden FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffen) ab.
Welche Rolle spielte das Unternehmen DuPont bei den Verhandlungen?
Als FCKW-Weltmarktführer änderte DuPont seine Haltung, nachdem es Ersatzstoffe entwickelt hatte. Dies ermöglichte es der US-Regierung, eine führende Rolle für ein strenges internationales Abkommen einzunehmen.
Warum waren europäische Länder zunächst gegen ein FCKW-Verbot?
Viele EU-Staaten hatten eine starke Chemieindustrie, die noch keine marktfähigen Ersatzprodukte besaß. Sie fürchteten hohe wirtschaftliche Verluste und Wettbewerbsnachteile gegenüber den USA.
Was besagt der interessenbasierte Ansatz bei internationalen Regimen?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass Staaten internationale Abkommen vor allem dann abschließen, wenn diese ihren nationalen ökonomischen Interessen dienen oder die Kosten der Reduktion tragbar sind.
Was versteht man unter dem „Zwei-Ebenen-Spiel“ nach Putnam?
Es beschreibt die Situation, in der Regierungen gleichzeitig auf internationaler Ebene verhandeln und auf nationaler Ebene die Zustimmung von Interessengruppen (wie der Chemielobby) sichern müssen.
Warum gilt das Montreal-Protokoll als Erfolg?
Es gilt als Erfolg, weil es gelang, divergierende nationale Interessen zu überbrücken und durch technologische Innovationen einen globalen Standard zum Schutz der Ozonschicht zu setzen.
- Arbeit zitieren
- Luise Köcher (Autor:in), 2014, Der Einfluss nationaler Interessengruppen auf die Entstehung internationaler Umweltregime, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283793