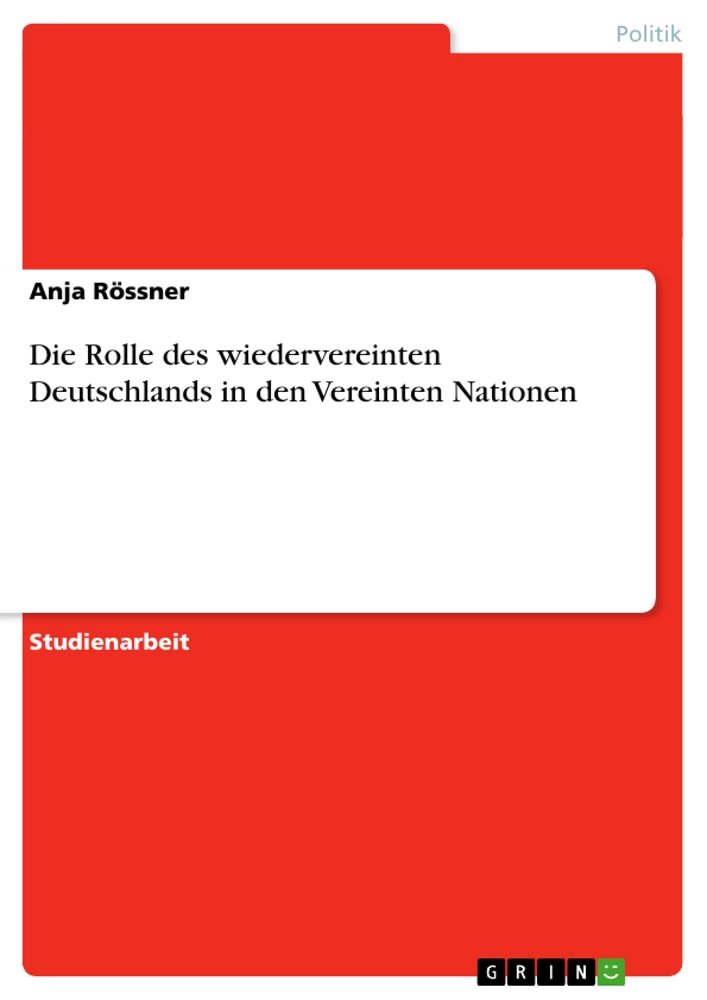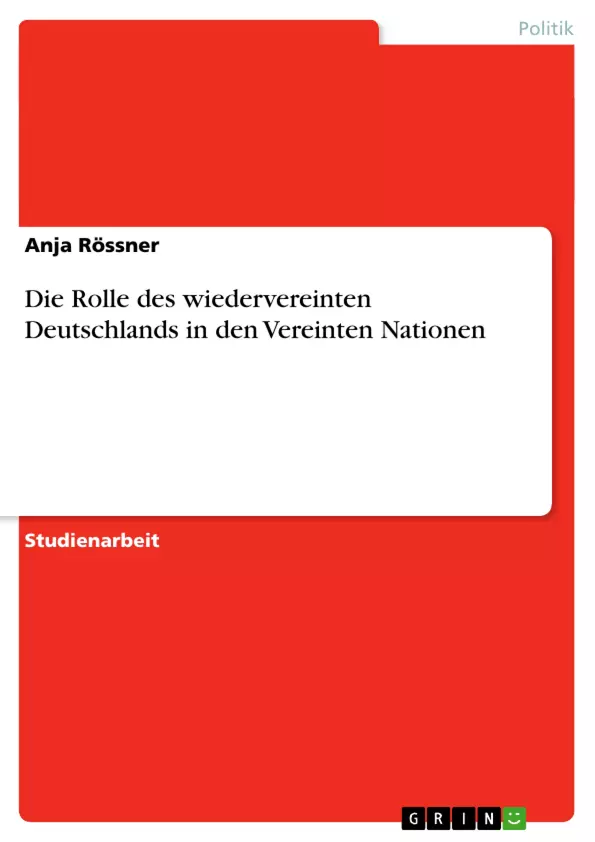Die Vereinten Nationen (UN) wurden am 26.Juni 1945 in San Francisco gegründet. Delegierte aus 51 Staaten unterzeichneten die UN-Charta, die schließlich am 24.Oktober 1945 in Kraft trat, nachdem die fünf Großmächte (USA, UdSSR, Großbritannien, Frankreich und China), sowie die Mehrheit der Unterzeichnerstaaten die Ratifikationsurkunden bei der US-Regierung hinterlegt hatten.
Dem ging die in der Atlantikcharta vom August 1941 niedergelegte Forderung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt und des britischen Premierminister Churchills nach Zusammenarbeit aller Völker und Errichtung einer Weltfriedensorganisation voraus, wobei die „neue“ Weltfriedensorganisation - anders als der ohnmächtige Völkerbund - mit echten Vollmachten ausgestattet werden sollte. Die Präambel der Charta spiegelt mit der erklärten Entschlossenheit, „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat“ , den Ursprung der Vereinten Nationen und ihrer Grundsätze im Zweiten Weltkrieg und besonders die Verbrechen Hitler-Deutschlands wider.
Die Bundesrepublik Deutschland wurde erst 28 Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen als Mitglied aufgenommen. Eine Vollmitgliedschaft der BRD war vorher auch von deutscher Seite nicht in Betracht gezogen worden, da ein Aufnahmeantrag eine ähnli-che Aktion der DDR nach sich gezogen hätte, was die Bonner Regierungen aufgrund einer damit verbundenen internationalen Anerkennung der DDR unbedingt umgehen wollten. Als Ergebnis der Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition kam es am 28. Septem-ber 1973 dennoch zu einer separaten Aufnahme beider Staaten in die Vereinten Nationen.
Das Ende des Ost-West-Konflikts und die deutsche Einheit veränderten die weltpolitische Lage fundamental: es trat ein Wandel ein, der sich für das vereinte Deutschland als nun souveräner und uneingeschränkt handlungsfähiger Staat besonders in seiner gewachsenen weltpolitischen Rolle niederschlug.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das wiedervereinte Deutschland in den Vereinten Nationen
- II.1 Die veränderten Rahmenbedingungen und die Folgen für die Mitgliedschaft des wiedervereinten Deutschlands in den Vereinten Nationen
- II.2 Mitwirkung Deutschlands in den Vereinten Nationen
- II.2.1 Überblick
- II.2.2 Deutschlands finanzieller Beitrag zu den Vereinten Nationen
- II.2.3 Deutsches Engagement im Bereich des Internationalen Umweltschutzes
- II.2.4 Deutsches Engagement im Bereich der Menschenrechte
- II.2.4.1 Menschenrechte in den Vereinten Nationen
- II.2.4.2 Deutsche Menschenrechtspolitik am Beispiel des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH)
- II.4.3 Probleme bei der internationalen Durchsetzung der Menschenrechte
- II.3 Deutschland und die „europäische Position“ in den Vereinten Nationen
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle des wiedervereinten Deutschlands in den Vereinten Nationen. Ziel ist es, die veränderte Situation nach der Wiedervereinigung im Hinblick auf die internationalen und innerdeutschen Erwartungen an Deutschlands weltpolitische Rolle zu untersuchen. Im Fokus steht die Frage, inwiefern sich das vereinte Deutschland diesen Herausforderungen durch seine Mitarbeit in den Vereinten Nationen gestellt hat.
- Die veränderten Rahmenbedingungen für die Mitgliedschaft des wiedervereinten Deutschlands in den Vereinten Nationen
- Die Rolle Deutschlands im Bereich der Friedensicherung
- Das deutsche Engagement im Bereich des Internationalen Umweltschutzes
- Deutsches Engagement im Bereich der Menschenrechte
- Die „europäische Position“ Deutschlands in den Vereinten Nationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Entstehung der Vereinten Nationen und die besondere Bedeutung der Präambel der Charta im Kontext der deutschen Vergangenheit. Im Anschluss wird der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1973 und die Folgen der Wiedervereinigung für die deutsche Rolle in den Vereinten Nationen beschrieben. Es wird deutlich, dass die Wiedervereinigung zu einer verstärkten Erwartungshaltung an Deutschland führte, sich aktiv an den Maßnahmen der Vereinten Nationen zur Wahrung und Wiederherstellung des Friedens zu beteiligen.
Kapitel II.1 widmet sich den veränderten weltpolitischen Rahmenbedingungen und den Folgen für die Mitgliedschaft des wiedervereinten Deutschlands in den Vereinten Nationen. Die Arbeit zeigt, dass Deutschland durch die Wiedervereinigung zu einem gewichtigeren Mitgliedstaat der Vereinten Nationen wurde und seine Rolle in den Vereinten Nationen von da an neu definiert werden musste.
Kapitel II.2 beleuchtet die verschiedenen Aspekte der deutschen Mitwirkung in den Vereinten Nationen. Neben dem finanziellen Beitrag wird das deutsche Engagement im Bereich des Internationalen Umweltschutzes und der Menschenrechte beleuchtet. Anhand des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) wird beispielhaft die deutsche Menschenrechtspolitik dargestellt.
Schlüsselwörter
Vereinte Nationen, wiedervereintes Deutschland, weltpolitische Rolle, Friedensicherung, Umweltschutz, Menschenrechte, Internationaler Strafgerichtshof (IStGH), „europäische Position“
Häufig gestellte Fragen
Wann trat die Bundesrepublik Deutschland den Vereinten Nationen bei?
Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR wurden am 28. September 1973 als separate Mitglieder in die Vereinten Nationen aufgenommen.
Wie veränderte die Wiedervereinigung Deutschlands Rolle in der UN?
Nach der Wiedervereinigung wurde Deutschland zu einem souveränen und uneingeschränkt handlungsfähigen Staat, von dem international ein stärkeres Engagement in der Friedenssicherung erwartet wurde.
In welchen Bereichen engagiert sich Deutschland besonders innerhalb der UN?
Deutschland leistet bedeutende finanzielle Beiträge und engagiert sich stark im internationalen Umweltschutz sowie in der Förderung der Menschenrechte.
Was ist die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) für die deutsche Politik?
Der IStGH ist ein zentrales Beispiel für die deutsche Menschenrechtspolitik, die darauf abzielt, schwerste Verbrechen international strafrechtlich zu verfolgen.
Was wird unter der „europäischen Position“ Deutschlands in der UN verstanden?
Deutschland bemüht sich oft um eine enge Abstimmung mit seinen EU-Partnern, um gemeinsame europäische Interessen und Werte innerhalb der UN-Gremien wirkungsvoll zu vertreten.
- Citation du texte
- Anja Rössner (Auteur), 2004, Die Rolle des wiedervereinten Deutschlands in den Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28381