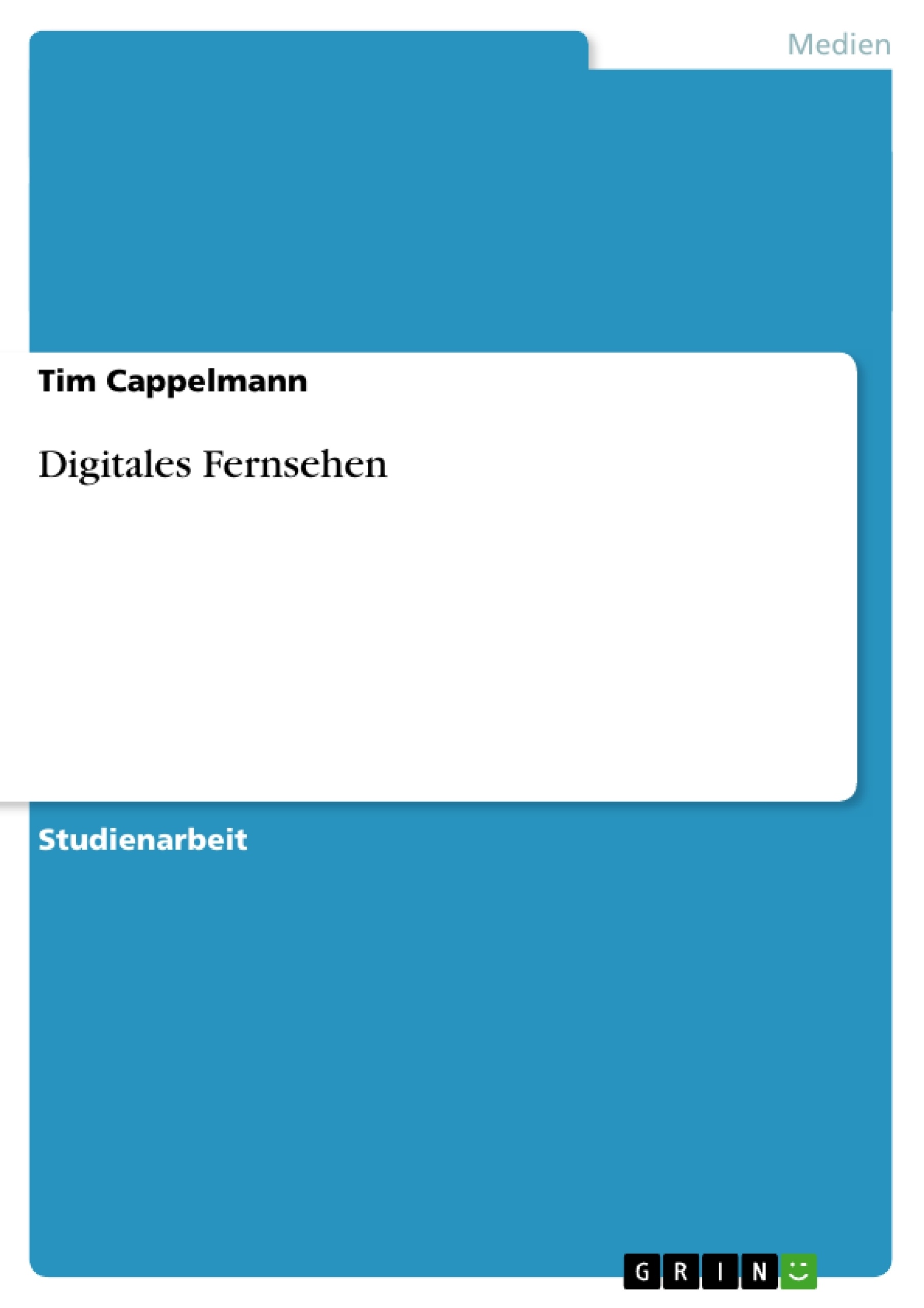Einleitung
Im Jahre 2010 wird das analoge Fernsehen abgeschaltet. Die Fernsehzuschauer in Deutschland kommen dann in den von den Veranstaltern versprochenen Genuss des digitalen Fernsehens. Vorausgesetzt sie kaufen sich vorab einen Decoder (Set Top Box) oder einen neuen, digitaltauglichen Fernseher. Ersterer kostet 200 Euro, letzterer ist zur Zeit mit ca. 4000 Euro für den Durchschnittsverdiener kaum bezahlbar. Aber das digitale Fernsehen kommt. In Berlin und Potsdam sogar schon bis zum Sommer 2003, als Pilotprojekt. Wer nicht mitzieht und sich keine Set Top Box kauft, dessen Bildschirm bleibt schwarz. Eine Tatsache, die noch kaum ein Zuschauer kennt und die auch in den Medien selbst wenig Beachtung findet. Und wenn, dann nur mit weiteren schlechten Neuigkeiten. Deutschlands wohl bekanntester Medien-Mogul, Leo Kirch, musste erst kürzlich Insolvenz beantragen – und zwar gerade wegen der täglichen Verluste in Millionen Höhe, die sein Pay-TV-Sender Premiere mit dem digitalen Angebot, Premiere World, einfuhr. Und welch Welle der Empörung ging durch die Nation als es hieß: `TV-Skandal! 3 Millionen können die WM nicht sehen!´ (BILD vom 1.06.02) Die mutigen Pionier-Nutzer des digitalen Fernsehens von ARD und ZDF (ca. 1 Million Haushalte) wurden wegen Streitigkeiten zwischen Rechtevermarkter KirchMedia, ARD und ZDF und ausländischer Sender tatsächlich um die Übertragung der deutschen Spiele bei der Fußballweltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea betrogen. Stattdessen gab es einen alten Mantel- und Degen-Film zu sehen. Theater statt Fußball, damit machte es sich nicht gerade beliebt, das Digi-TV. Doch die eigentliche Vision, die durch die neuen Möglichkeiten mit der Digitalisierung des Fernsehens zunehmend realisierbarer wirkt, scheint eigentlich gar nicht so verkehrt: Individuell abrufbare Programme und Programmgestaltungsmöglichkeiten, interaktives Fernsehen, die Integration mehrerer Medien und Dienste zu einem Multimediaangebot im Heimkino und das alles bei einer Programmauswahl von bis zu 1000 Angeboten, übersichtlich im Navigationssystem strukturiert und auf die persönlichen Präferenzen des Zuschauers abgestimmt. Wenn dieser dann doch einmal seine Lieblingssendung verpasst, wird sie ohnehin zeitversetzt noch einmal ausgestrahlt. Und sollte das Ende eines Filmes mal nicht mit dem persönlichen Geschmack übereinstimmen – macht nichts, ein Happy End ist auf Abruf bestellbar...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Digitaltechnik
- Definition
- Kompression
- Reduktion
- Multiplexing, Set Top Box und Conditional Access
- Vervielfachung
- Übertragungswege
- Terrestrik
- Satellit und Kabel
- Konvergenz und neue Dienste
- Digitale Mediendienste
- Digitale Teledienste
- Split Screen
- WebTV
- Führung in der Vielfalt
- Gefahren des Navigationssystems
- Navigator
- Electronic Programme Guide
- ZDF.vision
- Der EPG von ZDF.vision
- Das Programmbouquet von ZDF.vision
- Eigene Programme
- ZDF.info
- ZDF.doku
- ZDF Theaterkanal
- ZDF.digitext
- Gastsender
- EuroNews
- EUROSPORT
- ORF.SAT
- Partnerprogramme
- Eigene Programme
- Bestandsgarantie und Entwicklungschancen
- Must-Carry-Regelung
- Probleme der Must-Carry-Regelung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Digitalisierung des Fernsehens und ihren Auswirkungen auf die Medienlandschaft. Sie bietet eine Übersicht über die technische Funktionsweise des digitalen Fernsehens, beleuchtet die damit verbundene Konvergenz der Medien und stellt ein Programmbouquet am Beispiel von ZDF.vision vor. Darüber hinaus werden rechtliche Aspekte der Digitalisierung, insbesondere die Must-Carry-Regelung, sowie die Herausforderungen der Navigation und neuen Dienste behandelt. Schließlich wird die Frage diskutiert, welche Chancen und Risiken das digitale Fernsehen für den Nutzer birgt.
- Technische Funktionsweise des digitalen Fernsehens
- Konvergenz der Medien und neue digitale Dienste
- Programmbouquet von ZDF.vision
- Rechtliche Aspekte der Digitalisierung, insbesondere die Must-Carry-Regelung
- Navigationssystem, Chancengleichheit und Bestandsgarantie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Digitalisierung im deutschen Fernsehen und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 beleuchtet die Digitaltechnik im Detail, einschließlich der Definition, Kompression, Reduktion, Multiplexing und Vervielfachung. Kapitel 3 betrachtet verschiedene Übertragungswege, darunter terrestrische, Satelliten- und Kabelübertragung, und analysiert ihre Vor- und Nachteile. Kapitel 4 widmet sich dem Thema der Konvergenz und neuen Diensten, die durch die Digitalisierung möglich werden. Kapitel 5 diskutiert die Bedeutung von Navigationssystemen und den damit verbundenen Herausforderungen. Kapitel 6 stellt ZDF.vision als Beispiel für ein digitales Programmbouquet vor. Kapitel 7 beleuchtet die Bestandsgarantie und Entwicklungschancen im Kontext der Must-Carry-Regelung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Digitalisierung, Fernsehen, Digitaltechnik, Konvergenz, Medien, Programmbouquet, ZDF.vision, Navigationssystem, Must-Carry-Regelung, Chancengleichheit, Bestandsgarantie.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Digitalisierung des Fernsehens?
Ziel war eine höhere Programmauswahl (bis zu 1000 Angebote), interaktive Dienste, bessere Bildqualität und die Integration von Multimedia-Inhalten.
Was ist eine Set Top Box?
Ein Decoder, der benötigt wird, um digitale Signale für herkömmliche analoge Fernsehgeräte empfangbar zu machen.
Was bedeutet Medienkonvergenz im digitalen TV?
Konvergenz bezeichnet das Zusammenwachsen von Fernsehen, Internet und anderen digitalen Telediensten zu einem integrierten Angebot.
Was ist ZDF.vision?
ZDF.vision war ein digitales Programmbouquet des ZDF, das Zusatzsender wie ZDF.info, ZDF.doku und den Theaterkanal umfasste.
Was regelt die Must-Carry-Regelung?
Sie verpflichtet Kabelnetzbetreiber dazu, bestimmte Programme (insbesondere öffentlich-rechtliche) verpflichtend in ihre Netze einzuspeisen.
Was ist ein Electronic Programme Guide (EPG)?
Ein EPG ist eine digitale Programmzeitschrift, die direkt am Bildschirm zur Navigation und Information über Sendungen genutzt werden kann.
- Citation du texte
- Tim Cappelmann (Auteur), 2003, Digitales Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28387