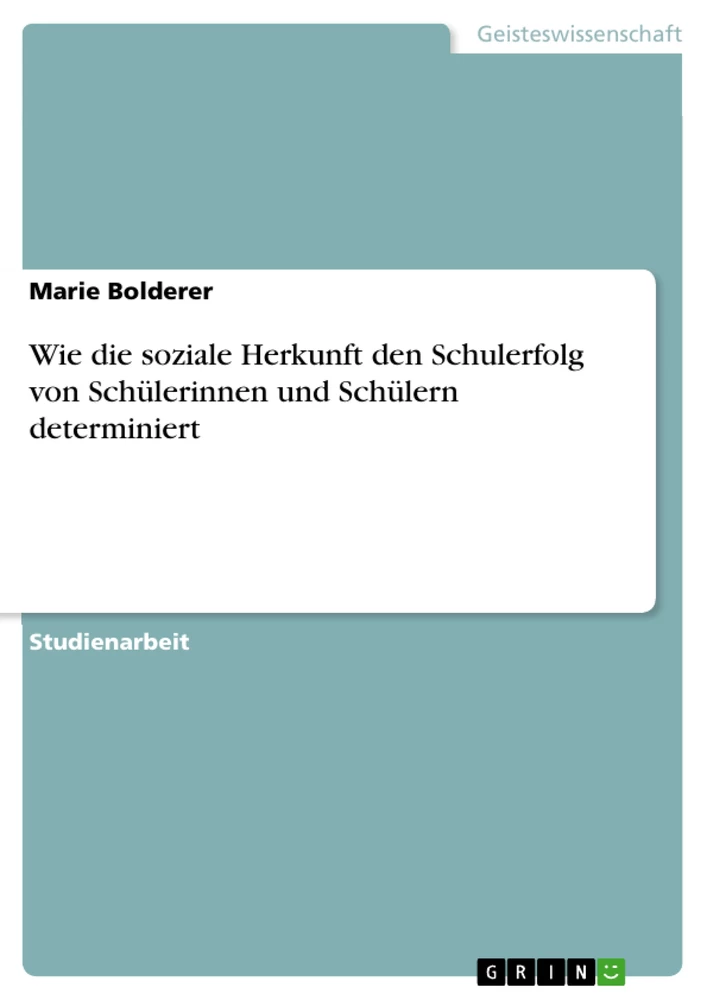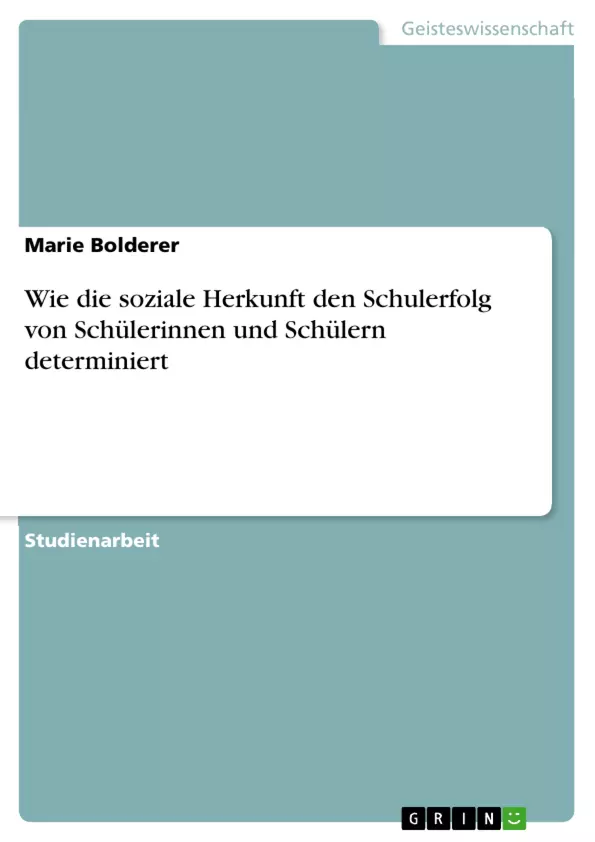Dass das Elternhaus den Schulerfolg junger Menschen in Deutschland maßgeblich bestimmt, ist allgemein bekannt. Doch in welchem Ausmaß genau und was sind die Gründe dafür? Diesen und anderen Fragen ist diese Hausarbeit nachgegangen.
In Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Die Ergebnisse der PISA-Studie aus dem Jahr 2000 haben jedoch deutlich gemacht, dass die soziale Herkunft in Deutschland auf den schulischen Erfolg der SchülerInnen so viel Einfluss hat, wie in keinem anderen der untersuchten OECD-Staaten. Die weiteren PISA-Studien aus den Jahren 2003 und 2006, die IGLU-Studien von 2001 und 2006 sowie verschiedene kleinere Studien, die aufgrund der PISA- und IGLU-Ergebnisse durchgeführt wurden, kamen ebenfalls zu diesem Schluss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Soziale Herkunft
- Soziale Ungleichheit
- Schulerfolg
- Forschungsstand und (mögliche) Gründe
- Die Ergebnislage zum Schulerfolg von GrundschülerInnen und dem Zusammenhang mit der sozialen Herkunft
- Die Ergebnislage zum Schulerfolg von SchülerInnen und Schülern der Sekundarstufe und dem Zusammenhang mit der sozialen Herkunft
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie die soziale Herkunft den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern in Deutschland beeinflusst. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema aufzuarbeiten und die verschiedenen Ergebnisse zusammenzutragen. Dabei wird der Fokus auf den sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie gelegt, ohne die Einflüsse von Migrationshintergrund oder Geschlecht zu berücksichtigen.
- Der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Schulerfolg
- Die Rolle des sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie
- Die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem
- Die Bedeutung von Ressourcen und Teilhabechancen
- Die Ergebnisse verschiedener Studien und Untersuchungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und führt in die Thematik der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem ein. Sie beleuchtet die Ergebnisse verschiedener Studien, die den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Schulerfolg belegen.
Das Kapitel „Begriffsbestimmungen“ definiert die zentralen Begriffe der Hausarbeit, wie soziale Herkunft, soziale Ungleichheit und Schulerfolg. Es werden verschiedene Definitionen aus der pädagogischen Literatur vorgestellt und diskutiert.
Das Kapitel „Forschungsstand und (mögliche) Gründe“ analysiert die Ergebnisse verschiedener Studien, die sich mit dem Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg befassen. Es werden sowohl die Ergebnisse von Studien zu GrundschülerInnen als auch zu SchülerInnen der Sekundarstufe betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die soziale Herkunft, den Schulerfolg, die soziale Ungleichheit, das Bildungssystem, den sozioökonomischen Status, die Ressourcen, die Teilhabechancen und die Ergebnisse verschiedener Studien und Untersuchungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie stark beeinflusst die soziale Herkunft den Schulerfolg in Deutschland?
Studien wie PISA und IGLU zeigen, dass in Deutschland die soziale Herkunft einen stärkeren Einfluss auf den Bildungserfolg hat als in fast jedem anderen OECD-Staat.
Was sagt das Grundgesetz zum Thema Bildungschancen?
Artikel 3 Absatz 3 besagt, dass niemand wegen seiner Herkunft oder Abstammung benachteiligt oder bevorzugt werden darf – ein Anspruch, der in der Bildungspraxis oft nicht erfüllt wird.
Welche Rolle spielt der sozioökonomische Status der Eltern?
Der sozioökonomische Status bestimmt maßgeblich die verfügbaren Ressourcen und Teilhabechancen, die ein Kind für seinen Bildungsweg nutzen kann.
Wird in dieser Arbeit auch der Migrationshintergrund untersucht?
Nein, die vorliegende Hausarbeit konzentriert sich bewusst auf den sozioökonomischen Status und klammert Einflüsse von Migrationshintergrund oder Geschlecht aus.
Gibt es Unterschiede zwischen Grundschule und Sekundarstufe?
Die Arbeit analysiert den Forschungsstand für beide Bereiche und stellt fest, dass sich die soziale Ungleichheit durch das gesamte Bildungssystem zieht.
- Quote paper
- Marie Bolderer (Author), 2012, Wie die soziale Herkunft den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern determiniert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283890