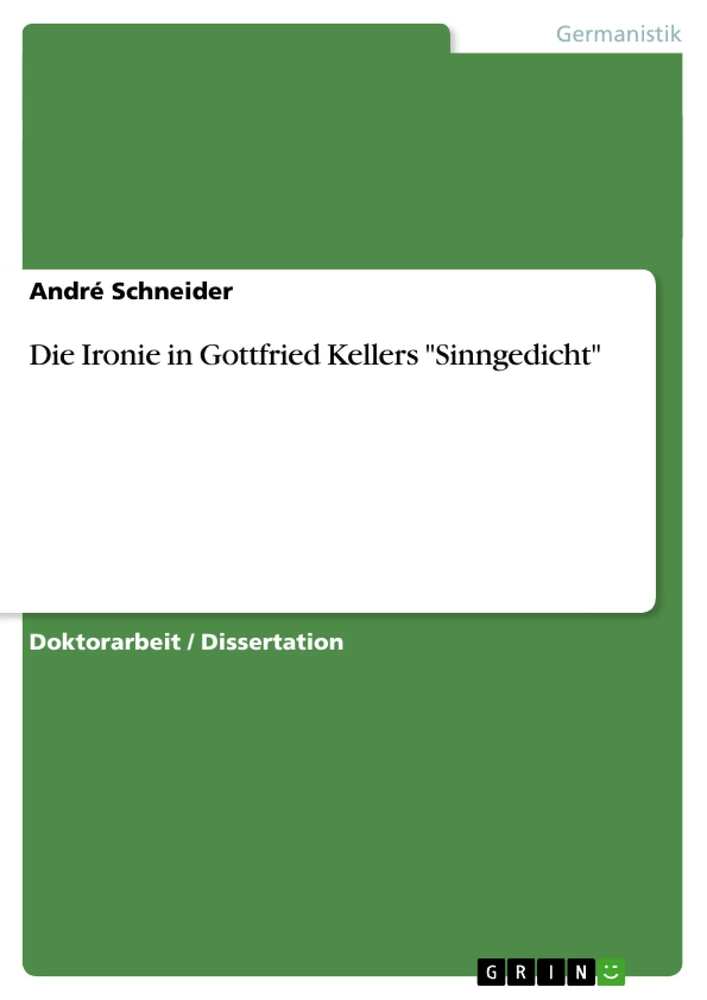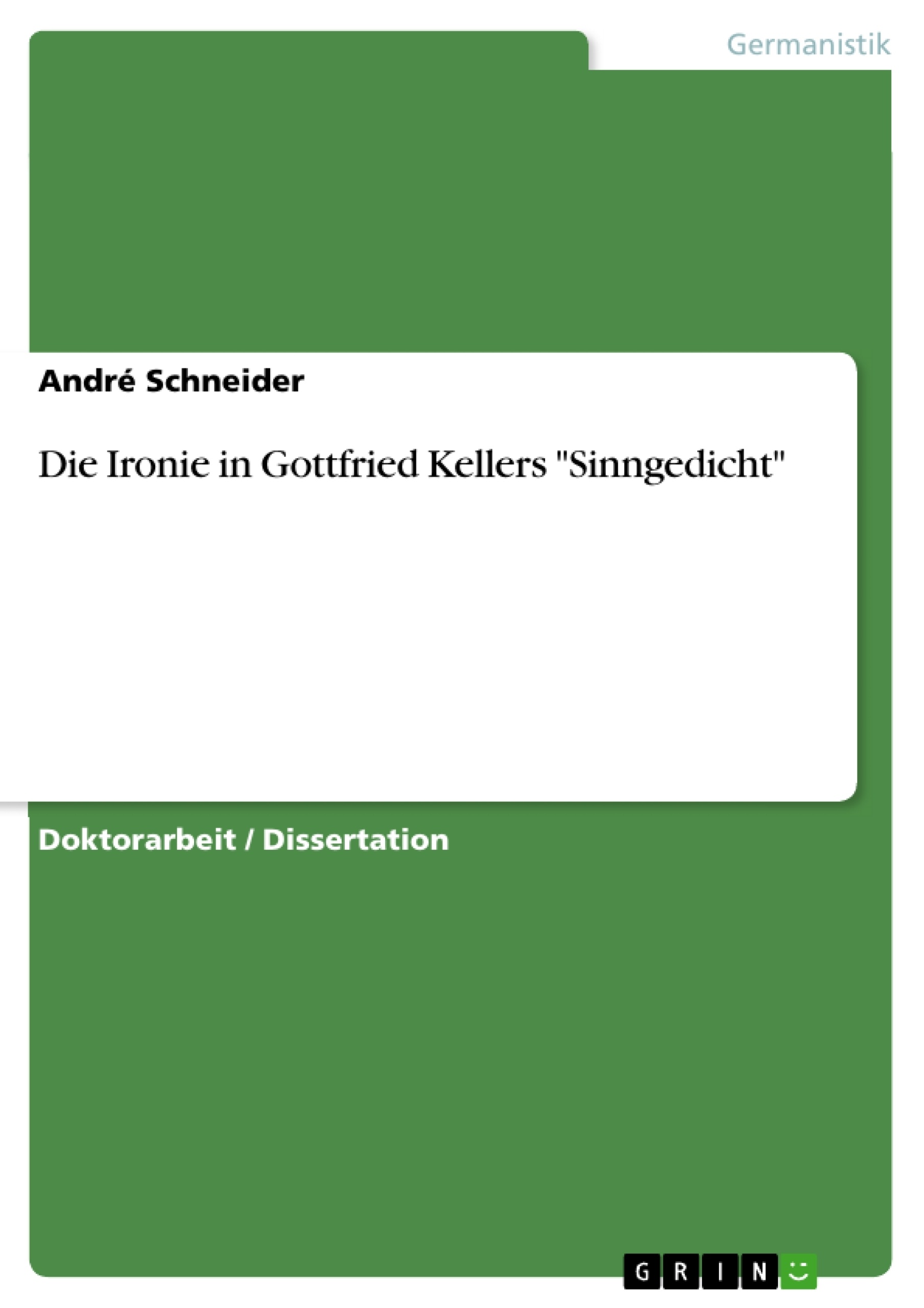Im letzten Novellenzyklus Kellers wird vielerlei unterschwellige Kritik an Gesellschaftszuständen im deutschsprachigen Raum und an typischen zeitgenössischen Vertretern diverser Gesellschaftsschichten zu einem großen Teil über die Ironie transportiert. Vorkommen des ironischen Sprechens werden verknüpft mit Momenten narrativer Ironie und erscheinen eng an das Typusmotiv des Sonderlings geknüpft, das im „Sinngedicht“ wiederholt eingesetzt wird. Die Untersuchung orientiert sich daher insbesondere an den männlichen Vertretern der narrativ inszenierten Gesellschaftsordnung, deren Ironisierung oft erst bei näherer Hinsicht ins Auge fällt.
Nachdem Preisendanz Kellers Dichtkunst nachvollziehbar mit dem bürgerlichen Humor identifiziert, ergibt sich dennoch an vielen Stellen der Sinngedichtforschung die Wahrnehmung einer Ironie, deren genauere Untersuchung bisher jedoch ausgeblieben ist. So versteht sich die vorliegende Arbeit als eine Vertiefung der Einordnung des Keller-Werkes in die Kategorie des bürgerlichen Humors.
Thematisch erfolgt, neben der Konzentration auf die angesprochene Gesellschaftskritik, die Analyse ironischer Sequenzen auf dem Gebiet des Geschlechterdiskurses, mit dem sich ebenfalls Amrein, Bischof und Rácz in jüngerer Zeit auseinandergesetzt haben. Da ironische Elemente eine nicht unerhebliche Rolle in Figurendialogen – insbesondere auf der Ebene der Rahmenhandlung zwischen den beiden Hauptfiguren Reinhart und Lucie – zu spielen scheinen, kommen bei der Untersuchung verbalironischer Einheiten auch linguistische Theorien zum Einsatz. Hier orientiert sich die Vorgehensweise an Preukschat, der in seiner Monografie zum ‚Akt des Ironisierens’ (2007) eine dezidierte Untersuchung auch literarischer Werke mit sprachwissenschaftlichen Mitteln fordert. Auf diese Weise ist das Zusammenspiel von verbaler und epischer Ironie nachzuzeichnen, das als besonderes Dichtungsverfahren des Novellenzyklus aufgefasst werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage, Untersuchungsgang und Methode
- Verortung des Phänomens der Ironie
- Erste Abgrenzung zu ähnlich gearteten Phänomenen.
- Lüge und Heuchelei
- Sarkasmus und Zynismus.
- Das Komische
- Der Witz ...........
- Humor..
- Die Satire…......
- Klassische Auffassungen....
- Literarische Ironie
- Prototypen der Ironie....
- Der Text als Spielraum des Ironischen
- Linguistische Konzeptionen .......
- Pretense Theory.
- Echoic Mention Theory.
- Allusional Pretense Theory.
- Die Zusammenschau im Integrationsmodell..
- Erste Abgrenzung zu ähnlich gearteten Phänomenen.
- Die Ironie in Gottfried Kellers „Sinngedicht“.
- Poetologische Verortung und epochale Zuordnung ...
- Abgrenzung von den, Originalgenies'
- Positionierung zum Naturalismus
- Humor und Ironie in poetologischer Hinsicht...
- Architektur des Zyklus.
- Die Eröffnung des ironischen Spielraums: Stilironie im Eingangssatz
- Der männliche Sonderling und sein Entwicklungspotenzial in Gestalt des Herrn
Reinhart auf Basis seiner erzählerischen Darbietungen
- Die Ironisierung des Erwin ironisierenden Herrn Reinhart durch den 0-Narrator:
Verweislinien zwischen Reinharts Einstellungen, Lucies Dialogironie und dem
Ironieopfer Erwin
- Reinharts Fehltritt und Erwins Einkauf der Dienstmagd auf dem Boden deutscher Kultur…………………………..
- Reinhart als Fremdling in der moralischen Welt – Erwin als Fremdling auf dem Boden deutscher Kultur
- Die vermittelte Ironisierung Brandolfs durch den 0-Narrator und Herr Reinharts
erster Entwicklungsschritt .
- Äußeres verliert an Gewicht und Ökonomisches bleibt Kriterium bei der Brautwahl......
- Reinharts Wollschäfchen und Brandolfs Liebhaben dieses haushälterisch begabten Frauchens.......
- Die Ironisierung des Erwin ironisierenden Herrn Reinhart durch den 0-Narrator:
Verweislinien zwischen Reinharts Einstellungen, Lucies Dialogironie und dem
Ironieopfer Erwin
- Historische Transformationen: Correa, Thibaut und weitere Entwicklungsschritte
Reinharts.
- Der erfolgreiche Vorläufer des guten Bürgersohnes .....
- Der erfolglose Vorläufer des schlechten Bürgersohnes
- Religionskritik und Liebe: Ironisierung der Glasglockenfamilie, Bigotterie und Scheinheiligkeit der Donna Feniza und des Leodegar.
- „Die Geisterseher“ als Spiegelachse und Rückschau gesellschaftlicher Disparitäten...
- Parabasisches Verfahren: Das überzeichnete Abschlussidyll als ironische Replik im Widerstreit der Kulturen
- Typologischer Vergleich: „Sinngedicht“ und „,Symposion".
- Poetologische Verortung und epochale Zuordnung ...
- Zusammenfassung..
- Liste gesondert aufgeführter Zitate .
- Abbildungen
- Abb. 1 Der symmetrische Aufbau des „Sinngedichts" unter gesellschaftlichem Gesichtspunkt
- Abb. 2 Der Entwicklungsgang Reinharts unter dem Eindruck narrativer und verbaler Ironie
- Literaturverzeichnis...........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der Ironie in Gottfried Kellers „Sinngedicht“ und untersucht, wie diese literarische Technik zur Kritik an gesellschaftlichen Zuständen und Figuren des 19. Jahrhunderts eingesetzt wird. Die Arbeit analysiert die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen das Werk entstand, sowie die Wirkungsabsichten des Autors.
- Die Rolle der Ironie in Kellers Werk und ihre Funktion als Mittel der Gesellschaftskritik
- Die Analyse der männlichen Protagonisten im „Sinngedicht“ als Sonderlinge und ihre Ironisierung durch den Erzähler
- Der Geschlechterdiskurs im „Sinngedicht“ und die Darstellung des Scheiterns der männlichen Selbstvervollkommnung
- Die Bedeutung der historischen und gesellschaftlichen Bedingungen für die Entstehung und Interpretation des „Sinngedichts“
- Die Analyse der verschiedenen Formen der Ironie im „Sinngedicht“, wie Stilironie, Dialogironie und narrative Ironie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Dissertation ein und stellt die Relevanz der Ironie in Gottfried Kellers „Sinngedicht“ dar. Sie beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die das Werk prägten, sowie die Wirkungsabsichten des Autors.
Das zweite Kapitel erläutert die Methodik der Untersuchung und die Herangehensweise an die Analyse der Ironie im „Sinngedicht“. Es werden die wichtigsten theoretischen Ansätze zur Ironieforschung vorgestellt und in den Kontext der vorliegenden Arbeit eingeordnet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Verortung des Phänomens der Ironie im Kontext anderer literarischer und sprachlicher Phänomene. Es werden Abgrenzungen zu ähnlichen Erscheinungsformen wie Lüge, Heuchelei, Sarkasmus, Zynismus, Komik, Witz, Humor und Satire vorgenommen.
Das vierte Kapitel analysiert die Ironie in Gottfried Kellers „Sinngedicht“. Es werden die poetologische Verortung und epochale Zuordnung des Werkes sowie die Architektur des Zyklus beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf die männlichen Protagonisten und ihre Ironisierung durch den Erzähler.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und stellt die wichtigsten Erkenntnisse der Dissertation dar.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ironie in Gottfried Kellers „Sinngedicht“, die Gesellschaftskritik, die männlichen Protagonisten als Sonderlinge, den Geschlechterdiskurs, die historische und gesellschaftliche Einordnung des Werkes sowie die verschiedenen Formen der Ironie, wie Stilironie, Dialogironie und narrative Ironie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat die Ironie in Gottfried Kellers „Sinngedicht“?
Ironie dient Keller als Mittel zur unterschwelligen Kritik an Gesellschaftszuständen und zur Charakterisierung zeitgenössischer Typen des 19. Jahrhunderts.
Was ist der „männliche Sonderling“ im Werk?
Figuren wie Herr Reinhart werden als Sonderlinge inszeniert, deren vermeintliche Überlegenheit durch narrative Ironie und Dialoge (insbesondere mit Lucie) hinterfragt wird.
Wie wird der Geschlechterdiskurs im Sinngedicht behandelt?
Die Arbeit analysiert ironische Sequenzen, die das Scheitern männlicher Selbstvervollkommnung und die Dynamik zwischen den Hauptfiguren Reinhart und Lucie beleuchten.
Was unterscheidet Kellers Humor von reiner Satire?
Keller wird oft dem „bürgerlichen Humor“ zugeordnet, der im Gegensatz zur scharfen Satire eine versöhnlichere, wenn auch ironisch distanzierte Sicht auf die Welt einnimmt.
Welche linguistischen Theorien werden zur Analyse genutzt?
Die Untersuchung nutzt Konzepte wie die „Pretense Theory“ und die „Echoic Mention Theory“, um verbale Ironie in den Figurendialogen präzise nachzuzeichnen.
- Arbeit zitieren
- André Schneider (Autor:in), 2013, Die Ironie in Gottfried Kellers "Sinngedicht", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283985