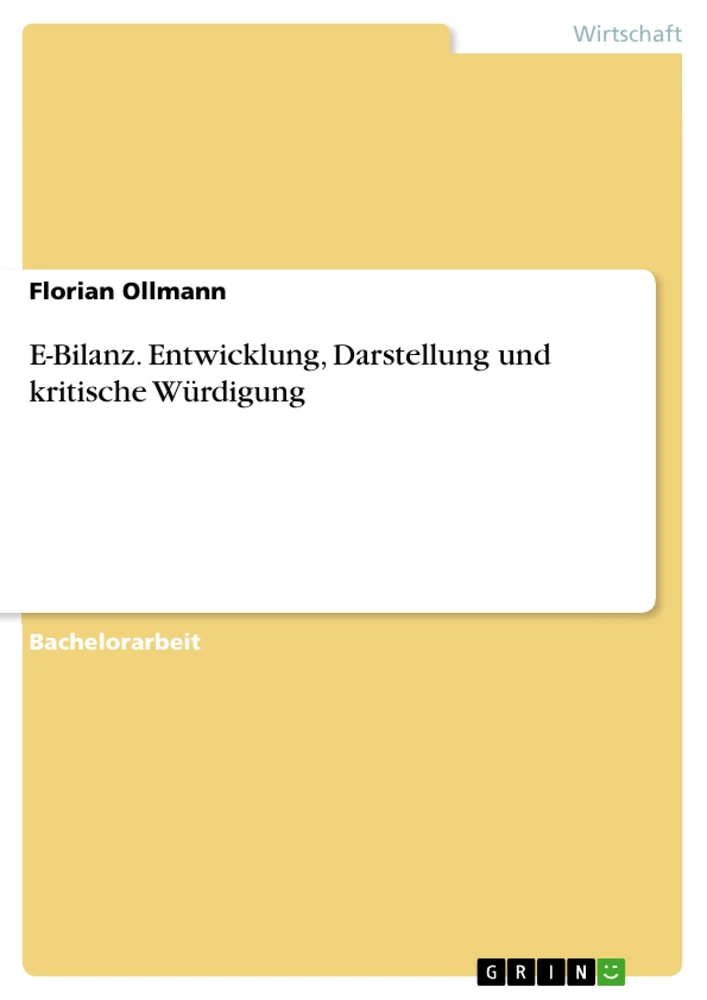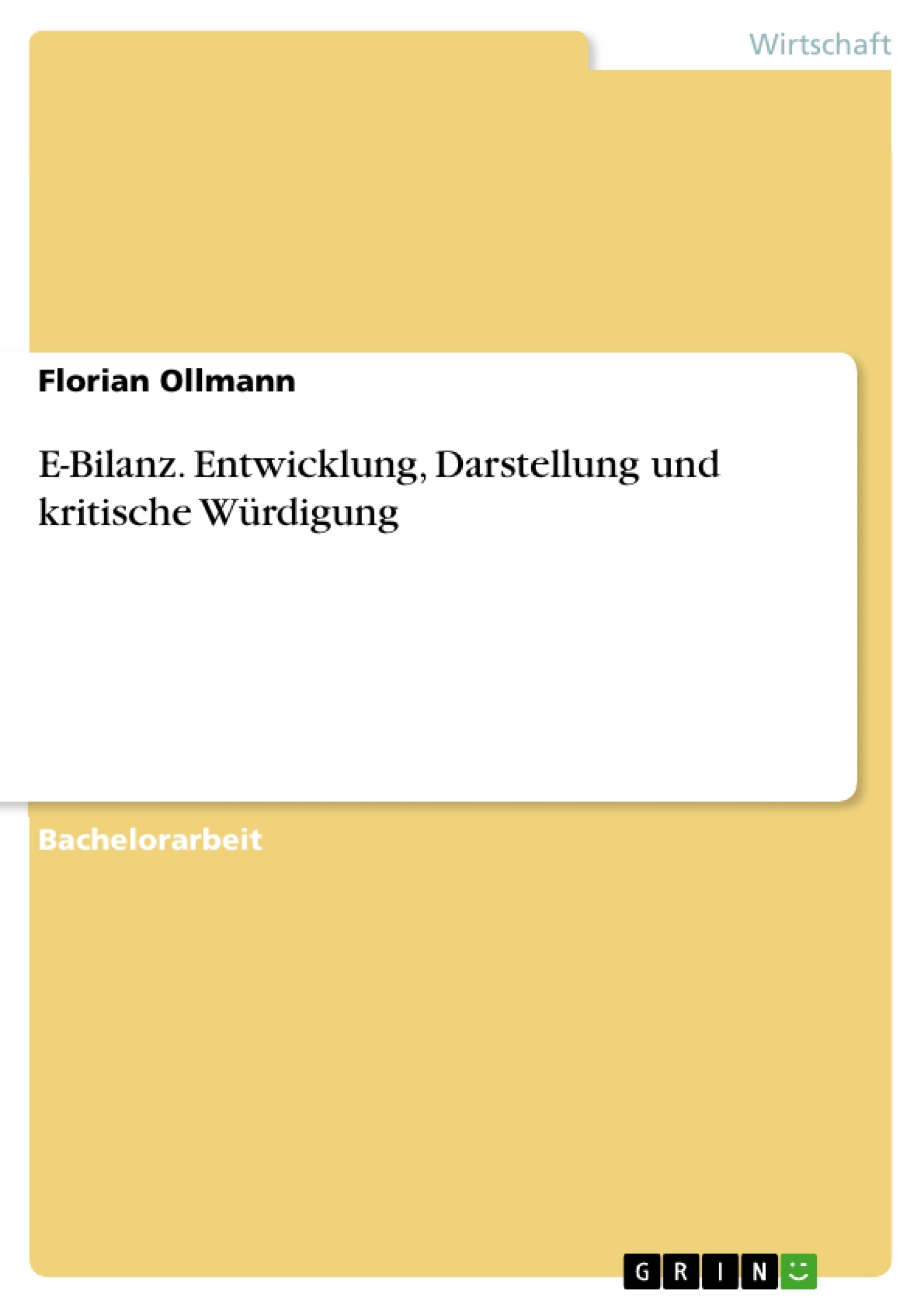In einem rasanten Wettlauf kostengünstiger und effizienter Arbeitsabläufe setzen nicht nur private Unternehmungen auf verstärkten Einsatz der modernen Informationstechnologien, auch öffentliche Verwaltungen setzen zunehmend auf diese Option.
Unter dem Motto „Elektronik statt Papier“ stand der Gesetzesentwurf zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens. Mit dem Steuer-bürokratieabbaugesetz wird die Finanzverwaltung die bekannten papierbasierten Verfahrensabläufe durch elektronische Kommunikation ersetzen.
Bereits seit dem Veranlagungszeitraum 2011 werden sämtliche Steuererklärungen elektronisch übertragen. Nach erfolgreicher Reform der Übermittlungsart der Steuererklärungen folgen nun auch die Abschlussdaten in Form der Elektronischen Bilanz mittels elektronischer Datenübertragung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Elektronische Bilanz
- 1.2 Ablauf und Abgrenzung der Bachelorthesis
- 2. Beschreibung der Elektronischen Bilanz
- 2.1 Definition
- 2.2 Hintergrund
- 2.3 Chronik der Elektronischen Bilanz
- 3. Anwendungsbereiche
- 3.1 Persönlicher Anwendungsbereich
- 3.1.1 Allgemeines
- 3.1.2 Bilanzierende Unternehmungen
- 3.1.2.1 Anwendungspflichtige Steuerpflichtige
- 3.1.2.2 Nicht anwendungspflichtige Steuerpflichtige
- 3.1.3 Besonderer sachlicher Anwendungsbereich
- 3.1.3.1 Betriebsstätten
- 3.1.3.2 Steuerbefreite Körperschaften
- 3.1.3.3 Juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Betrieben gewerblicher Art
- 3.1.4 Übersicht der anwendungspflichtigen Steuerpflichtigen
- 3.2 Zeitlicher Anwendungsbereich
- 3.2.1 Allgemeines
- 3.2.2 Übersicht des zeitlichen Anwendungsbereiches
- 3.2.3 Härtefälle
- 3.2.4 Sanktionen
- 3.3 Sachlicher Anwendungsbereich
- 3.3.1 Taxonomie
- 3.3.2 XBRL-Standard
- 3.3.3 GCD-Modul
- 3.3.4 GAAP-Modul
- 3.3.5 Kerntaxonomie
- 3.3.6 Berichtsbestandteile
- 3.3.6.1 Bilanz
- 3.3.6.2 Gewinn- und Verlustrechnung
- 3.3.6.3 Steuerliche Modifikation
- 3.3.6.4 Ergebnisverwendung
- 3.3.6.5 Kapitalkontenentwicklung für Personengesellschaften und andere Mitunternehmerschaften
- 3.3.6.6 Sonder– und Ergänzungsbilanzen
- 3.3.6.7 Steuerliche Gewinnermittlung
- 3.3.7 Branchenspezifische Taxonomien
- 3.3.7.1 Spezialtaxonomie
- 3.3.7.2 Ergänzungstaxonomie
- 3.3.7.3 Übersicht der branchenspezifischen Taxonomien
- 3.3.8 Positionseigenschaften
- 3.3.8.1 Mindestumfang
- 3.3.8.2 Mussfeld
- 3.3.8.3 Mussfeld, Kontennachweis erwünscht
- 3.3.8.4 Summenfeld
- 3.3.8.5 Rechnerisch notwendige Positionen
- 3.3.8.6 Auffangpositionen
- 3.3.8.7 Unzulässige Positionen
- Die Entstehung und Entwicklung der Elektronischen Bilanz
- Die verschiedenen Anwendungsbereiche der E-Bilanz
- Die Funktionsweise der Taxonomie und der XBRL-Standard
- Die Auswirkungen der E-Bilanz auf Unternehmungen und Finanzbehörden
- Kritikpunkte an der E-Bilanz aus verschiedenen Perspektiven
- Kapitel 1: Einführung in die Elektronische Bilanz und den Ablauf der Bachelorthesis
- Kapitel 2: Beschreibung der Elektronischen Bilanz, ihrer Definition, ihres Hintergrunds und ihrer chronologischen Entwicklung
- Kapitel 3: Darstellung der verschiedenen Anwendungsbereiche der E-Bilanz, einschließlich des persönlichen, zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereiches
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis befasst sich mit der Entwicklung, Darstellung und kritischen Würdigung der Elektronischen Bilanz. Sie zielt darauf ab, dem Leser einen umfassenden Einblick in das Thema zu verschaffen und die wichtigsten Aspekte der E-Bilanz zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen der Bachelorthesis sind: Elektronische Bilanz, E-Bilanz, XBRL, Taxonomie, GCD-Modul, GAAP-Modul, Steuerpflichtige, Finanzverwaltung, Risikomanagementsystem, Betriebsprüfung, Datenschutz, Rechtliche Grundlagen, Kritikpunkte, Umstellung, Buchhaltung, Kontenplan.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine E-Bilanz?
Die E-Bilanz ist die elektronische Übermittlung von Jahresabschlussdaten an das Finanzamt, basierend auf dem Steuerbürokratieabbaugesetz.
Was versteht man unter der "Taxonomie" bei der E-Bilanz?
Die Taxonomie ist ein strukturiertes Datenschema (basierend auf dem XBRL-Standard), das festlegt, welche Bilanzpositionen in welcher Form elektronisch übermittelt werden müssen.
Wer ist zur Abgabe einer E-Bilanz verpflichtet?
Grundsätzlich sind alle bilanzierenden Unternehmen verpflichtet, ihre Abschlussdaten elektronisch zu übermitteln, wobei es Ausnahmen für Härtefälle gibt.
Was sind die Vorteile der E-Bilanz für die Finanzverwaltung?
Sie ermöglicht eine effizientere Betriebsprüfung, ein automatisiertes Risikomanagementsystem und einen schnelleren Datenabgleich.
Welche Berichtsbestandteile umfasst die elektronische Übermittlung?
Dazu gehören die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, steuerliche Modifikationen sowie ggf. Sonder- und Ergänzungsbilanzen.
- Arbeit zitieren
- Florian Ollmann (Autor:in), 2014, E-Bilanz. Entwicklung, Darstellung und kritische Würdigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284017