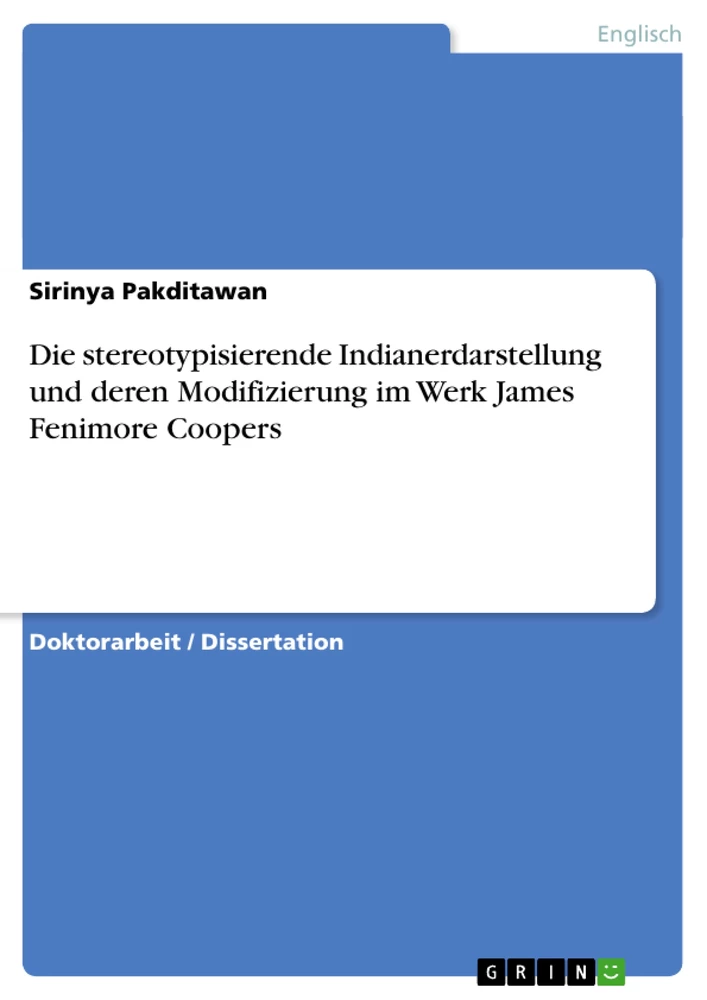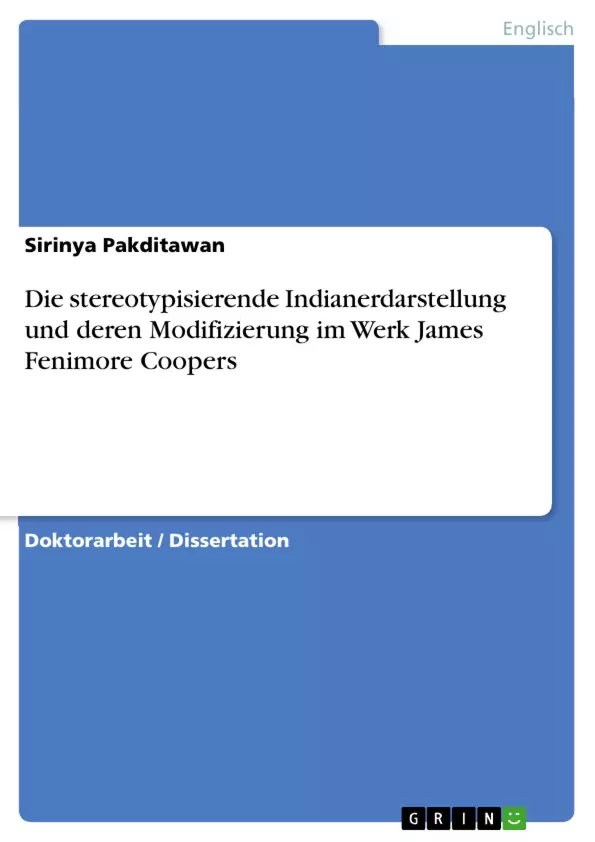The Leather-Stocking stories illustrate (…) the Indian’s shifting role on the American frontier.
James Fenimore Cooper gilt als Amerikas erster Mythopoet, herausragender Vertreter der amerikanischen Romantik, Vater der amerikanischen Nationalliteratur und als „amerikanischer Scott“, weil er Themen aus der amerikanischen Geschichte verarbeitete. Dabei „fiktionalisierte“ er historische Ereignisse, indem er sie in die tradierten Formen einer Romanhandlung umgoss und von der Ebene des individuellen Erlebens her beleuchtete. Hierbei bekannte sich Cooper nicht nur zu einem genuin amerikanischen Schauplatz (setting), sondern erstritt mit seinen indianischen Protagonisten die Literaturwürdigkeit der nordamerikanischen Ureinwohner. Im Rahmen seines umfangreichen Werkes stellen vor allem die Leatherstocking Tales den amerikanischen Mythos schlechthin dar und bilden darüber hinaus den Beginn der Indianerliteratur des 19. Jahrhunderts. Coopers Indianerfiguren wurden infolge der breiten Rezeption sowohl in Amerika als auch in Europa zum Inbegriff des „Roten Mannes“. So schrieb beispielsweise der Kritiker Paul Wallace im Jahr 1954: „For a hundred years ’The Leatherstocking Tales’ cast a spell over the reading public of America and Europe and determined how the world was to regard the American Indian“. Coopers Indianerdarstellung hat also wesentlich dazu beigetragen, dass sich das gegensätzliche Indianerbild vom „guten“ und „bösen“ Indianer zu dem Mythos vereinigen konnte, der sich bis in die heutige Zeit hinein durchsetzen konnte: „by developing powerful images to symbolize both extremes of feeling about the red man (…) [Cooper] created one of the major nineteenth-century myths about America“.
Die Lederstrumpf-Romane, aber auch andere Indianerromane Coopers, verarbeiten also Grunderfahrungen und –probleme der jungen amerikanischen Nation und rufen somit auf der Ebene der literarischen Realität vor allem die Indianerfrage als ein amerikanisches Grundsatzproblem ins öffentliche Bewusstsein. Auf diese Weise sind einerseits narzisstische Selbstspiegelung, ob des unaufhaltsamen Wachsens der jungen amerikanischen Nation, sowie andererseits bußfertige Selbstanklage, ob der rücksichtslosen Vertreibung der Ureinwohner und der damit verbundenen Trauer über den Untergang der indianischen Welt, in ihrer unaufhebbaren Ambivalenz literarisch in Coopers Indianerromanen greifbar. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Stereotypisierende Indianerbilder in der nordamerikanischen Literatur
- 1.1 Das Indianerbild der Puritaner
- 1.1.1 Exkurs: Der „,teuflische Wilde“ der Captivity narrative
- 1.1.2 Revision der Erfahrung mit den Indianern und erste ethnologische Ansätze
- 1.2 Der „,edle Wilde“ in der europäischen Tradition des Fremden
- 1.3 Der „edle Wilde" der Amerikaner und andere amerikanisch-indianische Stereotypen
- 1.3.1 The vanishing American
- 1.3.2 Der „gute" Indianer
- 1.3.3 Der blutrünstige und der degenerierte Indianer
- 1.1 Das Indianerbild der Puritaner
- 2. Coopers problembewusste Indianer-Bearbeitung
- 2.1 Coopers Informationsquellen
- 2.2 Festschreibung und Verarbeitung der Quellen
- 2.2.1 Captivity narratives und melodramatische Erlebnismuster
- 2.2.2 Die Herrnhuter Indianermission
- 2.2.3 Der Missionar Heckewelder
- 3. Indianer-Typen in The Last of the Mohicans
- 3.1 Stereotype Charakterisierung des indianischen Wesens
- 3.1.1 ,,Typische" Indianer und die „guten“ Delawaren
- 3.1.2 Die,,bösen" Huronen
- 3.2 Naturgebundenheit und Statik als Merkmale der indianischen Zivilisation
- 3.1 Stereotype Charakterisierung des indianischen Wesens
- 4. Magua: Der „teuflische Wilde“ mit komplexem Charakter
- 4.1 Äußere Erscheinung und Verhalten
- 4.2 Negative Charakterentwicklung und Widerspruch zur angloamerikanischen Zivilisation
- 5. Uncas: Der zivilisationswillige „edle Wilde“
- 5.1 Äußere Erscheinung und Verhalten
- 5.2 Positiver Entwicklungsprozess und Affiliation mit der angloamerikanischen Zivilisation
- 5.3 Uncas-Magua: Ein Antagonistenpaar mit Analogien
- 6. Chingachgook: Der unzivilisierbare,,edle Wilde"
- 6.1 Ambivalentes Wesen des nicht zivilisierbaren „guten“ Indianers
- 6.2 Vom „guten“ zum degenerierten Indianer
- 7. Scalping Peter: Vom gefährlichen zum degenerierten Indianer
- 7.1 Ursprüngliche Gefährlichkeit und mangelnde Einsicht
- 7.2 Von der plötzlichen Konversion zum Relikt der Vergangenheit
- 8. Conanchet: Der akkulturierte „gute“ Indianer
- 8.1 Von der Gefangenschaft zur ansatzweisen Assimilation
- 8.2 Der Tod als endgültige Rückkehr zur indianischen Zivilisation
- 9. Resümee
- 10. Literaturverzeichnis
- 10.1 Primärliteratur
- 10.2 Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht die stereotypisierende Indianerdarstellung im Werk James Fenimore Coopers und analysiert, wie diese Stereotypen in seinen Romanen, insbesondere in "The Last of the Mohicans", modifiziert und komplexer dargestellt werden. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Indianerbildes in der nordamerikanischen Literatur und beleuchtet die verschiedenen Stereotypen, die in Coopers Werken verarbeitet werden.
- Die Entwicklung des Indianerbildes in der nordamerikanischen Literatur
- Die Rolle von Stereotypen in Coopers Werken
- Die Modifizierung von Stereotypen in "The Last of the Mohicans"
- Die Darstellung von Indianern als „edle Wilde“ und „teuflische Wilde“
- Die Ambivalenz des Indianerbildes in Coopers Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt James Fenimore Cooper als Amerikas ersten Mythopoeten und Vater der amerikanischen Nationalliteratur vor. Sie beleuchtet die Bedeutung seiner Indianerfiguren und die Rolle seiner Werke in der Entwicklung der Indianerliteratur des 19. Jahrhunderts. Die Einleitung betont die Ambivalenz des Indianerbildes in Coopers Romanen und die Bedeutung der Indianerfrage als ein amerikanisches Grundsatzproblem.
Kapitel 1 analysiert die stereotypisierende Indianerdarstellung in der nordamerikanischen Literatur. Es werden die verschiedenen Indianerbilder der Puritaner, die Vorstellung des „edlen Wilden“ in der europäischen Tradition und die Entwicklung von Stereotypen in der amerikanischen Literatur beleuchtet.
Kapitel 2 untersucht Coopers Informationsquellen und die Art und Weise, wie er diese in seinen Romanen verarbeitet. Es werden die Bedeutung von Captivity narratives, die Rolle der Herrnhuter Indianermission und die Einflussnahme des Missionars Heckewelder auf Coopers Werke beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die verschiedenen Indianer-Typen in "The Last of the Mohicans". Es werden die stereotypen Charakterisierungen des indianischen Wesens, die Darstellung von Naturgebundenheit und Statik als Merkmale der indianischen Zivilisation sowie die Ambivalenz des Indianerbildes in Coopers Romanen beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht die Figur des Magua, der als „teuflischer Wilde“ dargestellt wird. Es werden seine äußere Erscheinung, sein Verhalten und seine negative Charakterentwicklung analysiert.
Kapitel 5 analysiert die Figur des Uncas, der als zivilisationswilliger „edler Wilde“ dargestellt wird. Es werden seine äußere Erscheinung, sein Verhalten und sein positiver Entwicklungsprozess beleuchtet.
Kapitel 6 untersucht die Figur des Chingachgook, der als unzivilisierbarer „edler Wilde“ dargestellt wird. Es werden seine Ambivalenz, seine positive und negative Entwicklung sowie die Frage der Zivilisierbarkeit des „guten“ Indianers beleuchtet.
Kapitel 7 analysiert die Figur des Scalping Peter, der als gefährlicher und degenerierter Indianer dargestellt wird. Es werden seine ursprüngliche Gefährlichkeit, seine plötzliche Konversion und seine Rolle als Relikt der Vergangenheit beleuchtet.
Kapitel 8 untersucht die Figur des Conanchet, der als akkulturierter „guter“ Indianer dargestellt wird. Es werden seine Gefangenschaft, seine ansatzweise Assimilation und sein Tod als endgültige Rückkehr zur indianischen Zivilisation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die stereotypisierende Indianerdarstellung, die Modifizierung von Stereotypen, James Fenimore Cooper, "The Last of the Mohicans", "edle Wilde", "teuflische Wilde", Captivity narratives, Herrnhuter Indianermission, Naturgebundenheit, Zivilisation, Assimilation, Degeneration, Indianerfrage, amerikanische Nationalliteratur.
- Quote paper
- Dr. Sirinya Pakditawan (Author), 2008, Die stereotypisierende Indianerdarstellung und deren Modifizierung im Werk James Fenimore Coopers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284058