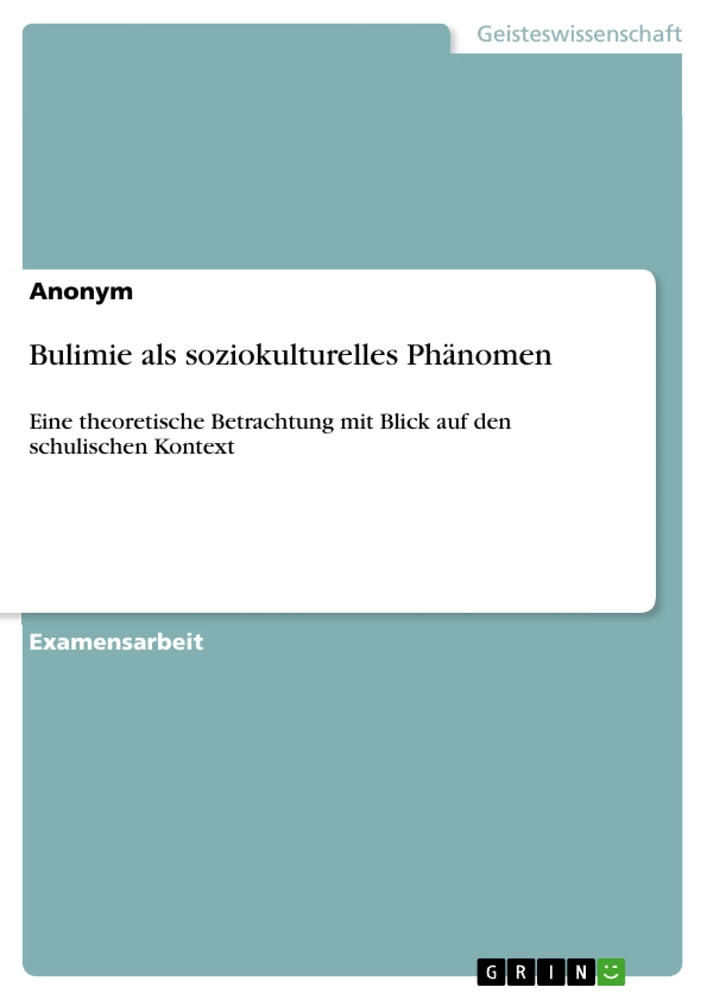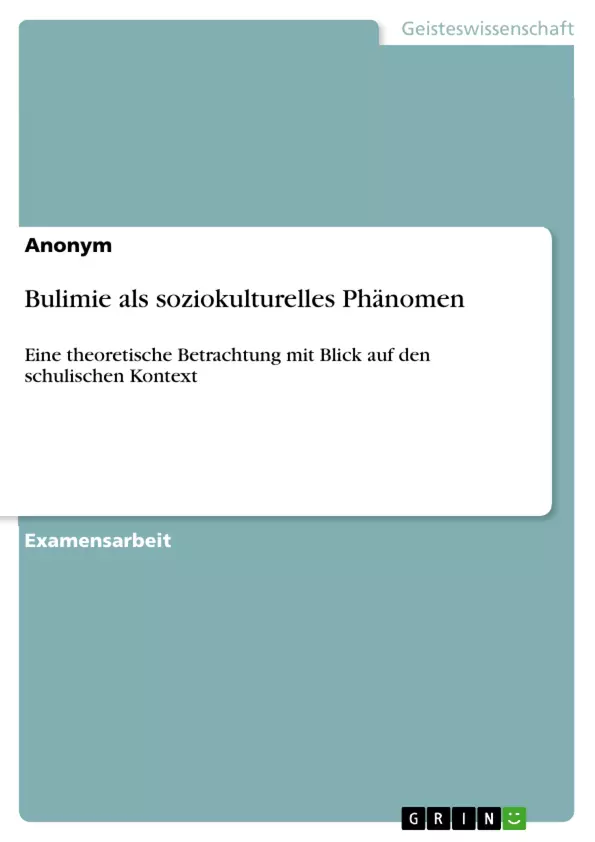Noch nie war das öffentliche Interesse am Zubereiten von Essen so groß wie heute. Kochsendungen sind so beliebt, wie noch nie. Auf allen Fernsehkanälen kochen prominente Köche mehr oder weniger spektakuläre Gerichte. Verwendet werden meist hochwertige Zutaten, die auf raffinierte Art und Weise veredelt werden. Jung und Alt sind fasziniert, wenn die Küchenvirtuosen auf ihren Kücheninstrumenten Balladen des guten Geschmacks komponieren.
Mittlerweile fachsimpeln wir Laien über Gesundes und Wertvolles, sowie über Nährwerte und Indizes, die verschiedene Lebensmittel haben. Dieser Essenskult, der als Lifestyle daherkommt, liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Essstörungen, denen die moderne Gesellschaft ausgeliefert ist. Denn zu dem gewandelten Menschenbild moderner Gesellschaften gehört ein makelloser, sportlich schlanker Körper, der auf „Teufel komm raus“ geformt und ausgebildet werden muss, koste es was es wolle.
Hollywood Stars und Sternchen machen es vor. Ein ungeheurer Druck lastet auf den Schauspielern. Ihr Kapital, nämlich ihren Körper auf Gardemaß zu halten. Die Regenbogen-Presse zeigt uns eine schillernde Welt, in der jedes Kilogramm zu viel verpönt ist. Die Hochglanzbilder vermitteln einen Ist-Zustand von makelloser Haut, wallenden Haaren, langen Beinen, perfekt geformte Po´s und hervortretenden Brüsten, der für ein junges Mädchen nur schwer zu erreichen ist.
Sportliche Exesse wechseln sich mit Diäten ab und aus der angestrebten Glückseeligkeit wird oft Unglück, Trauer und Einsamkeit. Das gilt für das Model genauso wie für das Mädchen von neben an.
Neben Sport und Diäten greifen manche Menschen, zumeist junge Frauen aber auch, zum Mittel der Vomitation. Dieses Phänomen ist nichts neues. Waren es doch die alten Römer, die sich eine Feder in den Rachen einbrachten, um den Magen zu leeren, damit noch mehr von den köstlichen Früchten verspeist werden konnten.
Aber wann ist es die Gier nach unendlichem Genuss und wann ein Krankheitsbild, deren Opfer professioneller Hilfe bedürfen? Wie gestaltet sich dieses soziokulturelles Phänomen, dass wir als Bulimie bezeichnen? Diesen Fragen geht diese vorliegende Arbeit unter anderem nach. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Essstörungen
- 2.1 Definition von Essstörungen
- 2.2 Hauptformen der Essstörung
- 2.3 Abweichendes Essverhalten im historischen Verlauf
- 2.4 Essstörungen in der heutigen Gesellschaft
- 3. Bulimia nervosa als eine Essstörung
- 3.1 Begrifflichkeit
- 3.2 Symptomatik
- 3.2.1 Bulimisches Essverhalten
- 3.2.2 Psychische Charakteristika
- 3.2.2.1 Psychodynamik
- 3.2.2.2 Komorbidität
- 3.3 Diagnostische Kriterien
- 3.4 Epidemiologie
- 4. Ätiologie
- 4.1 Prädisponierende Faktoren
- 4.1.1 Familiäre Faktoren
- 4.1.1.1 Familiendynamik
- 4.1.1.2 Mutterrolle
- 4.1.1.3 Vaterrolle
- 4.1.1.4 Geschwister
- 4.1.2 Soziokulturelle Ursachen
- 4.1.2.1 Veränderte Lebenswelt
- 4.1.2.2 Gesellschaftliche Frauenrolle
- 4.1.2.3 Das unerreichbare Schlankheitsideal
- 4.1.3 Individuelle Faktoren
- 4.1.3.1 Probleme der Identitätsfindung
- 4.1.3.2 Persönlichkeitsmerkmale
- 4.1.4 Biologische Theorien
- 4.2 Auslösende Bedingungen
- 4.2.1 Kritische Entwicklungsphase – Pubertät
- 4.2.2 Traumatische Erlebnisse
- 5. Folgeschäden der Bulimie
- 5.1 Medizinische Komplikationen der Bulimie
- 5.2 Psychische Erkrankungen
- 6. Fallbeispiel
- 7. Therapie der Bulimie
- 7.1 Therapeutische Hilfe
- 7.2 Ambulante und Stationäre Therapie
- 7.2.1 Ambulante Therapie
- 7.2.2 Stationäre Therapie
- 7.2.3 Teilstationäre Behandlung
- 7.3 Einzeltherapie und Gruppentherapie
- 7.3.1 Einzeltherapie
- 7.3.2 Gruppentherapie
- 7.4 Psychotherapieverfahren
- 7.4.1 Psychotherapeutische Ansätze
- 7.4.1.1 Psychoanalyse
- 7.4.1.2 Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie
- 7.4.1.3 Systematische Familientherapie
- 7.4.1.4 Verhaltenstherapie
- 7.4.2 Einleitung und Umsetzung von Veränderungen
- 7.4.2.1 Einstieg in die Psychotherapie - Motivationsphase
- 7.4.2.2 Ernährungsberatung - „Anti-Diät-Konzept“
- 7.4.2.3 Essprotokolle
- 7.4.2.4 Übungen zur Selbstwahrnehmung und körpertherapeutische Arbeit
- 7.4.2.5 Therapeutische Arbeit am Essverhalten
- 7.4.2.6 Gewichtsverträge und Essenspläne
- 7.4.2.7 Therapieziel: Überwindung von Heißhungerattacken und selbsthervorgerufenem Erbrechen
- 7.5 Medikamentöse Therapie
- 7.6 Therapeutische Fallstricke und wiederkehrende Probleme in der Therapie
- 8. Konsequenzen für die Schulpraxis
- 8.1 Erzieherischer Auftrag der Schule und Bildungsplanbezug
- 8.2 Suchtpräventionsmodell – „Torera“
- 8.2.1 Grundkonzept von „Torera“
- 8.2.2 Neun Lektionen von „Torera“
- 8.3 Unterrichtsbeispiele
- 9. Verallgemeinerung der Erkenntnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht Bulimie als soziokulturelles Phänomen und betrachtet ihren Einfluss auf den schulischen Kontext. Ziel ist es, die Ursachen, Auswirkungen und Therapieansätze von Bulimie zu beleuchten.
- Definition und Erscheinungsformen von Essstörungen
- Soziokulturelle Faktoren bei der Entstehung von Bulimie
- Psychische und physische Folgen von Bulimie
- Therapieoptionen bei Bulimie
- Präventionsansätze im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt einen Kontrast zwischen dem steigenden öffentlichen Interesse am Kochen und der gleichzeitig verbreiteten Problematik von Essstörungen dar. Sie verweist auf den gesellschaftlichen Druck, einen makellosen Körper zu besitzen, der durch Medien und Prominente verstärkt wird und die Entwicklung von Essstörungen wie Bulimie begünstigt. Die Erwähnung der alten Römer und ihrer Praxis des Erbrechens nach üppigen Mahlzeiten verdeutlicht, dass das Phänomen des Erbrechens zur Gewichtskontrolle kein rein modernes Problem ist, sondern historische Parallelen aufweist.
2. Essstörungen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in das Thema Essstörungen. Es definiert Essstörungen allgemein und beschreibt die Hauptformen, beleuchtet deren historischen Verlauf und analysiert ihre Präsenz in der heutigen Gesellschaft. Der Abschnitt legt die Grundlage für das tiefere Verständnis von Bulimie im weiteren Verlauf der Arbeit.
3. Bulimia nervosa als eine Essstörung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Bulimie nervosa als spezifische Essstörung. Es definiert den Begriff, beschreibt die Symptomatik (bulimisches Essverhalten und psychische Charakteristika inklusive Psychodynamik und Komorbidität), diagnostische Kriterien und die epidemiologischen Aspekte der Erkrankung. Dieser Abschnitt liefert detaillierte Informationen über die Erkrankung selbst, um die folgenden Kapitel besser kontextualisieren zu können.
4. Ätiologie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen von Bulimie. Es analysiert prädisponierende Faktoren wie familiäre, soziokulturelle und individuelle Einflüsse sowie biologische Theorien. Die detaillierte Untersuchung verschiedener Faktoren (Familiendynamik, gesellschaftliche Frauenrolle, Schlankheitsideal, Probleme der Identitätsfindung, Persönlichkeitsmerkmale) bietet ein umfassendes Bild der komplexen Ursachen der Bulimie.
5. Folgeschäden der Bulimie: Dieser Abschnitt beschreibt die medizinischen und psychischen Folgen der Bulimie. Er beleuchtet die körperlichen Schäden und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken sowie die psychischen Erkrankungen, die häufig mit Bulimie einhergehen. Die Darstellung der Konsequenzen unterstreicht die Schwere der Erkrankung und die Notwendigkeit einer Behandlung.
7. Therapie der Bulimie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Therapieoptionen bei Bulimie. Es beschreibt verschiedene Ansätze, von der ambulanten und stationären Therapie über Einzel- und Gruppentherapie bis hin zu spezifischen Psychotherapieverfahren (Psychoanalyse, klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, systemische Familientherapie, Verhaltenstherapie). Die Beschreibung der einzelnen Therapiemethoden und der Umsetzung von Veränderungen (Ernährungsberatung, Essprotokolle, Übungen zur Selbstwahrnehmung usw.) zeigt die Vielschichtigkeit der Behandlung.
8. Konsequenzen für die Schulpraxis: Das Kapitel widmet sich den Konsequenzen der Bulimie für die Schulpraxis. Es beschreibt den erzieherischen Auftrag der Schule und den Bezug zum Bildungsplan sowie ein Suchtpräventionsmodell („Torera“) mit seinen Grundkonzepten und Unterrichtsbeispielen. Der Fokus liegt auf Präventionsmaßnahmen und der Rolle der Schule bei der Unterstützung betroffener Schüler.
Schlüsselwörter
Bulimie, Essstörung, Soziokultur, Schule, Prävention, Therapie, Ätiologie, Familiäre Faktoren, Soziokulturelle Faktoren, Psychische Gesundheit, Medizinische Komplikationen, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Suchtprävention.
Häufig gestellte Fragen zur wissenschaftlichen Hausarbeit über Bulimie
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Bulimie nervosa als soziokulturelles Phänomen und ihren Einfluss auf den schulischen Kontext. Sie beleuchtet Ursachen, Auswirkungen und Therapieansätze der Erkrankung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Erscheinungsformen von Essstörungen, soziokulturelle Faktoren bei der Entstehung von Bulimie, psychische und physische Folgen von Bulimie, Therapieoptionen bei Bulimie und Präventionsansätze im schulischen Kontext. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Betrachtung der Ätiologie von Bulimie, inklusive familiärer, soziokultureller und individueller Faktoren sowie biologischer Theorien. Des Weiteren werden verschiedene Therapieverfahren, wie Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und systemische Familientherapie, beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Hausarbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die den gesellschaftlichen Kontext von Essstörungen beleuchtet; ein Kapitel über Essstörungen im Allgemeinen; ein Kapitel spezifisch zu Bulimie nervosa, inklusive Symptomatik, Diagnostik und Epidemiologie; ein Kapitel zur Ätiologie von Bulimie; ein Kapitel über die Folgeschäden; ein Kapitel zur Therapie von Bulimie mit detaillierter Beschreibung verschiedener Therapieansätze; ein Kapitel zu den Konsequenzen für die Schulpraxis, inklusive eines Suchtpräventionsmodells; und abschließend eine Verallgemeinerung der Erkenntnisse und ein Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis von Bulimie zu vermitteln, ihre Ursachen und Folgen zu analysieren und einen Überblick über effektive Therapie- und Präventionsmaßnahmen zu geben, insbesondere im schulischen Kontext.
Welche Therapiemethoden werden in der Hausarbeit beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Therapiemethoden für Bulimie, darunter ambulante und stationäre Therapien, Einzel- und Gruppentherapien. Im Detail werden Psychotherapieverfahren wie Psychoanalyse, klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, systemische Familientherapie und Verhaltenstherapie erläutert. Zusätzlich wird die Bedeutung von Ernährungsberatung, Essprotokollen und Übungen zur Selbstwahrnehmung hervorgehoben.
Welche Rolle spielt der schulische Kontext in der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Konsequenzen von Bulimie für den schulischen Kontext und beschreibt den erzieherischen Auftrag der Schule im Umgang mit Essstörungen. Ein Suchtpräventionsmodell ("Torera") wird vorgestellt, um Präventionsmaßnahmen in der Schule zu illustrieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Bulimie, Essstörung, Soziokultur, Schule, Prävention, Therapie, Ätiologie, Familiäre Faktoren, Soziokulturelle Faktoren, Psychische Gesundheit, Medizinische Komplikationen, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Suchtprävention.
Gibt es ein Fallbeispiel in der Hausarbeit?
Ja, die Hausarbeit enthält ein Fallbeispiel, um die beschriebenen Konzepte zu veranschaulichen (genaueres wird im Text selbst beschrieben).
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit Bulimie, Essstörungen und Präventionsmaßnahmen auseinandersetzen möchten, insbesondere im Kontext Schule und Bildung.
Wo finde ich weitere Informationen zu Bulimie?
Weitere Informationen zu Bulimie finden Sie in Fachliteratur zur Psychologie, Psychiatrie und Ernährungsberatung. Auch entsprechende Organisationen und Selbsthilfegruppen bieten umfassende Informationen und Unterstützung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2012, Bulimie als soziokulturelles Phänomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284130