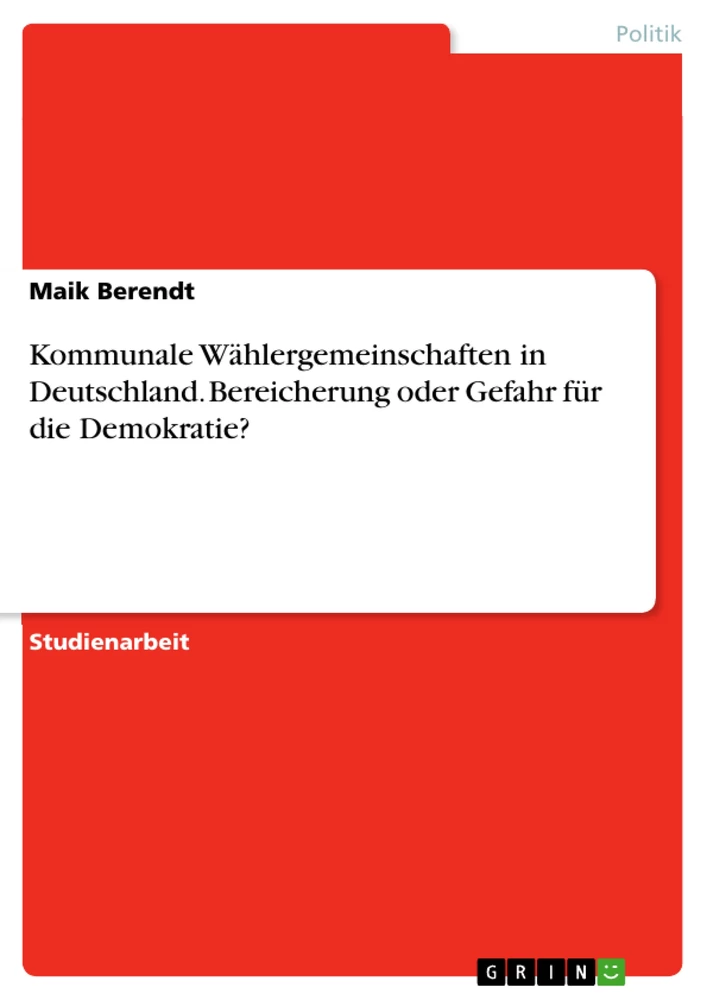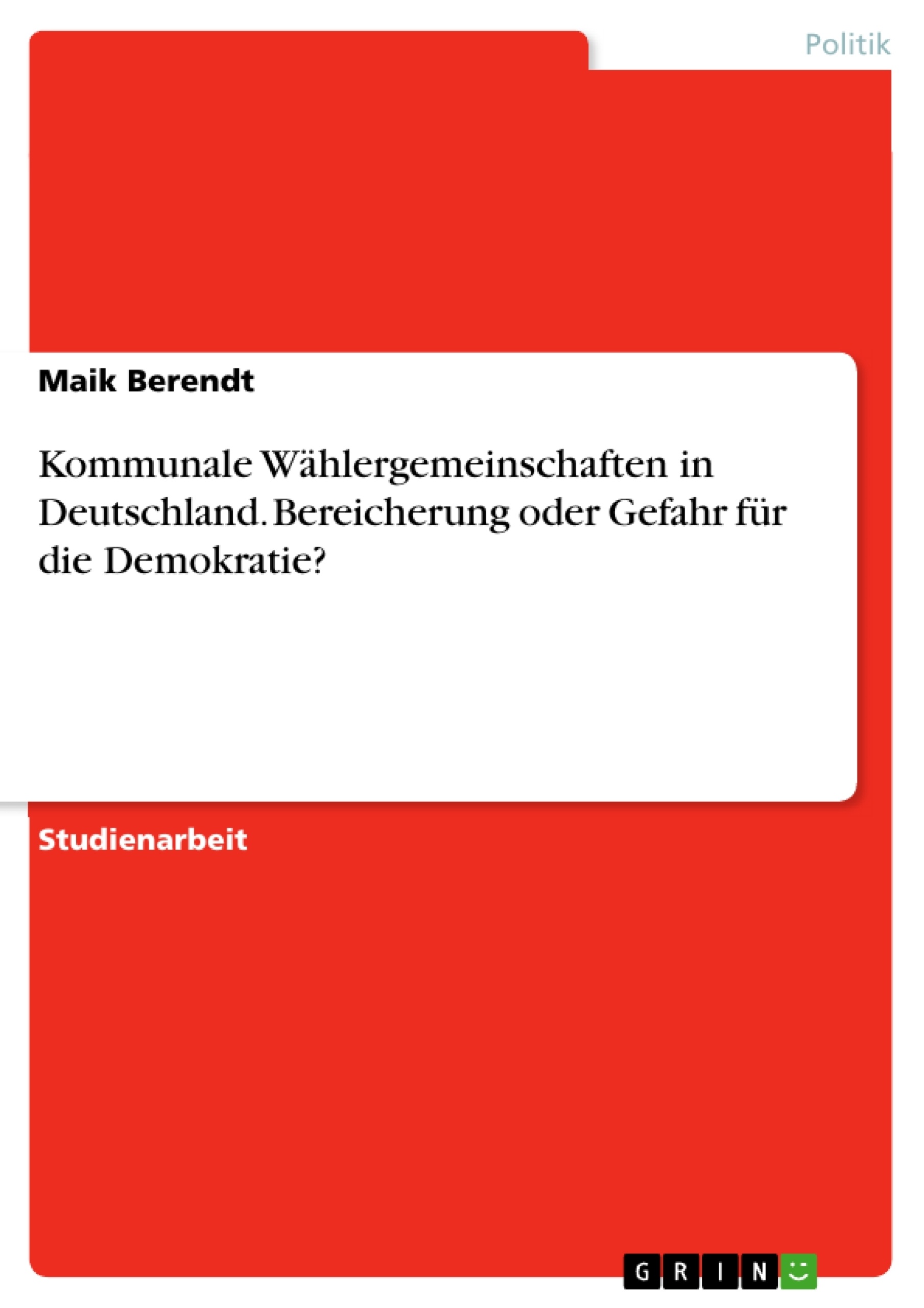Deutschlands politisches System wird als Parteiendemokratie bezeichnet. In der deutschen Kommunalpolitik gestalten jedoch nicht allein die Parteien die Politik. Zwar sind sie vor Ort die überwiegende politische Kraft, aber nicht konkurrenzlos oder gar monopolistisch. Die Kommunalwahlen in Brandenburg am 24. Mai 2014 sind von einem intensiven Wahlkampf und eben nicht nur durch bekannte Parteien geprägt gewesen. Verschiedenste Akteure, Wählergemeinschaften, Wählervereinigungen, Wähler-gruppen sowie Einzelkandidaten haben sich auf kommunaler Ebene den Wählerinnen und Wählern mit Plakaten, Flyern und Programmen zur Wahl gestellt. Im Landkreis Barnim waren z. B. neben den Parteien sechs Wählergruppen und zwei Listenvereinigungen wählbar. Sie haben damit, nicht zum ersten Mal, ihren Anspruch auf eine beständige Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess geltend gemacht. [...]
Es stellt sich die Frage, welche politischen Ziele diese Gruppen gerade auf kommunaler Ebene verfolgen. Wie gelingt es Ihnen, auf der untersten Selbstverwaltungsebene neben den auf Bundes- und Landesebene etablierten Parteien, durchaus erfolgreich an Kommunalwahlen teilzunehmen? Welche Motive verbinden die Mitglieder? Was macht sie für die Wählerinnen und Wähler vor Ort attraktiv? Inwieweit stärken sie den Pluralismus unserer parlamentarischen Demokratie? Oder stellen sie eine Schwächung unserer Demokratie dar und sind deshalb eine Gefahr für die Stabilität unseres parlamentarischen Systems? Anhand empirischer Untersuchungen exemplarischer Beispiele kommunaler Wählergemeinschaften sollen die aufgeworfenen Fragen erörtert und im Rahmen einer politologischen Analyse untersucht werden. Die Analyse bezieht sich auf die Form, die Prozesse und die Inhalte der Politik der Wählergemeinschaften. Dabei wird im Kapitel 2 „Politischer Handlungsrahmen“ die Form der Politik (polity) geklärt. In diesem Kapitel werden auch die wesentlichsten gesetzlichen Grundlagen für Wählergemeinschaften dargestellt, da die verfassungsrechtliche Stellung und gesetzliche Grundlage für Wählergemeinschaften nicht ohne weiteres erkennbar ist. In Kapitel 3 „Möglichkeiten der Akteure“ wird auf die Prozesse der Politik (politics) und in Kapitel 4 „Motive, Ziele und Inhalte“ werden die politischen Gestaltungsmaßnahmen (policy) analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politischer Handlungsrahmen
- Begriffsdefinition und Abgrenzung
- Parteien
- Bürgerbewegungen
- Bürgerinitiativen
- Wählergruppen
- Wählervereinigungen
- Wählergemeinschaften
- Institutionelle Rahmenbedingungen
- Gleichheit
- Freiheit
- Öffentlichkeit
- Politische Kultur
- Struktur
- Ausblick
- Begriffsdefinition und Abgrenzung
- Möglichkeiten der Akteure
- Methoden
- Legitimation
- Motive, Ziele und Inhalte
- Motive und Politische Ziele
- Inhalte Programme und Umsetzung
- Wirksamkeit der Programme
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Gesetze
- Gerichtsurteile
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der kommunalen Wählergemeinschaften in Deutschland und untersucht deren Bedeutung für die Demokratie. Sie analysiert die Entstehung, Struktur, Ziele und Inhalte dieser Gruppen sowie deren Einfluss auf den politischen Willensbildungsprozess auf kommunaler Ebene. Im Fokus stehen die Frage, ob Wählergemeinschaften eine Bereicherung oder eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen und inwieweit sie den Pluralismus unserer parlamentarischen Demokratie stärken oder schwächen.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung von Wählergemeinschaften im Kontext anderer politischer Organisationsformen
- Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen und rechtlichen Grundlagen für Wählergemeinschaften
- Untersuchung der Motive, Ziele und Inhalte der Politik von Wählergemeinschaften
- Bewertung der Wirksamkeit der Programme und Aktivitäten von Wählergemeinschaften
- Diskussion der demokratischen Potenziale und Herausforderungen, die mit Wählergemeinschaften verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Kommunale Wählergemeinschaften in Deutschland“ dar und führt in die Fragestellung ein. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung dieser Gruppen in der deutschen Kommunalpolitik und die damit verbundenen Fragen nach deren demokratischen Potential und möglichen Gefahren.
Kapitel 2 „Politischer Handlungsrahmen“ befasst sich mit der Begriffsdefinition und Abgrenzung von Wählergemeinschaften im Kontext anderer politischer Organisationsformen wie Parteien, Bürgerbewegungen, Bürgerinitiativen und Wählergruppen. Es werden die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für Wählergemeinschaften dargestellt, die sich aus dem Grundgesetz und dem Parteiengesetz ergeben.
Kapitel 3 „Möglichkeiten der Akteure“ analysiert die Prozesse der Politik von Wählergemeinschaften. Es werden die Methoden und Legitimationsgrundlagen dieser Gruppen untersucht, um zu verstehen, wie sie sich in den politischen Willensbildungsprozess einbringen und ihre Ziele durchsetzen können.
Kapitel 4 „Motive, Ziele und Inhalte“ befasst sich mit den politischen Gestaltungsmaßnahmen von Wählergemeinschaften. Es werden die Motive und Ziele dieser Gruppen sowie deren Programme und Inhalte analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die kommunalen Wählergemeinschaften, die deutsche Demokratie, den politischen Pluralismus, die Kommunalpolitik, die Parteiendemokratie, die politische Willensbildung, die Legitimation, die Wirksamkeit von Programmen, die Motive und Ziele von Wählergemeinschaften sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Gruppen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Wählergemeinschaften von politischen Parteien?
Wählergemeinschaften sind oft lokal begrenzt, haben keinen Parteistatus auf Landes- oder Bundesebene und konzentrieren sich primär auf kommunale Sachthemen.
Sind Wählergemeinschaften eine Gefahr für die Demokratie?
Die Arbeit untersucht, ob sie den Pluralismus stärken oder durch ihre Unabhängigkeit von etablierten Parteistrukturen die parlamentarische Stabilität schwächen.
Warum sind Wählergruppen vor Ort oft so erfolgreich?
Sie gelten als bürgernah, ideologisch weniger festgefahren und fokussieren sich auf konkrete Lösungen für lokale Probleme.
Welche rechtlichen Grundlagen gelten für Wählervereinigungen?
Ihre Stellung ergibt sich aus dem Grundgesetz und den jeweiligen Kommunalwahlgesetzen der Bundesländer, wobei sie nicht dem Parteiengesetz unterliegen.
Was motiviert Bürger, sich in Wählergemeinschaften zu engagieren?
Häufige Motive sind Unzufriedenheit mit etablierten Parteien, der Wunsch nach direkter Mitgestaltung und die Identifikation mit lokalen Interessen.
- Quote paper
- Maik Berendt (Author), 2014, Kommunale Wählergemeinschaften in Deutschland. Bereicherung oder Gefahr für die Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284132