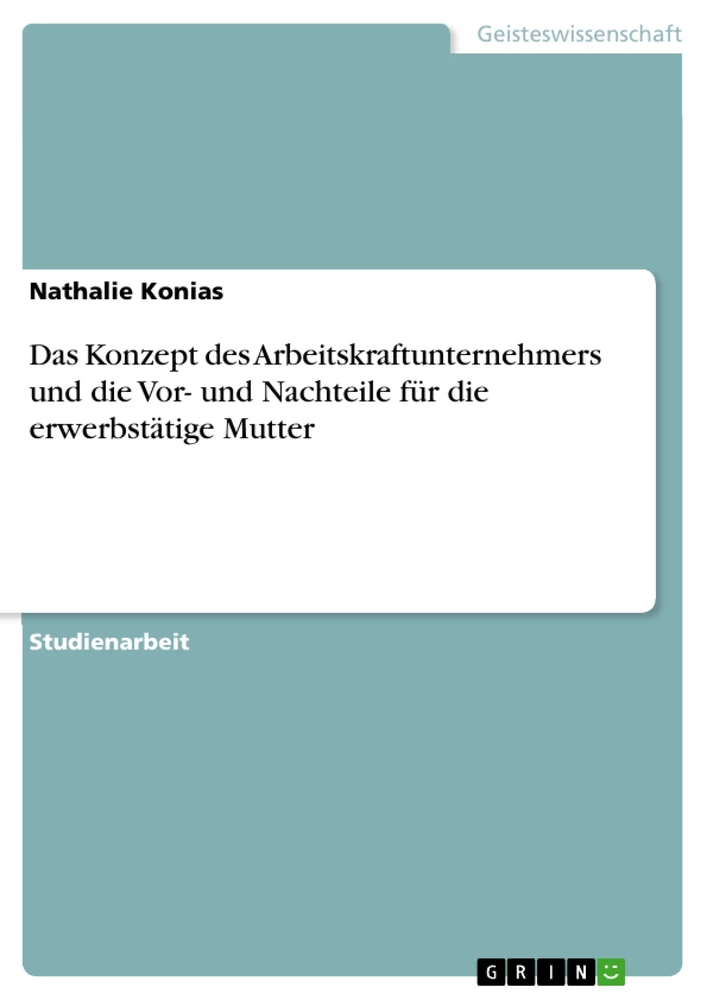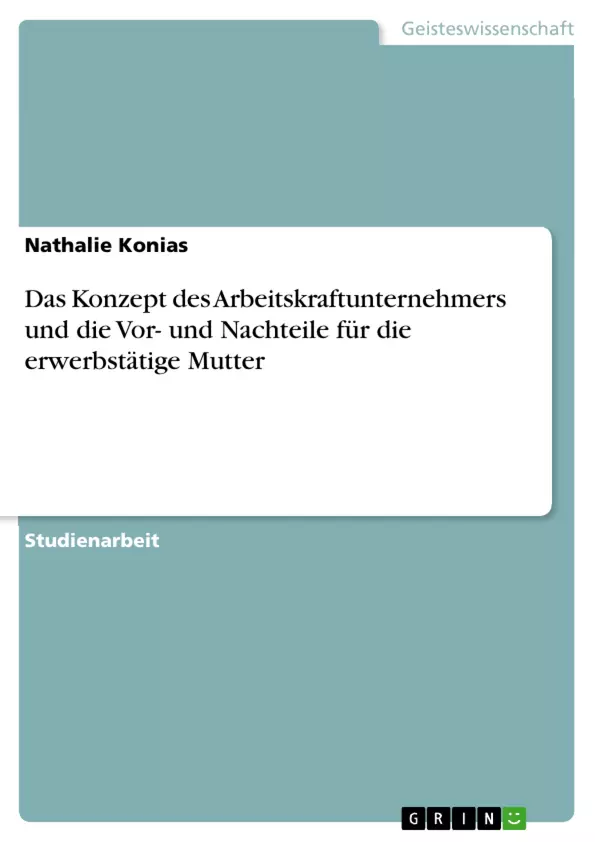Seit Ende der 1990er Jahre rückte der Begriff der „Entgrenzung“ stärker in den Fokus arbeits- und industriesoziologischer Diskussionen.
Diese Erosion von Grenzen aller Dimensionen einer Betriebsorganisation umfasst sowohl die Pluralisierung von Beschäftigungsformen, als auch die Flexibilisierung von Arbeitszeit bis hin zu einer rückläufigen Bindung an betriebliche Rahmenbedingungen. Das Phänomen der „Entgrenzung“ von Anforderungen an Arbeitnehmer fassten die Autoren Pongratz und Voß in ihren Untersuchungen zum Modell des Arbeitskraftunternehmers (im Weiteren AKU genannt) zusammen. Dieser Idealtypus soll, den Autoren folgend, zum Leitbild bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen werden können. Die theoretischen Deutungen und empirischen Forschungen zur Entwicklung von Arbeit sowie die Diskussion um den Arbeitskraftunternehmer sind männlich dominiert.
Vor dem Hintergrund, dass aber auch Frauen auf dem Arbeitsmarkt eine repräsentative Rolle einnehmen, soll in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf dem Arbeitskraftunternehmer als weibliche Arbeitnehmerin liegen.
In den Sozialwissenschaften wird die Frauenerwerbstätigkeit und deren Hemmnisse seit den 70er Jahren untersucht.
Pongratz und Voß erörterten in ihren Untersuchungen, dass der Arbeitskraftunternehmer weiblich sein kann, dabei wurde der Blickwinkel der erwerbstätigen Frau als Mutter jedoch eher vernachlässigt. Daher widmet sich die vorliegende Arbeit dem Modell des AKU im Kontext mit der Frauenerwerbstätigkeit insbe- sondere im Zusammenhang mit der Mutterrolle als einer weiteren Dimension. Die zentrale Frage ist, ob das Modell des AKUs für eine erwerbstätige Mutter erfüllbar ist und ob es eher positive oder negative Auswirkungen hat, also eher Fluch oder Segen für sie bedeutet.
Dazu wird zunächst die These des Arbeitskraftunternehmers dargestellt und auf die von den Autoren Pongratz und Voß entwickelten Ausprägungsebenen eingegangen. Als nächstes wird der derzeitige Ist-Zustand von Frauenerwerbstätigkeit umschrieben. Darauf aufbauend soll der Fokus auf der Erwerbsbeteiligung bei Müttern liegen. Es wird anhand sekundärstatistischer Analysen und unter Rückgriff auf Sekundärliteratur und Studien erörtert, dassdie Erwerbsorientierung der Frauen von bestimmten Ressourcen abhängt, um dann darauf aufbauend im folgenden Unterkapitel auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzugehen. Hier werden die strukturellen Bedingungen thematisiert, die eine Vereinbarkeit ermöglichen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE ARBEITSKRAFTUNTERNEHMERTHESE
- DIE DREI MERKMALE DES ARBEITSKRAFTUNTERNEHMERS
- Selbstökonomisierung
- Selbstrationalisierung
- Selbstkontrolle
- DIE DREI MERKMALE DES ARBEITSKRAFTUNTERNEHMERS
- FRAUEN UND BERUF
- ERWERBSBETEILIGUNG BEI MÜTTERN
- VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF
- SCHWIERIGKEITEN DER VEREINBARKEIT
- ERWERBSTÄTIGE MÜTTER ALS
ARBEITSKRAFTUNTERNEHMERINNEN
- ÜBEREINSTIMMUNGEN IM SINNE DES MODELLS AKU
- SCHWIERIGKEITEN DER VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND AKU
- SCHLUSSBETRACHTUNG UND FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept des Arbeitskraftunternehmers (AKU) und dessen Relevanz für erwerbstätige Mütter. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kontext des AKU-Modells zu analysieren und die Herausforderungen für Frauen in dieser Situation zu beleuchten.
- Das Konzept des Arbeitskraftunternehmers
- Die Erwerbsbeteiligung von Frauen
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Die Rolle der erwerbstätigen Mutter als Arbeitskraftunternehmerin
- Die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und AKU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der „Entgrenzung“ von Arbeitsbedingungen ein und stellt das Modell des Arbeitskraftunternehmers (AKU) vor. Die Arbeit fokussiert auf die erwerbstätige Mutter als AKU und untersucht, ob dieses Modell für sie erfüllbar ist und welche Auswirkungen es hat.
Kapitel 2 erläutert die Arbeitskraftunternehmerthese und ihre drei Merkmale: Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung und Selbstkontrolle. Es wird die Entwicklung des AKU-Modells im Kontext der modernen Arbeitswelt dargestellt.
Kapitel 3 beleuchtet die Erwerbsbeteiligung von Frauen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es werden die strukturellen Bedingungen und Schwierigkeiten der Vereinbarkeit analysiert, wobei die gesellschaftliche Betreuungsinfrastruktur und der Faktor Zeit eine wichtige Rolle spielen.
Kapitel 4 untersucht die Übereinstimmungen zwischen der erwerbstätigen Mutter und dem AKU-Modell. Es werden die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Sorge- und Hausarbeit mit der Rolle der Arbeitskraftunternehmerin dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Arbeitskraftunternehmer, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Mutterrolle, die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und AKU, die Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung und Selbstkontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Arbeitskraftunternehmer“ (AKU)?
Ein Idealtypus von Arbeitnehmer, der sich durch Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung und Selbstkontrolle auszeichnet.
Ist das AKU-Modell für erwerbstätige Mütter erfüllbar?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die hohen Anforderungen an Selbstmanagement mit der Sorgearbeit und Mutterrolle vereinbar sind.
Was bedeutet „Entgrenzung“ der Arbeit?
Das Verschwimmen der Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben sowie die Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort.
Welche Schwierigkeiten haben Mütter in diesem Modell?
Hauptprobleme sind die mangelnde Betreuungsinfrastruktur, Zeitnot und die Doppelbelastung durch Haus- und Erwerbsarbeit.
Was versteht man unter Selbstökonomisierung?
Die aktive Vermarktung und ständige Weiterentwicklung der eigenen Arbeitskraft als wäre man ein eigenes Unternehmen.
- Citation du texte
- Nathalie Konias (Auteur), 2014, Das Konzept des Arbeitskraftunternehmers und die Vor- und Nachteile für die erwerbstätige Mutter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284204