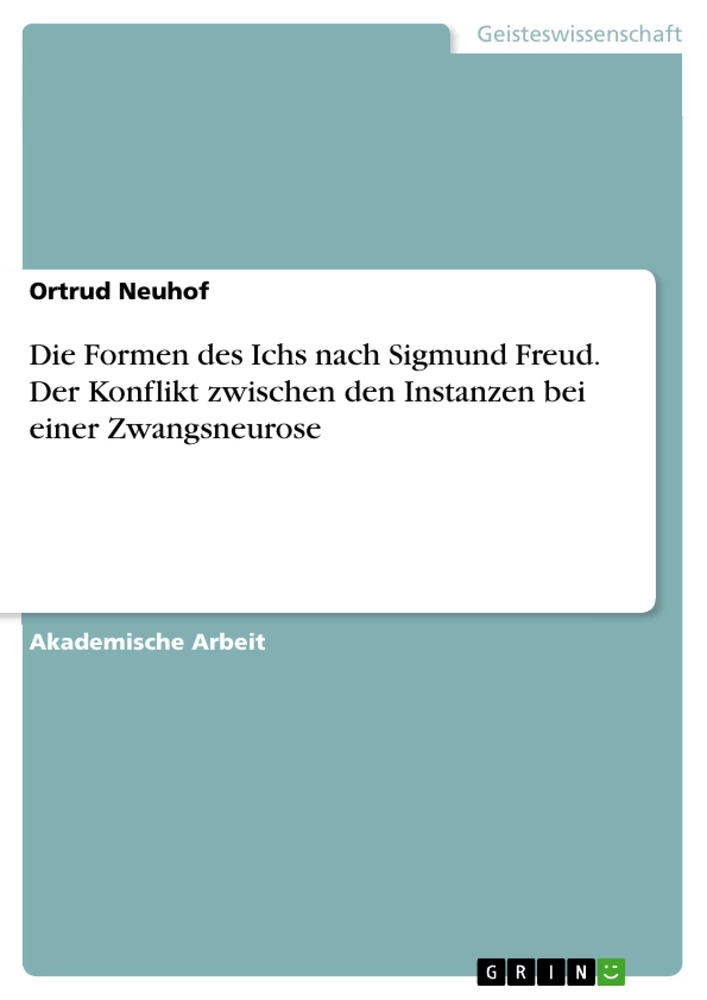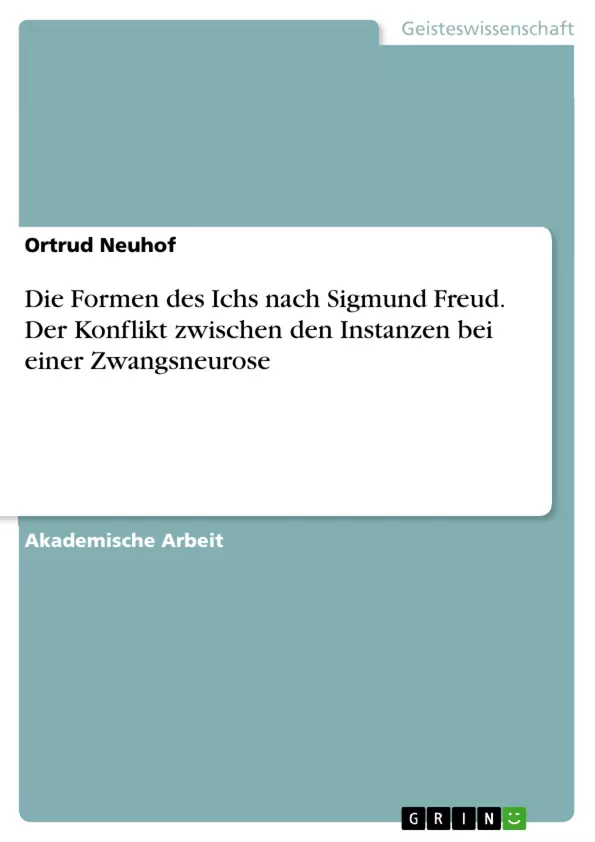Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Formen des Ichs, wie sie während einer Zwangsneurose bestehen können. Sie bezieht sich dabei vorwiegend auf die Ausführungen Sigmund Freuds. Besprochen werden im Zuge dessen das archaische Es und die Ambivalenz, das hypermoralische, sadistische Über-Ich sowie das sogenannte überforderte Ich.
Inhaltsverzeichnis
- Das archaische Es und die Ambivalenz
- Der phylogenetische - mythische Strang:
- Der evolutionistische- genetische Strang:
- Das hypermoralische, sadistische Über-Ich
- Die extreme Härte und Strenge des Über-Ichs bei der Zwangsneurose.
- Das überforderte Ich
- Die Handlungsstörung als Eigenart der zwangsneurotischen Ich-Struktur.
- Die Autonomie-Beweisnot.
- Der Autonomie-Abhängigkeitskonflikt.
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur).
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Ich-Struktur bei Zwangsneurotikern im Kontext der psychoanalytischen Theorie Sigmund Freuds. Sie untersucht die Rolle des archaischen Es, des hypermoralischen Über-Ichs und des überforderten Ichs bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwangsstörungen. Die Arbeit analysiert die Ambivalenz als zentrales Merkmal der zwangsneurotischen Ich-Struktur und beleuchtet die Auswirkungen dieser Ambivalenz auf das Denken, Handeln und die Gefühlswelt des Betroffenen.
- Die Ambivalenz als zentrales Merkmal der zwangsneurotischen Ich-Struktur
- Die Rolle des archaischen Es und des hypermoralischen Über-Ichs bei der Entstehung von Zwangsstörungen
- Die Auswirkungen der Ambivalenz auf das Denken, Handeln und die Gefühlswelt des Betroffenen
- Die Bedeutung der Handlungsstörung als Ausdruck der zwangsneurotischen Ich-Struktur
- Die Analyse des Autonomie-Abhängigkeitskonflikts bei Zwangsneurotikern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem archaischen Es des Zwangsneurotikers. Es wird die Ambivalenz als zentrales Merkmal dieser Ich-Struktur beleuchtet und anhand von Freuds Fallbeispiel des "Rattenmanns" veranschaulicht. Die Ambivalenz zeigt sich in der gleichzeitigen Existenz von Liebe und Hass gegenüber derselben Person, wobei der Hass oft unbewusst und durch Zwangsvorstellungen oder -handlungen zum Ausdruck kommt. Das Kapitel analysiert die Entstehung der Ambivalenz aus evolutionistischer und phylogenetischer Perspektive.
Das zweite Kapitel widmet sich dem hypermoralischen, sadistischen Über-Ich des Zwangsneurotikers. Es wird die extreme Härte und Strenge des Über-Ichs bei dieser Störung beleuchtet und die Auswirkungen auf das Selbstbild und das Verhalten des Betroffenen untersucht. Das Über-Ich setzt dem Ich hohe moralische Standards und übt einen starken Druck auf die Befolgung dieser Standards aus, was zu einem Gefühl der Überforderung und Schuldgefühlen führen kann.
Das dritte Kapitel analysiert das überforderte Ich des Zwangsneurotikers. Es wird die Handlungsstörung als Eigenart der zwangsneurotischen Ich-Struktur beleuchtet und die Bedeutung des Autonomie-Abhängigkeitskonflikts für die Entstehung von Zwangsstörungen untersucht. Das überforderte Ich ist nicht in der Lage, die Anforderungen des Über-Ichs und die Bedürfnisse des Es in Einklang zu bringen, was zu einer Störung des Handlungsablaufs und zu Zwangshandlungen führt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Zwangsneurose, die psychoanalytische Theorie Sigmund Freuds, das archaische Es, das hypermoralische Über-Ich, das überforderte Ich, die Ambivalenz, die Handlungsstörung, der Autonomie-Abhängigkeitskonflikt, die Fallgeschichte des "Rattenmanns" und die Bedeutung der Ambivalenz für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwangsstörungen.
- Citar trabajo
- Ortrud Neuhof (Autor), 2004, Die Formen des Ichs nach Sigmund Freud. Der Konflikt zwischen den Instanzen bei einer Zwangsneurose, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284256