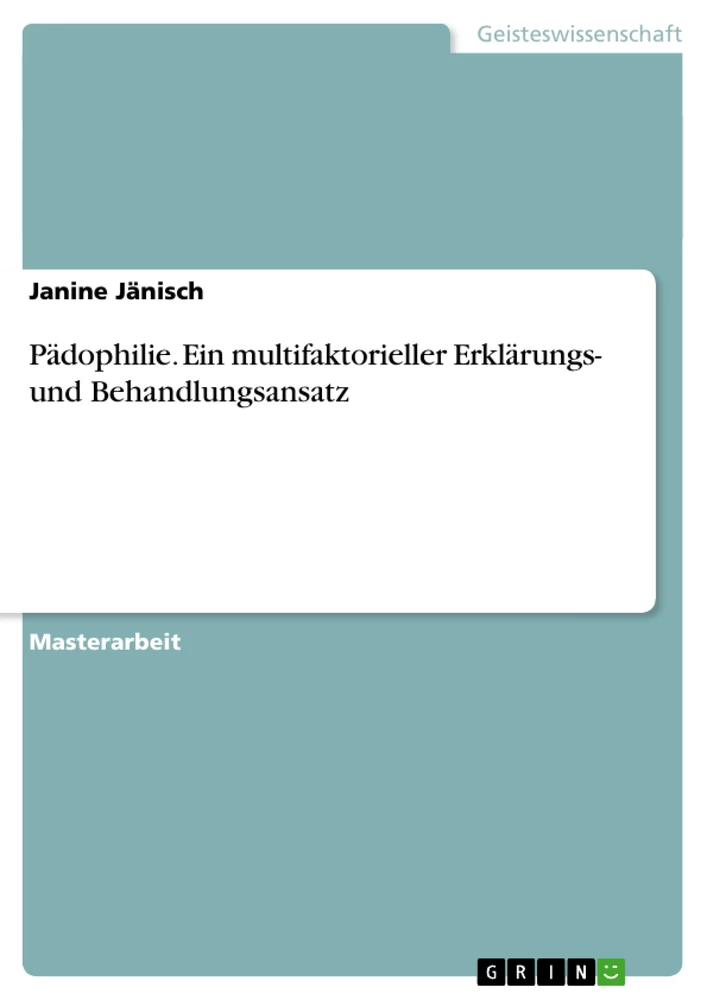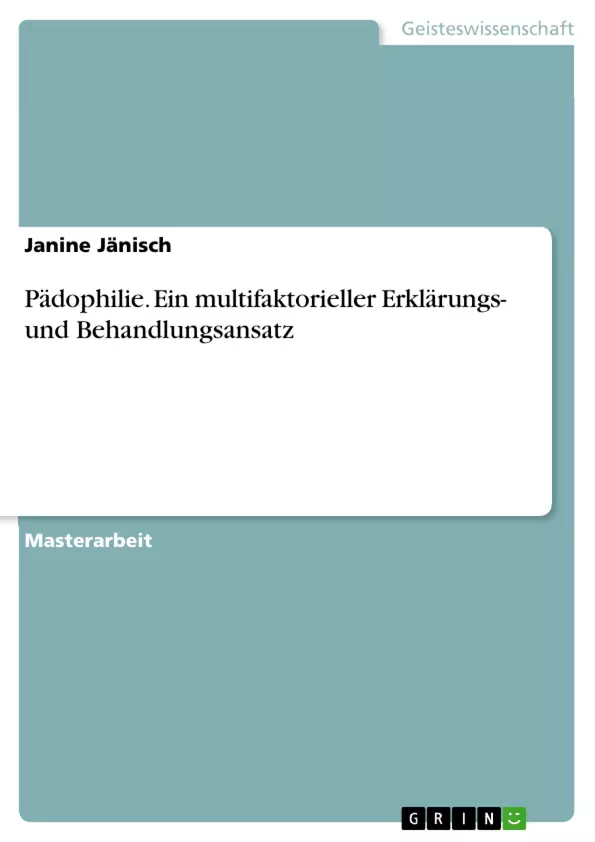Fragen: Welche Faktoren können bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Pädophilie eine Rolle spielen? Welche therapeutischen Maßnahmen können zur Behandlung von Pädophilie eingesetzt werden und sind diese durch aktuelle Studien als effektiv anzusehen?
Methode: Mittels Literaturrecherche werden Publikationen aus Datenbanken wie OPAC, springerlink, psycontent, medline, pubmed und sciencedirect zur Bearbeitung herangezogen; Suchbegriffe: Pädophilie, Ätiologie, Therapie.
Ergebnisse: Strauß (2007) beschreibt die Pädophilie als eine Störung, bei der die sexuelle Befriedigung durch den Kontakt mit Kindern (real oder in der Phantasie) erfolgt. Aufgrund dieses gesellschaftlich unerwünschten Verhaltens suchen Erkrankte nur vereinzelt psycho-therapeutische Hilfen auf. Daraus schlussfolgerte Strauß bereits 2002, dass die Prävalenz viel höher einzuschätzen ist als damalige Studien zeigen.
Der lerntheoretische Ansatz greift auf die klassische Konditionierung zurück, in dem frühe sexuelle Erfahrungen als begünstigende Faktoren wirken können (Hammelstein & Hoyer, 2006). Hingegen geht das kognitiv-behaviorale Pfadmodell zur Erklärung des sexuellen Kindesmissbrauchs nach Ward und Siegert (2002) davon aus, dass es vier Primärfaktoren gibt, die durch ätiologische Bedingungen wie z.B. unsichere Bindungen, entstanden sind und dazu führen, dass es zu einem sexuellen Missbrauch kommt.
Der kognitiv-behaviorale Ansatz besagt, dass die Pädophilie mittels der Rückfallprävention behandelt werden kann (Hammelstein & Hoyer, 2006). Das Risiko, sich erneut abweichend zu verhalten, konnte durch dessen Einsatz gesenkt werden (Alexander, 1999). Das Ziel ist eine Erhöhung der Kontrolle über die sexuell abweichenden Verhaltensweisen und gilt darüber hinaus als Maßnahme zum präventiven Opferschutz (Kockott, 2003).
Diskussion: Nach Hammelstein und Hoyer (2006) konnte bislang der Großteil der Erklärungsansätze, zur Entstehung einer Pädophilie, nicht empirisch nachgewiesen werden. Aus diesem Grund weisen Berner und Kockott (2006) darauf hin, dass die Komplexität der Erkrankung multifaktoriell erklärt werden sollte. Laut Hammelstein und Hoyer (2006) wurden die Behandlungsansätze zudem kaum empirisch überprüft. Dennoch schildern sie, dass sich vor allem das Konzept der Rückfallprävention als erfolgsversprechend herauskristallisiert hat. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Das Krankheitsbild der Pädophilie
- Klinisches Erscheinungsbild
- Epidemiologie, Verlauf und Prognose
- Klassifikation
- Zusammenfassung zum Krankheitsbild der Pädophilie
- Ein multifaktorieller Erklärungsansatz
- Psychoanalytischer und psychodynamischer Ansatz
- Lerntheoretischer Ansatz
- Neurologischer Ansatz
- Kognitiv-behavioraler Ansatz
- Integrative Erklärungsmodelle
- Prädispositionstheorie von Finkelhor (1984)
- Integrierende Theorie von Money (1986)
- Vier-Komponenten-Modell des sexuellen Erlebens von Redouté und Stoléru
- Pfadmodell von Ward und Siegert (2002)
- Biopsychosoziales Modell menschlicher Geschlechtlichkeit
- Zusammenfassung zum multifaktoriellen Erklärungsansatz
- Ein multifaktorieller Behandlungsansatz
- Psychoanalytische und psychodynamische Therapie
- Somatische Therapie
- Kognitiv-behaviorale Therapie
- Effektivität der Therapieverfahren
- Zusammenfassung zum multifaktoriellen Behandlungsansatz
- Diskussion und Ausblick
- Zusammenfassung
- Abstract
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Master-Thesis untersucht Pädophilie mit dem Ziel, einen multifaktoriellen Erklärungs- und Behandlungsansatz zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet die Komplexität des Krankheitsbildes und hinterfragt die gesellschaftliche Stigmatisierung. Sie geht über die reine Beschreibung des abweichenden Verhaltens hinaus und sucht nach den Ursachen und Möglichkeiten der Therapie.
- Das Krankheitsbild der Pädophilie und dessen Abgrenzung zum sexuellen Missbrauch
- Multifaktorielle Erklärungsansätze für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Pädophilie
- Bewertung verschiedener Therapieansätze
- Diskussion der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Stigmatisierung
- Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pädophilie ein, beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung von anderen sexuellen Abweichungen und beschreibt den gesellschaftlichen Wandel in der Wahrnehmung dieser Störung. Sie betont die Notwendigkeit, über das abweichende Verhalten hinaus die Ursachen und Entstehungsfaktoren zu verstehen.
Das Krankheitsbild der Pädophilie: Dieses Kapitel beschreibt das klinische Erscheinungsbild der Pädophilie, ihre Epidemiologie, den Verlauf und die Prognose sowie die verschiedenen Klassifikationen. Es betont die Schwierigkeit, Pädophilie eindeutig vom sexuellen Missbrauch an Kindern abzugrenzen, und skizziert die gesellschaftliche Stigmatisierung, die mit dieser Störung einhergeht. Die Zusammenfassung des Kapitels bietet einen fundierten Überblick über die wesentlichen Merkmale und den aktuellen Forschungsstand zum Krankheitsbild.
Ein multifaktorieller Erklärungsansatz: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für Pädophilie, angefangen von psychoanalytischen und psychodynamischen Perspektiven über lerntheoretische und neurologische Ansätze bis hin zu integrativen Modellen wie der Prädispositionstheorie von Finkelhor und dem Vier-Komponenten-Modell von Redouté und Stoléru. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt und kritisch beleuchtet, um die multifaktorielle Natur der Störung zu verdeutlichen. Die Zusammenfassung stellt die wesentlichen Erklärungsansätze dar und hebt die Bedeutung der Interaktion verschiedener Faktoren hervor.
Ein multifaktorieller Behandlungsansatz: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Therapieansätzen für Pädophilie, einschließlich psychoanalytischer, somatischer und kognitiv-behavioraler Therapien. Es analysiert die Effektivität der einzelnen Verfahren und bewertet ihren Stellenwert in einem umfassenden Behandlungskonzept. Die Zusammenfassung fasst die vorgestellten Therapiemethoden zusammen und diskutiert deren jeweiligen Stärken und Schwächen, wobei der Fokus auf einem ganzheitlichen Behandlungsansatz liegt.
Diskussion und Ausblick: Dieses Kapitel enthält eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse und ihrer Bedeutung im Kontext des Gesamtverständnisses von Pädophilie. Es wird ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen gegeben, die zur Verbesserung des Verständnisses und der Behandlung dieser Störung beitragen könnten.
Schlüsselwörter
Pädophilie, sexueller Missbrauch, Paraphilie, multifaktorieller Erklärungsansatz, Behandlungsansatz, Psychoanalyse, Lerntheorie, Neurologie, kognitive Verhaltenstherapie, gesellschaftliche Stigmatisierung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Multifaktorieller Erklärungs- und Behandlungsansatz von Pädophilie
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht Pädophilie mit dem Ziel, einen multifaktoriellen Erklärungs- und Behandlungsansatz zu entwickeln. Sie beleuchtet die Komplexität des Krankheitsbildes, hinterfragt die gesellschaftliche Stigmatisierung und sucht nach Ursachen und Therapieansätzen, die über die reine Beschreibung des abweichenden Verhaltens hinausgehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Krankheitsbild der Pädophilie, inklusive klinischem Erscheinungsbild, Epidemiologie, Verlauf, Prognose und Klassifikation. Sie untersucht multifaktorielle Erklärungsansätze (psychoanalytisch, psychodynamisch, lerntheoretisch, neurologisch, kognitiv-behavioral und integrative Modelle wie Finkelhor, Money, Redouté & Stoléru, Ward & Siegert), bewertet verschiedene Therapieansätze (psychoanalytisch, somatisch, kognitiv-behavioral) und diskutiert die gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung. Schließlich gibt sie einen Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.
Welche Erklärungsansätze für Pädophilie werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet psychoanalytische und psychodynamische Ansätze, lerntheoretische Ansätze, neurologische Ansätze und kognitiv-behaviorale Ansätze. Darüber hinaus werden integrative Modelle wie die Prädispositionstheorie von Finkelhor (1984), die integrierende Theorie von Money (1986), das Vier-Komponenten-Modell des sexuellen Erlebens von Redouté und Stoléru und das Pfadmodell von Ward und Siegert (2002) sowie ein biopsychosoziales Modell menschlicher Geschlechtlichkeit ausführlich untersucht.
Welche Therapieansätze werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert psychoanalytische und psychodynamische Therapien, somatische Therapien und kognitiv-behaviorale Therapien. Die Effektivität der verschiedenen Verfahren und ihr Stellenwert in einem umfassenden Behandlungskonzept werden analysiert und bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Krankheitsbild der Pädophilie, einem multifaktoriellen Erklärungsansatz, einem multifaktoriellen Behandlungsansatz, einer Diskussion und einem Ausblick. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung, ein Abstract, ein Literaturverzeichnis und einen Anhang.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Pädophilie, sexueller Missbrauch, Paraphilie, multifaktorieller Erklärungsansatz, Behandlungsansatz, Psychoanalyse, Lerntheorie, Neurologie, kognitive Verhaltenstherapie, gesellschaftliche Stigmatisierung, Prävention.
Wie ist die Abgrenzung von Pädophilie und sexuellem Missbrauch in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit betont die Schwierigkeit, Pädophilie eindeutig vom sexuellen Missbrauch an Kindern abzugrenzen, und thematisiert die gesellschaftliche Stigmatisierung, die mit dieser Störung einhergeht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Entwicklung eines multifaktoriellen Erklärungs- und Behandlungsansatzes für Pädophilie. Sie will die Komplexität des Krankheitsbildes aufzeigen und die gesellschaftliche Stigmatisierung hinterfragen.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse jedes Kapitels zusammenfassen.
- Citation du texte
- Janine Jänisch (Auteur), 2010, Pädophilie. Ein multifaktorieller Erklärungs- und Behandlungsansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284273