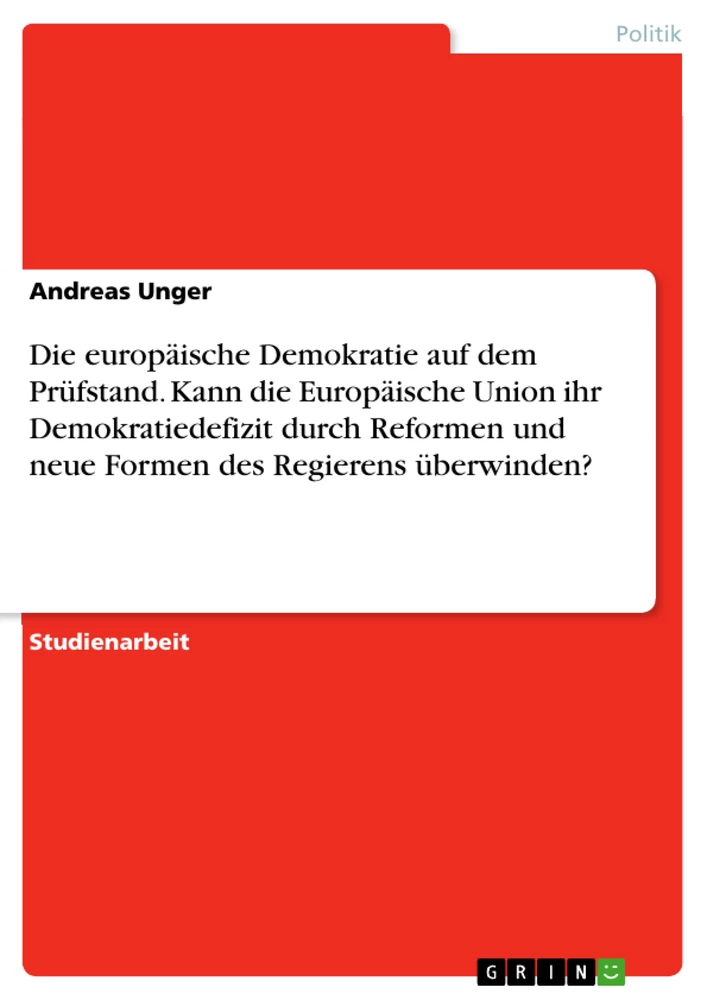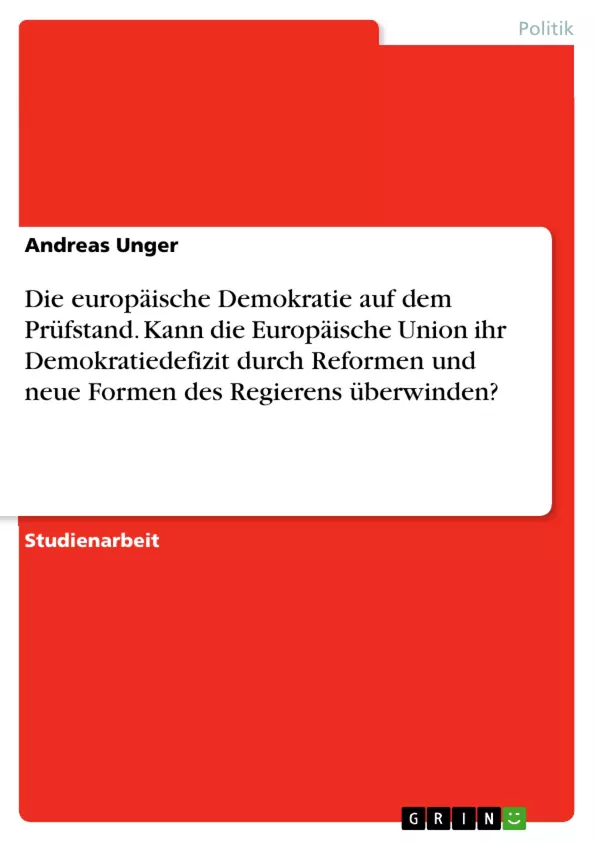Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat angefangen, sich von Europa zu distanzieren. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Oftmals wird in den einzelnen europäischen Nationalstaaten, nicht zuletzt aus wahltaktischen Gründen, eine zum Teil populistisch-kritische Debatte über die EU geführt. Wir geben mittlerweile ungebremst Milliarden für Rettungsprogramme aus, ohne dass diese parlamentarisch ausreichend kontrolliert werden. Die finanziellen Risiken der EU-Politik nähern sich allmählich der Billionengrenze. Hinzu kommt, dass die Bürgerinnen und Bürger aufgrund der oftmals undurchsichtigen Entscheidungsprozesse im fernen Brüssel das Vertrauen in die EU verlieren. Sie fühlen sich nicht nur schlecht informiert, sondern oftmals auch durch Entscheidungen in Brüssel benachteiligt. Ihrem Verständnis nach handeln die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat auf informelle Art und Weise Beschlüsse aus. ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratische Legitimation politischer Herrschaft
- Ideengeschichtliche Zugänge zu demokratischer Herrschaft
- Die Demokratie der Europäischen Union und die Debatte um ihr Demokratiedefizit
- Das politische System der Europäischen Union
- Demokratische Legitimation der Europäischen Union
- Die Debatte über das Vorhandensein/Nichtvorhandensein eines europäischen Demokratiedefizits
- Institutionelle Aspekte des europäischen Demokratiedefizits
- Strukturelle Aspekte des europäischen Demokratiedefizits
- Lösungswege und Lösungsprobleme
- Reformvorschläge
- Bessere Einbindung der nationalen Parlamente
- Stärkung des Europäischen Parlaments
- Ausweitung partizipativer Elemente
- Multilevel Governance als Form eines demokratischeren europäischen Regierens
- Zusammenfassung der Ergebnisse / Fazit
- Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Demokratiedefizit der Europäischen Union und untersucht das Potenzial institutioneller Reformen und neuer Formen des kooperativen Regierens zur Überwindung dieses Defizits. Die Arbeit analysiert die ideengeschichtlichen Zugänge zu demokratischer Herrschaft, um einen theoretischen Rahmen für die Untersuchung des politischen Systems der EU und ihrer demokratischen Legitimation zu schaffen. Anschließend wird die Debatte über das europäische Demokratiedefizit beleuchtet, wobei sowohl institutionelle als auch strukturelle Aspekte betrachtet werden. Schließlich werden verschiedene Lösungsvorschläge zur Überwindung des Demokratiedefizits vorgestellt und diskutiert.
- Demokratische Legitimation der Europäischen Union
- Das europäische Demokratiedefizit
- Institutionelle Reformen
- Kooperatives Regieren
- Multilevel Governance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem des europäischen Demokratiedefizits dar und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit ideengeschichtlichen Zugängen zu demokratischer Herrschaft, um den theoretischen Rahmen für die weitere Analyse zu legen. Kapitel 3.1 und 3.2 beschreiben das politische System der EU und ihre demokratische Legitimation. Kapitel 3.3 beleuchtet die Debatte über das europäische Demokratiedefizit, während Kapitel 3.4 und 3.5 institutionelle und strukturelle Aspekte des Defizits untersuchen. Kapitel 4 stellt verschiedene Lösungsvorschläge zur Überwindung des Demokratiedefizits vor und diskutiert deren Potenzial und Herausforderungen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und ein abschließendes Fazit runden die Arbeit in Kapitel 5 ab.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Europäische Union, Demokratiedefizit, institutionelle Reformen, kooperatives Regieren, Multilevel Governance, demokratische Legitimation, politische Herrschaft, ideengeschichtliche Zugänge, politische Systeme, nationale Parlamente, Europäisches Parlament, partizipative Elemente, Vertrauensverlust, Distanzierung der Bürger, Akzeptanzprobleme, Integrationsprozess, souveräne demokratische Staaten, gemeinsame politische Kompetenzen, Krisenreaktionsmechanismus, EU-Bürokratie, Brüsseler Krisengipfel, Rettungsprogramme, parlamentarische Kontrolle, finanzielle Risiken, undurchsichtige Entscheidungsprozesse, informelle Beschlüsse, nationale Herrschaftsbefugnisse, europäische Rechtsetzung, effektive Entscheidungen, outputzentriertes Demokratieverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Demokratiedefizit der EU?
Es beschreibt die Problematik, dass Entscheidungsprozesse in Brüssel oft undurchsichtig sind und die parlamentarische Kontrolle durch Bürger nicht im selben Maße wie auf nationaler Ebene gegeben ist.
Was ist Multilevel Governance?
Ein Regierungssystem auf mehreren Ebenen (lokal, national, europäisch), bei dem Akteure kooperativ zusammenarbeiten, um politische Probleme zu lösen.
Wie können nationale Parlamente die EU-Demokratie stärken?
Durch eine bessere Einbindung und Kontrollrechte können sie die demokratische Legitimation europäischer Entscheidungen auf nationaler Ebene erhöhen.
Warum verlieren Bürger das Vertrauen in die EU?
Gründe sind mangelnde Information, undurchsichtige Beschlüsse im Europäischen Rat und das Gefühl, durch bürokratische Entscheidungen benachteiligt zu werden.
Was ist ein outputzentriertes Demokratieverständnis?
Hierbei wird die Legitimität eines Systems nicht primär durch die Mitbestimmung (Input), sondern durch die Effektivität und Qualität der Ergebnisse (Output) definiert.
- Citation du texte
- Andreas Unger (Auteur), 2012, Die europäische Demokratie auf dem Prüfstand. Kann die Europäische Union ihr Demokratiedefizit durch Reformen und neue Formen des Regierens überwinden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284298