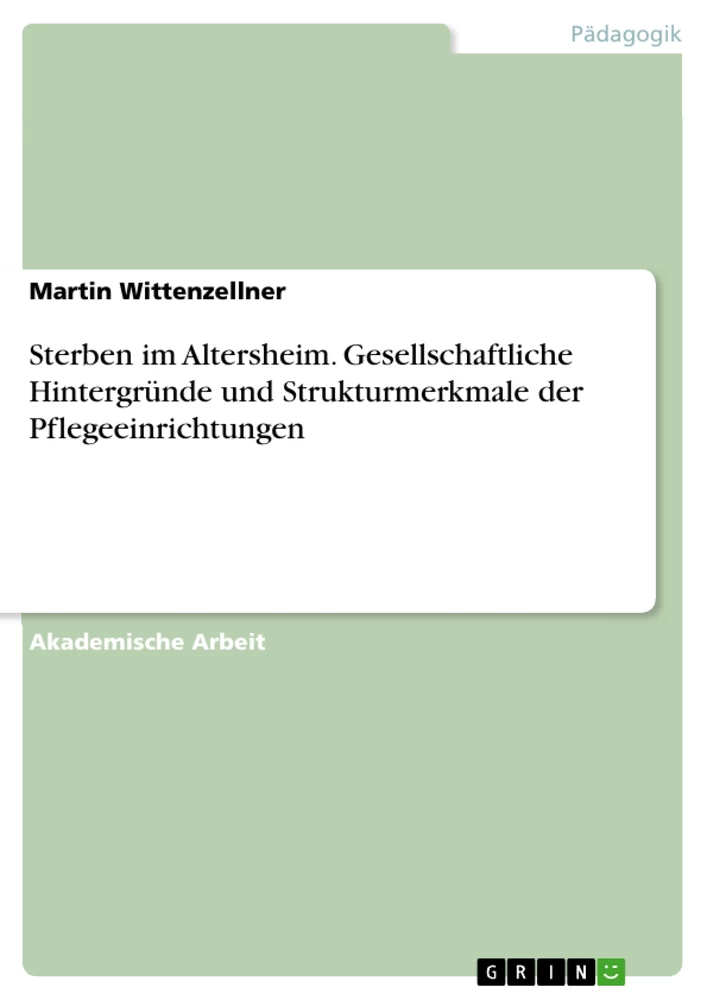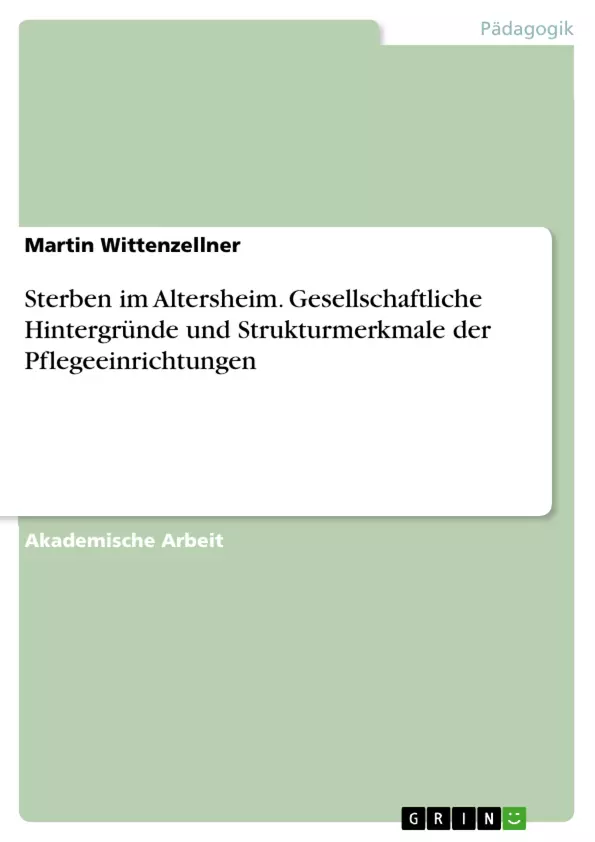Der gesellschaftliche Umgang mit Sterben und Tod hat sich seit dem Mittelalter stark verändert. So war das Sterben früher für alle Altersgruppen sichtbar, allgegenwärtig und gleichzeitig artikulierbar. Wohl auch aus Gründen mangelnder Intimsphäre in Lebensgemeinschaften war der Tod ein Teil des Alltags. Er war auch emotional leichter in den Alltag zu integrieren, handelte es sich doch bei dem Tod nicht um das absolute Ende. Der Tod, so glaubte man, war der Übergang in ein neues Leben. Diese Überzeugung scheint heute verschwunden zu sein. Stattdessen findet sich der Mensch in der Moderne, mit ihren Errungenschaften wie Pluralität, Freizügigkeit und Wohlstand abgekoppelt von den gesamtgesellschaftlichen Prozessen. Den damit verbundenen Orientierungsverlust benennt Peter L. Berger treffend mit „metaphysischem Heimatverlust“ (NASSEHI 1992, S. 17). Fern von einer Überzeugung von einem Leben nach dem Tod „passiert“ das Sterben in dafür ausgelegten Institutionen, den Alten- und Pflegeheimen, den Krankenhäusern und bisweilen in den noch sehr spärlich verbreiteten Hospizen.
Die folgende Arbeit will zum einen verdeutlichen, warum sich der Sterbeort in den Altenhilfebereich verlagert hat und zum anderen die für die Sterbebetreuung relevanten Merkmale beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Gründe für die Ausgliederung des Sterbens aus dem familiären Bereich in den Altenhilfebereich
- 1.1 Das Pflegeheim als Abschiebeort
- 1.2 Gesellschaftsstrukturelle Gründe
- 1.3 Medizinisch-technische Gründe
- 2 Die Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland
- 2.1 Strukturmerkmale der stationären Einrichtungen der Altenhilfe
- 2.2 Bewohnerstruktur
- 2.3 Personalstruktur
- 2.4 Pflegequalität und Pflegestandards
- 3 Die Institutionalisierung alter Menschen in Heimen
- 3.1 Die totale Institution nach Goffman
- 3.2 Das Altenheim als totale Institution
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verlagerung des Sterbeortes vom familiären Bereich in den Altenhilfebereich. Sie beleuchtet die Gründe für diese Entwicklung und analysiert relevante Merkmale der Sterbebetreuung in Altenpflegeeinrichtungen.
- Veränderung des gesellschaftlichen Umgangs mit Sterben und Tod
- Sozioökonomische und strukturelle Veränderungen im familiären Kontext
- Einfluss medizinisch-technischen Fortschritts auf die Sterbeorte
- Struktur und Merkmale von Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland
- Institutionalisierung des Alterns und ihre Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Gründe für die Ausgliederung des Sterbens aus dem familiären Bereich in den Altenhilfebereich: Der Text widerlegt zunächst die These, dass alte Menschen leichtfertig in Pflegeheime abgeschoben werden. Stattdessen werden vielschichtige Gründe für die zunehmende Institutionalisierung des Sterbens genannt. Erstens, der zunehmende Wohlstand und verbesserte soziale Sicherungssysteme haben die materielle Abhängigkeit innerhalb von Familien reduziert, was zu emotional intensiveren, aber auch kleineren Familienstrukturen geführt hat. Zweitens, sozioökonomische Veränderungen haben zur Individualisierung geführt, wodurch die Kinder der älteren Generation oft nicht mehr in der Lage sind, die Pflege zu übernehmen. Drittens, der medizinisch-technische Fortschritt hat zu einer Verlängerung der Lebens- und Sterbedauer geführt, was eine umfassendere und oft professionelle Pflege erfordert.
2 Die Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Strukturmerkmale, die Bewohnerstruktur, die Personalstruktur und die Pflegequalität und -standards in deutschen Altenhilfeeinrichtungen. Es liefert einen Überblick über die institutionellen Rahmenbedingungen der Sterbebegleitung und bietet Einblicke in die demografischen und personellen Gegebenheiten in diesen Einrichtungen. Der Fokus liegt auf den organisatorischen und personellen Ressourcen, die die Qualität der Pflege und Sterbebegleitung beeinflussen. Die Kapitel unterstreichen die Komplexität der Situation für die Bewohner und Mitarbeiter.
3 Die Institutionalisierung alter Menschen in Heimen: Dieses Kapitel analysiert die Institutionalisierung alter Menschen im Kontext der "totalen Institution" nach Goffman. Es untersucht, inwiefern das Altenheim als eine solche Institution verstanden werden kann, welche Auswirkungen dies auf die Bewohner hat und wie sich die spezifischen Gegebenheiten eines Altenheims von anderen "totalen Institutionen" unterscheiden. Der Fokus liegt auf der Analyse der sozialen und psychischen Auswirkungen der Institutionalisierung auf die alten Menschen und ihrer Bedeutung für den Umgang mit dem Sterben in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Sterben, Tod, Altenpflegeheim, Altenhilfe, Institutionalisierung, Familie, Gesellschaft, Medizin, Sozioökonomie, Individualisierung, Pflegequalität, totale Institution.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ausgliederung des Sterbens aus dem familiären Bereich in den Altenhilfebereich
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verlagerung des Sterbeortes vom familiären Bereich in den Altenhilfebereich. Sie beleuchtet die Gründe für diese Entwicklung und analysiert die Sterbebetreuung in Altenpflegeeinrichtungen.
Welche Gründe werden für die Ausgliederung des Sterbens aus dem familiären Bereich genannt?
Die Arbeit widerlegt die These eines leichtfertigen Abschobens. Vielmehr werden vielschichtige Gründe genannt: zunehmende materielle Unabhängigkeit innerhalb der Familien, sozioökonomische Veränderungen mit Individualisierung und reduzierter familiärer Pflegekapazität, sowie medizinisch-technischer Fortschritt mit Verlängerung der Lebens- und Sterbedauer und erhöhtem Bedarf an professioneller Pflege.
Wie beschreibt die Arbeit die Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland?
Das Kapitel beschreibt die Strukturmerkmale (stationäre Einrichtungen), die Bewohner- und Personalstruktur sowie die Pflegequalität und -standards in deutschen Altenhilfeeinrichtungen. Es bietet einen Überblick über die institutionellen Rahmenbedingungen der Sterbebegleitung und die demografischen und personellen Gegebenheiten.
Wie wird die Institutionalisierung alter Menschen im Kontext von Altenheimen analysiert?
Die Arbeit analysiert die Institutionalisierung anhand des Konzepts der "totalen Institution" nach Goffman. Sie untersucht das Altenheim als solche Institution, seine Auswirkungen auf die Bewohner und die Unterschiede zu anderen "totalen Institutionen". Der Fokus liegt auf den sozialen und psychischen Auswirkungen der Institutionalisierung und deren Bedeutung für den Umgang mit dem Sterben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: 1. Gründe für die Ausgliederung des Sterbens, 2. Die Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland, 3. Die Institutionalisierung alter Menschen in Heimen. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Sterben, Tod, Altenpflegeheim, Altenhilfe, Institutionalisierung, Familie, Gesellschaft, Medizin, Sozioökonomie, Individualisierung, Pflegequalität, totale Institution.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Veränderung des Sterbeortes und analysiert die relevanten Merkmale der Sterbebetreuung in Altenpflegeeinrichtungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, sozioökonomischer und medizinisch-technischer Faktoren.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel. Für detaillierte Informationen ist die vollständige Arbeit zu konsultieren.
- Citation du texte
- Martin Wittenzellner (Auteur), 2003, Sterben im Altersheim. Gesellschaftliche Hintergründe und Strukturmerkmale der Pflegeeinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284310