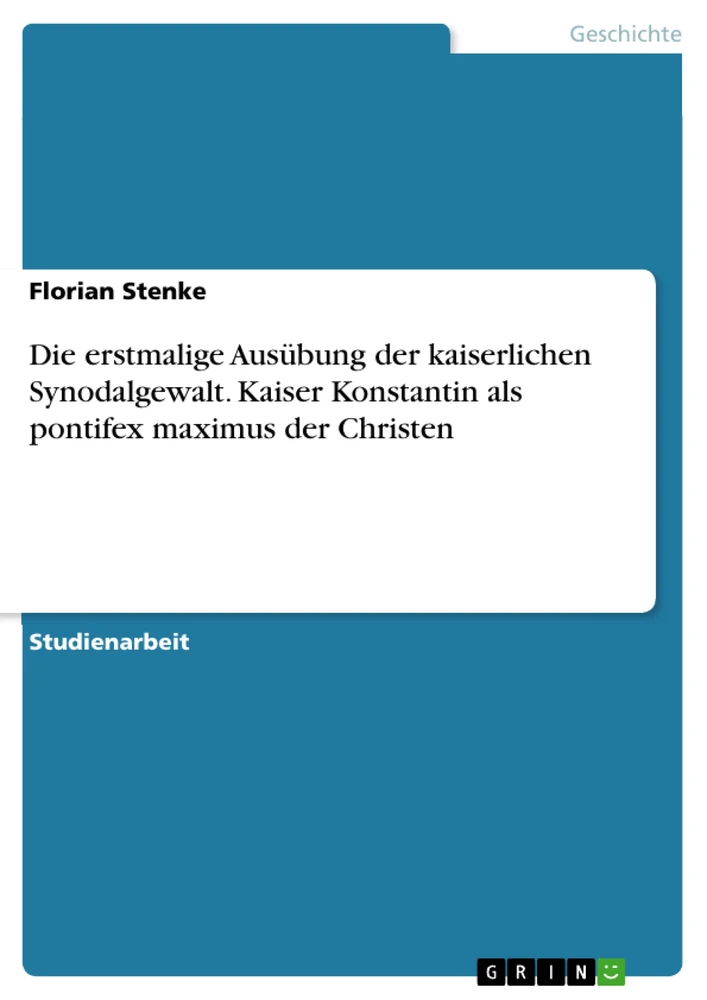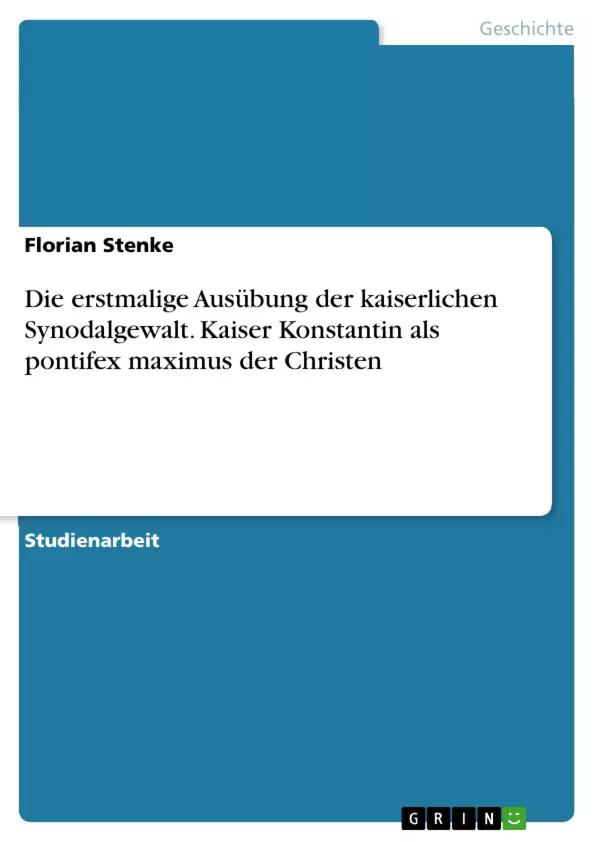„Mit Blick auf das […] Phänomen von kaiserlicher Synodalgewalt und Reichs- oder Kaiserkonzil in konstantinischer Zeit darf man politisch-historisch bewertend sagen, daß die Christenheit der antiken Welt in der Gestalt Konstantins auf der Basis der traditionellen römischen ius publicum erstmals in ihrer Geschichte ein sichtbares Oberhaupt erhalten hatte, das als christlicher pontifex maximus nicht nur über die äußere Ordnung des Kultus und die Disziplin des Klerus, sondern auch über den rechten Glauben wachte und nötigenfalls persönlich eingriff und Entscheidungen traf.“
So beschreibt Klaus Martin Girardet die Rolle Konstantins innerhalb der christlichen Kirche beim von ihm einberufenen Kaiserkonzil in Nicaea im Mai 325 n.
Chr. Die Praxis kaiserlicher Synodalgewalt hatte sich in dieser Zeit schon voll etabliert. Die erste vom Kaiser einberufene bischöfliche Synode fand bereits 313 in Rom statt, als auf Anweisung Konstantins über die Klagen der pars donati gegen den karthagischen Bischof Caecilianus verhandelt wurde, was zu diesem Zeitpunkt einen einmaligen Vorgang in der Geschichte der christlichen Kirche darstellte. Die Kaisersynode von Rom legte den Grundstein für die spätere Stellung des römischen Kaisers in der christlich-katholischen Kirche.
Der Vorgang aber, welcher zur erstmaligen Ausübung der kaiserlichen Synodalgewalt durch Kaiser Konstantin geführt hat, war und ist immer wieder Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Kontroversen, nicht zuletzt aufgrund der ungenügenden Quellenlage. Die Literatur stellt die Entstehung der kaiserlichen Synodalgewalt meist als eine, schon zu Beginn vom Kaiser aktiv ausgehende, Ausweitung der Kompetenzen als pontifex maximus dar, leitet diese These jedoch zumindest für das so bedeutende Konzil von Rom 313 kaum direkt von den Quellen ab.
Deshalb möchte die vorliegende Arbeit einen Versuch darstellen, anhand der existierenden Quellen zu klären, wie es zu diesem völlig neuen Verfahren bei innerkirchlichen Streitigkeiten kam. Beim Beschreiben des ersten Schrittes zur kaiserlichen Synodalgewalt wird vor allem auch zu klären sein, inwiefern sich Konstantin in seiner Position als römischer pontifex maximus auch zum Führer der Christenheit in Glaubensfragen berufen sah oder welche Beweggründe ihn stattdessen
zur Einberufung der Reichssynode von 313 veranlasst haben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung...
- II. Hauptteil...
- II.1. Benutzte Quellen zur Reichssynode von Rom 313...
- II.2. Konstantin an Caecilianus, Eus. HE X,6,1-5......
- II.3. Konstantin an Miltiades und Markus, Eus. HE X,5,18-20....
- II.4. Konstantin an Chrestus, Eus HE X,5,21-24....
- III. Schluss...
- IV. Quellen- und Literaturverzeichnis....
- IV.1. Quellenverzeichnis…
- IV.2. Literaturverzeichnis...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der ersten Ausübung kaiserlicher Synodalgewalt durch Kaiser Konstantin im Jahr 313 in Rom. Sie analysiert, wie es zu diesem neuen Verfahren bei innerkirchlichen Streitigkeiten kam und welche Rolle Konstantin als "pontifex maximus" in diesem Prozess spielte. Insbesondere wird untersucht, ob er sich aktiv um die Ausweitung seiner Kompetenzen als oberster Bischof bemühte oder ob andere Beweggründe ihn zur Einberufung der Reichssynode veranlassten.
- Die Rolle Konstantins als "pontifex maximus" in der römischen Reichssynode von 313
- Die Entstehung und Entwicklung der kaiserlichen Synodalgewalt
- Die Quellenlage zur römischen Reichssynode von 313
- Die Bedeutung der Briefkorrespondenz Konstantins für die Analyse seiner Rolle
- Die politischen und religiösen Beweggründe für Konstantins Eingreifen in innerkirchliche Angelegenheiten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Rolle Konstantins als "pontifex maximus" in der Geschichte der christlichen Kirche dar. Sie beleuchtet die Entwicklung der kaiserlichen Synodalgewalt und fokussiert auf die erste Synode in Rom im Jahr 313.
II. Hauptteil
II.1. Benutzte Quellen zur Reichssynode von Rom 313
Dieses Kapitel analysiert die Quellenlage zur römischen Reichssynode von 313, die sich als äußerst dürftig erweist. Es werden die wichtigsten Quellen wie Eusebius' Kirchengeschichte, die Schriften des Bischofs Optatus von Mileve und Augustinus sowie ihre jeweilige Relevanz und Kritikfähigkeit beleuchtet.
II.2. Konstantin an Caecilianus, Eus. HE X,6,1-5
Dieser Abschnitt befasst sich mit einem Brief Konstantins an den karthagischen Bischof Caecilianus, der vor der Synode von Rom verfasst wurde. Der Brief wird auf seinen Inhalt und seine Bedeutung für die Analyse von Konstantins Rolle im Donatistenstreit untersucht.
II.3. Konstantin an Miltiades und Markus, Eus. HE X,5,18-20
In diesem Kapitel wird ein weiterer Brief Konstantins analysiert, der Miltiades zum Vorsitzenden der Synode von Rom ernennt. Der Fokus liegt auf den Intentionen Konstantins und seiner Einflussnahme auf die Zusammensetzung und Leitung des Bischofgerichts.
II.4. Konstantin an Chrestus, Eus HE X,5,21-24
Dieser Abschnitt befasst sich mit einem Brief Konstantins an den Bischof Chrestus, der nach der Synode von Rom verfasst wurde. Der Brief wird auf seine Aussagen zur Rolle des Kaisers in innerkirchlichen Angelegenheiten und seine Sicht auf die Bedeutung der Synode untersucht.
Schlüsselwörter
Kaiser Konstantin, "pontifex maximus", kaiserliche Synodalgewalt, Reichssynode, Rom 313, Donatistenstreit, Quellenkritik, Eusebius, Optatus von Mileve, Augustinus, Briefkorrespondenz, innerkirchliche Streitigkeiten, christliche Kirche, Religionspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "kaiserliche Synodalgewalt"?
Es bezeichnet das Recht des römischen Kaisers, kirchliche Versammlungen (Synoden) einzuberufen und in Glaubens- oder Disziplinarfragen einzugreifen.
Wann fand die erste Kaisersynode statt?
Die erste vom Kaiser einberufene bischöfliche Synode fand im Jahr 313 in Rom statt.
Welche Rolle spielte Konstantin als "pontifex maximus"?
Konstantin nutzte seine traditionelle Rolle als Oberpriester, um nun auch über die Ordnung und den Glauben der christlichen Kirche zu wachen.
Was war der Anlass für die Synode von 313?
Anlass waren die Klagen der "pars donati" (Donatisten) gegen den karthagischen Bischof Caecilianus.
Welche Quellen werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden unter anderem Eusebius' Kirchengeschichte sowie Briefe Konstantins an Miltiades, Markus und Chrestus.
War Konstantin ein Führer in Glaubensfragen?
Die Arbeit untersucht, ob Konstantin sich selbst als religiöser Führer sah oder ob er primär aus politischen Beweggründen zur Wahrung der Reichseinheit handelte.
- Citation du texte
- Florian Stenke (Auteur), 2012, Die erstmalige Ausübung der kaiserlichen Synodalgewalt. Kaiser Konstantin als pontifex maximus der Christen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284341