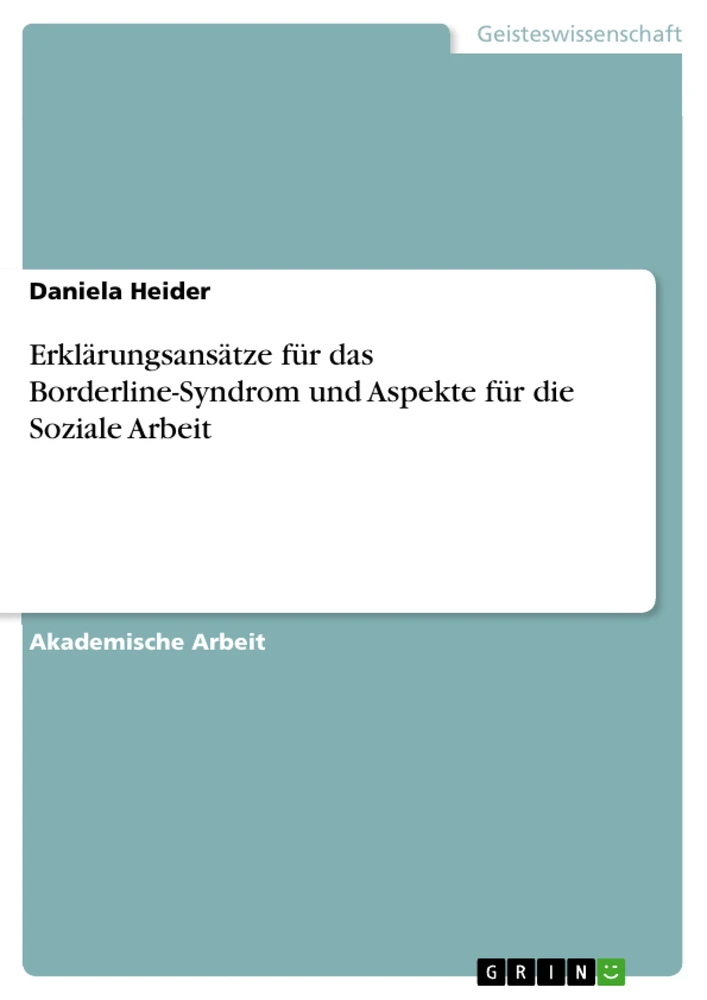Man geht heute davon aus, dass nicht die gesamte Borderline-Störung, sondern nur ihre zwei wesentlichen Faktoren vererbt werden: die impulsive Aggression und die affektive Instabilität. Eine besondere Verletzbarkeit ("Vulnerabilität") gegenüber der Entwicklung einer Borderline-Störung ergibt sich, wenn beide Faktoren einem Individuum gleichzeitig weitergegeben werden. Man spricht dann von einer genetisch bedingten Anfälligkeit für eine Störung in der Regulation von Impulsen und Emotionen, im Gegensatz zu der Anfälligkeit, die durch frühe Traumatisierungen entstehen kann.
Unter sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätzen verstehe ich jene, die strukturelle Gegebenheiten mit individuellen Entwicklungen in Einklang bringen und umfassend die Umstände innerhalb des nahen Umfelds berücksichtigen. Solche Umstände können traumatische Erfahrungen beinhalten.
Im Jahr 1951 erstellte Bowlby im Auftrag der World Health Organisation eine Monographie, wonach "eine längere Deprivation von mütterlicher Zuwendung in früher Kindheit ernste und weitreichende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung und damit für das ganze Leben eines Menschen haben kann." Dies war der Beginn einer umfassenden Erforschung der Auswirkungen von Kindheitserfahrungen auf die weitere Entwicklung der Persönlichkeit. Heute werden schwere und traumatische Erfahrungen, wie z.B. Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch, als Indikatoren für ein besonderes Risiko, an seelischen, körperlichen oder psychosomatischen Störungen zu erkranken, angesehen.
Der Zusammenhang zwischen dem Borderline- Syndrom und den Forschungsergebnissen besteht darin, dass bei überdurchschnittlich vielen Borderlinern solche traumatischen Kindheitserlebnisse festgestellt wurden. Die Traumaforschung stellt das bisherige Borderline- Konzept deshalb in Frage und vertritt den Ansatz, dass es sich beim Borderline- Syndrom um eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung handelt.
Kernberg hingegen legt seiner Theorie der Entstehung einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation die Freud'sche Libidotheorie zugrunde. Er geht davon aus, "..., dass eine übermäßige Ausprägung prägenitaler und vor allem oraler Aggression bei beiden Geschlechtern eine vorzeitige Entwicklung ödipaler Triebstrebungen auslösen kann, so dass eine pathologische Verschränkung prägenitaler und genitaler Triebziele unter dem dominierenden Einfluss aggressiver Bedürfnisse entsteht."
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema "Borderline und Soziale Arbeit"
- Erklärung der Begriffe
- Historischer Überblick
- Kontakt zu Borderlinern in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit
- Wichtige Erklärungsansätze und Modelle der Borderline-Störung
- Der Beitrag neurobiologischer Faktoren zur Entwicklung einer Borderline-Störung
- Impulsive Aggression und serotonerges System
- Affektive Instabilität und cholinerges System
- Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze
- Deprivation, Misshandlung und Missbrauch
- Die strukturelle Seite der traumatischen Gewalterfahrungen
- Die Familienorganisation
- Kernbergs psychoanalytisches Erklärungsmodell
- Libidotheorie und psychosexuelle Entwicklung
- Die Entstehung einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation
- Die Funktionen der typischen Borderline-Strukturen
- Systemische Theorien
- Erzeugung und Sinn der Symptome
- Die Borderline-Familienstrukturen und ihre Funktion
- Die biosoziale Theorie der dialektisch-behavioralen Therapie
- Emotionale Fehlregulation
- Invalidierende Umgebungen
- Die Wechselwirkungen
- Zusammenfassende Bewertung der verschiedenen Ansätze
- Vergleich und persönliche Einschätzung
- Interessante Aspekte für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Erklärungsansätze für das Borderline-Syndrom und beleuchtet deren Relevanz für die Soziale Arbeit. Es wird ein umfassender Überblick über neurobiologische, sozialwissenschaftliche und psychoanalytische Modelle gegeben. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Dynamiken der Borderline-Störung zu entwickeln und daraus praktische Implikationen für die Soziale Arbeit abzuleiten.
- Neurobiologische Faktoren und ihre Rolle bei der Entstehung der Borderline-Störung
- Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze, insbesondere Deprivation, Misshandlung und Missbrauch
- Psychoanalytische Modelle, insbesondere Kernbergs Konzept der Borderline-Persönlichkeitsorganisation
- Systemische Theorien und ihre Bedeutung für das Verständnis von Familienstrukturen und Symptomen
- Die biosoziale Theorie der dialektisch-behavioralen Therapie und ihre Kernelemente
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in das Thema "Borderline und Soziale Arbeit"
Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe und liefert einen historischen Überblick über die Entwicklung des Verständnisses von Borderline-Störungen. Darüber hinaus werden die verschiedenen Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit beleuchtet, in denen der Kontakt zu Menschen mit Borderline-Störungen relevant ist.
Wichtige Erklärungsansätze und Modelle der Borderline-Störung
Das zweite Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Erklärungsmodellen für das Borderline-Syndrom. Neurobiologische Faktoren, wie impulsive Aggression und affektive Instabilität, sowie sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze, die Deprivation, Misshandlung und Missbrauch in den Fokus stellen, werden beleuchtet. Kernbergs psychoanalytisches Modell, welches die Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsorganisation in den Mittelpunkt stellt, wird ebenso erläutert wie systemische Theorien und die biosoziale Theorie der dialektisch-behavioralen Therapie.
Zusammenfassende Bewertung der verschiedenen Ansätze
Dieses Kapitel bietet eine vergleichende Bewertung der verschiedenen Erklärungsansätze und hebt deren jeweilige Stärken und Schwächen hervor. Darüber hinaus werden die relevanten Implikationen für die Soziale Arbeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Borderline-Syndrom, dessen verschiedenen Erklärungsansätzen und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: neurobiologische Faktoren, sozialwissenschaftliche Ansätze, psychoanalytische Modelle, systemische Theorien, dialektisch-behaviorale Therapie, emotionale Fehlregulation, Deprivation, Misshandlung, Missbrauch, Borderline-Persönlichkeitsorganisation, Borderline-Störung, Borderliner, Borderline-Klient, Borderline-Patient.
Häufig gestellte Fragen
Sind Borderline-Störungen vererbt?
Man geht davon aus, dass nicht die Störung selbst, sondern zwei wesentliche Faktoren vererbt werden: impulsive Aggression und affektive Instabilität.
Welche Rolle spielen Kindheitstraumata beim Borderline-Syndrom?
Überdurchschnittlich viele Betroffene haben Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch erlebt. Die Traumaforschung betrachtet Borderline oft als komplexe posttraumatische Belastungsstörung.
Was ist Kernbergs Modell der Borderline-Persönlichkeitsorganisation?
Otto Kernberg stützt sich auf die Libidotheorie und sieht die Ursache in einer pathologischen Verschränkung prägenitaler und genitaler Triebziele unter dem Einfluss aggressiver Bedürfnisse.
Was ist die biosoziale Theorie der dialektisch-behavioralen Therapie (DBT)?
Diese Theorie von Marsha Linehan erklärt Borderline durch eine Wechselwirkung zwischen biologischer emotionaler Fehlregulation und einer invalidierenden (entwertenden) Umgebung in der Kindheit.
Warum ist das Thema für die Soziale Arbeit relevant?
Sozialarbeiter begegnen Borderline-Klienten in vielen Feldern. Ein Verständnis der Erklärungsansätze hilft, professionelle Strategien für den Umgang mit Impulsivität und Instabilität zu entwickeln.
- Citar trabajo
- Daniela Heider (Autor), 2003, Erklärungsansätze für das Borderline-Syndrom und Aspekte für die Soziale Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284353