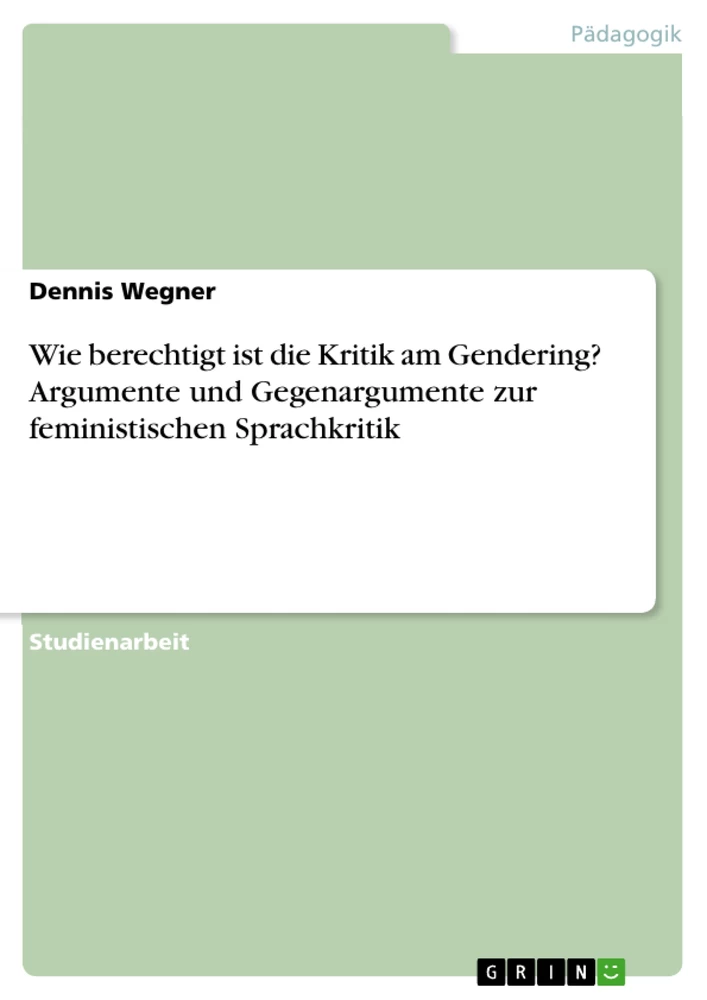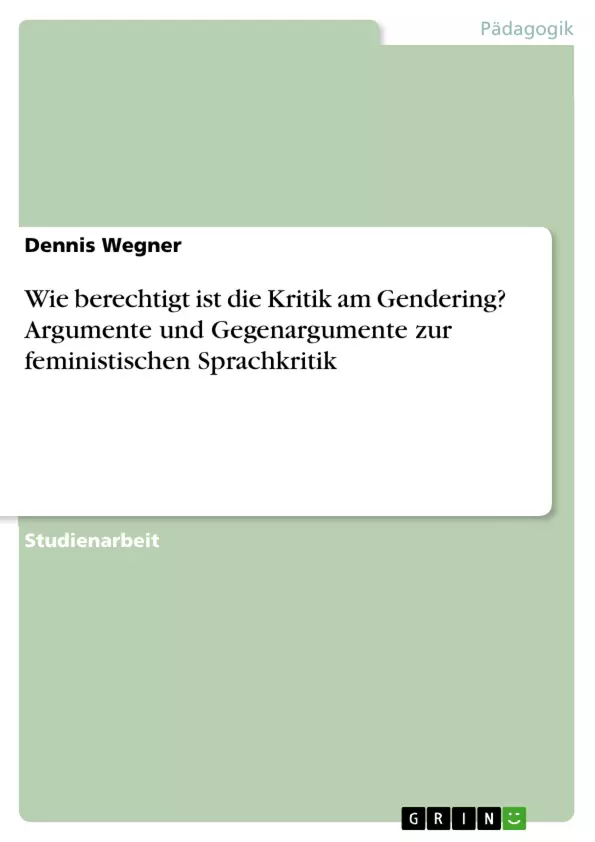“Frauen sind nicht der Rede wert“. Mit dieser und vielen weiteren provokativen Äußerungen eröffneten feministische Linguistinnen in den 1980er Jahren einen Diskurs, dem seitdem viel Aufmerksamkeit in der Sprachwissenschaft und in der Öffentlichkeit zuteilwurde. Es wird untersucht, ob und inwiefern Frauen in der Sprache benachteiligt werden. Die feministische Linguistik sieht einen Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und der Wahrnehmung von Gender. Dem gegenüber stehen kritische Stimmen, die an der Hypothese einer organisch gewachsenen Sprache und der Inkongruenz von Genus und Sexus festhalten.
In dieser Arbeit sollen deshalb die Argumente der feministischen Linguistik und Sprachkritik sowie die jeweiligen Gegenargumente genauer betrachtet werden. In einem ersten Schritt soll eine Basis geschaffen werden, indem die feministischen Disziplinen und die Standpunkte der Feminismuskritik erläutert werden. Auf dieser Grundlage soll die Diskussion um „geschlechtergerechte Sprache“ untersucht werden. Hierfür soll auf verschiedene Personenbezeichnungen eingegangen werden, die im Gendering eine Rolle spielen. Beginnend mit der herkömmlichen Form des generischen Maskulinums über Möglichkeiten der partiellen Feminisierung bis hin zum generischen Femininum sollen Methoden der geschlechtergerechten Sprache verschiedenen Ausmaßes einbezogen werden. Es soll abschließend beantwortend werden, ob Frauen durch den Sprachgebrauch tatsächlich benachteiligt werden und ob die Kritik am Gendering berechtigt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der feministischen Sprachkritik
- Feminismus und feministische Linguistik
- Feministische Sprachkritik
- Kritik an der feministischen Linguistik
- Geschlechtergerechte Sprache
- Generisches Maskulinum
- Partielle Feminisierung
- Generisches Femininum
- Schlussbemerkung
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die feministische Sprachkritik und ihre Argumente, die sich gegen die Benachteiligung von Frauen in der Sprache richten. Sie beleuchtet die Entwicklung der feministischen Linguistik und die Kritik an dieser Disziplin. Im Fokus steht die Diskussion um „geschlechtergerechte Sprache“ und die verschiedenen Ansätze zur Vermeidung des generischen Maskulinums. Die Arbeit analysiert die Argumente für und gegen das Gendering und versucht, die Frage zu beantworten, ob Frauen durch den Sprachgebrauch tatsächlich benachteiligt werden.
- Entwicklung der feministischen Sprachkritik
- Kritik an der feministischen Linguistik
- Geschlechtergerechte Sprache
- Generisches Maskulinum und alternative Formen
- Die Berechtigung der Kritik am Gendering
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die feministische Sprachkritik vor und erläutert die zentrale Frage, ob Frauen durch den Sprachgebrauch benachteiligt werden. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die Argumentationslinien der feministischen Linguistik und ihrer Kritiker.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung der feministischen Sprachkritik. Es wird ein Überblick über den Feminismus und die feministische Linguistik gegeben. Die feministische Sprachkritik wird als Reaktion auf die vermeintliche Benachteiligung von Frauen in der Sprache vorgestellt. Die Kritik an der feministischen Linguistik wird ebenfalls beleuchtet, wobei die Argumente der Gegner der feministischen Sprachkritik dargestellt werden.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Thema „geschlechtergerechte Sprache“. Es werden verschiedene Ansätze zur Vermeidung des generischen Maskulinums vorgestellt, darunter die partielle Feminisierung und das generische Femininum. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden werden diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptanliegen der feministischen Sprachkritik?
Sie untersucht, ob und wie Frauen durch den Sprachgebrauch benachteiligt werden, und fordert eine geschlechtergerechte Sprache, die Frauen sichtbar macht.
Was versteht man unter dem generischen Maskulinum?
Das generische Maskulinum ist die Verwendung männlicher Personenbezeichnungen für alle Geschlechter. Feministinnen kritisieren, dass Frauen dabei gedanklich oft nicht mit eingeschlossen werden.
Welche Alternativen zum Gendering werden diskutiert?
Zu den Alternativen zählen die partielle Feminisierung (Beidnennung), die Nutzung neutraler Begriffe oder in radikaleren Ansätzen das generische Femininum.
Welche Kritik gibt es am Gendering?
Kritiker argumentieren, dass Genus (grammatisches Geschlecht) und Sexus (biologisches Geschlecht) nicht identisch sind und dass eine organisch gewachsene Sprache nicht künstlich verändert werden sollte.
Besteht ein Zusammenhang zwischen Sprache und Wahrnehmung?
Die feministische Linguistik geht davon aus, dass der Sprachgebrauch die Wahrnehmung von Gender beeinflusst und somit gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegelt oder zementiert.
- Arbeit zitieren
- Dennis Wegner (Autor:in), 2014, Wie berechtigt ist die Kritik am Gendering? Argumente und Gegenargumente zur feministischen Sprachkritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284380