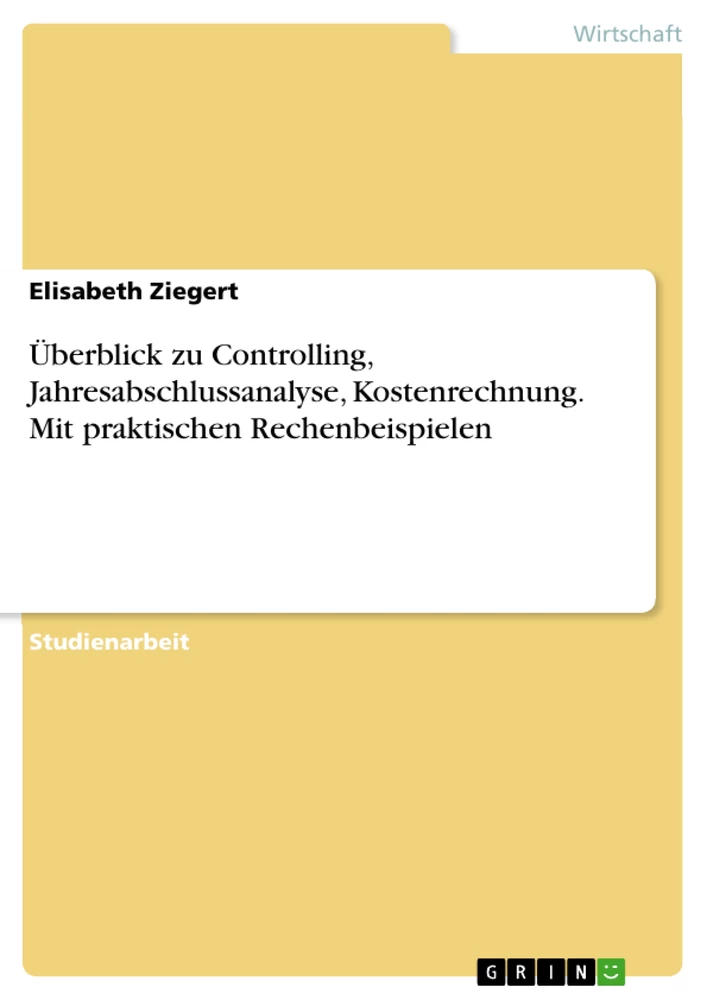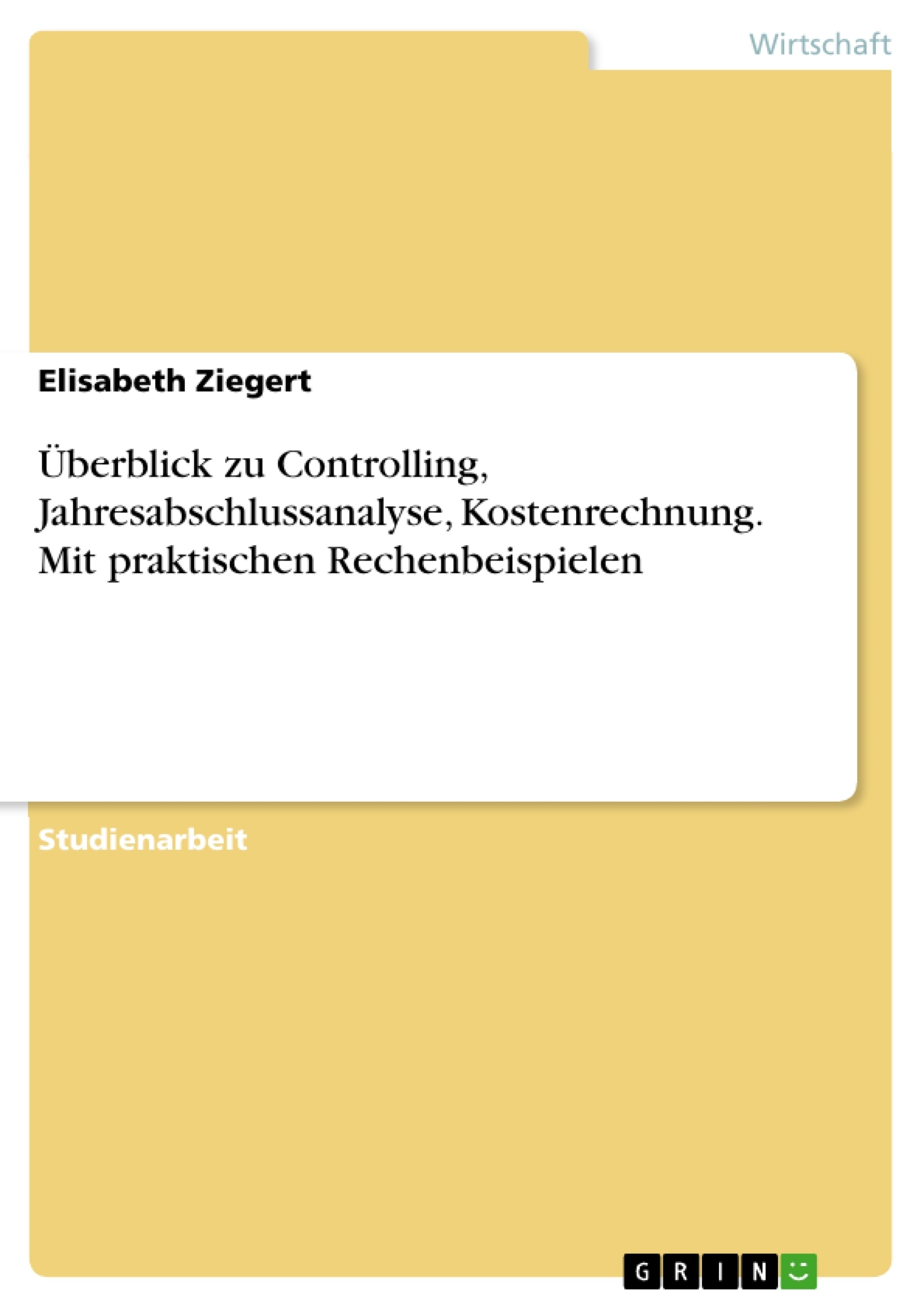Die Bezeichnung ‚Controlling‘ kommt aus dem Englischen ‚to control‘ und bedeutet steuern, regeln, oder lenken. Controlling ist somit „nicht der englische oder amerikanische Begriff für Kontrolle“. (SCHLAFFKE/PLÜNNECKE, 2014, S. 30)
Controlling stellt die Summe aller Maßnahmen dar, die dazu dienen die Führungsbereiche Planung, Kontrolle, Organisation, Personalführung und Information so zu koordinieren, dass die Unternehmensziele optimal erreicht werden können. Dabei soll das übergeordnete Ziel mit möglichst wenig Zahlen und Aufwand angesteuert werden.
Hierbei steht „zukunftsorientiert agieren“ (LEIDIG, 2003, S. 36) im Mittelpunkt während bei der Kontrolle „vorwiegend vergangenheitsorientiert reagieren“ (LEIDIG, 2003, S. 36) die Kernaussage bildet.
Controlling ist die betriebswirtschaftliche Steuerung eines Unternehmens zum Zweck der Zielerreichung. Maßnahmen werden festgelegt, Ressourcen geplant und Aufgaben durchgeführt. Kontrolle hingegen umfasst lediglich die Prüfung verschiedener Ergebnisse oder Abläufe. In der Kontrolle werden Abweichungen festgestellt während im Controlling zielorientierte Maßnahmen bei Abweichungen getroffen werden.
Controlling schließt somit viel mehr Prozesse ein als Kontrolle.
Die Mitgliederentwicklung zeichnet sich aus durch Neukunden, Kundenbindung und die Anzahl von Kündigungen. Alles zusammen ist abhängig von der Kundenzufriedenheit.
Fluktuation ist eine Kenngröße der Kundenzufriedenheit. Um die Fluktuationsquote zu ermitteln, wird die Kündigungsanzahl ins Verhältnis zum durchschnittlichen Mitgliederbestand gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- CONTROLLING
- Kerngedanken und Aufgaben
- Mitgliederentwicklung
- Kennzahlensystem
- Controllingsystem
- Erläuterung eines Controllingsystems
- Erläuterung einer Balanced Scorecard
- Balanced Scorecard Praxisbeispiel
- JAHRESABSCHLUSSANALYSE
- Bilanzkennzahlen
- Jahresüberschuss
- Eigenkapitalquote
- Eigenkapitalrentabilität
- Umsatzrentabilität
- Working Capital
- Wirtschaftliche Entwicklung
- KOSTENRECHNUNG
- Kostenrechnungsarten
- Zuschlagskalkulation
- Deckungsbeitragsrechnung
- Interpretation einer Deckungsbeitragssituation
- LITERATURVERZEICHNIS
- ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Einsendeaufgabe im Fachmodul Betriebswirtschaftslehre III im Studiengang Bachelor Fitnessökonomie befasst sich mit dem Thema Controlling im Kontext eines Fitnessunternehmens. Die Arbeit analysiert die Kerngedanken und Aufgaben des Controllings, untersucht die Mitgliederentwicklung und die Bedeutung von Kennzahlensystemen, erläutert verschiedene Controllingsysteme, darunter die Balanced Scorecard, und betrachtet die Anwendung von Jahresabschlussanalysen und Kostenrechnung im Fitnessbereich.
- Controlling als Instrument zur Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen
- Analyse der Mitgliederentwicklung und Kundenzufriedenheit
- Entwicklung und Anwendung von Kennzahlensystemen
- Erläuterung und Vergleich verschiedener Controllingsysteme
- Anwendung von Jahresabschlussanalysen und Kostenrechnung im Fitnessbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich dem Controlling. Es werden die Kerngedanken und Aufgaben des Controllings erläutert, wobei die Bedeutung von Planung, Kontrolle, Organisation, Personalführung und Information hervorgehoben wird. Die Mitgliederentwicklung als wichtiger Indikator für die Kundenzufriedenheit wird im zweiten Abschnitt des Kapitels behandelt. Hierbei wird die Fluktuationsquote als Kennzahl für die Kundenzufriedenheit vorgestellt und erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit Kennzahlensystemen und deren Bedeutung für die Steuerung und Kontrolle von Unternehmensprozessen. Es werden verschiedene Arten von Kennzahlensystemen, wie Rechen- und Ordnungssysteme, vorgestellt und anhand eines Praxisbeispiels erläutert. Das vierte Kapitel behandelt verschiedene Controllingsysteme, darunter die Balanced Scorecard. Es werden die Vorteile und die Funktionsweise der Balanced Scorecard im Vergleich zu klassischen Controllingsystemen dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Controlling, Mitgliederentwicklung, Kennzahlensystem, Controllingsystem, Balanced Scorecard, Jahresabschlussanalyse, Bilanzkennzahlen, Kostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung und Fitnessökonomie. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung dieser Konzepte im Kontext eines Fitnessunternehmens und zeigt, wie sie zur Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen eingesetzt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Controlling und Kontrolle?
Controlling ist eine zukunftsorientierte Steuerung zur Zielerreichung, während Kontrolle vergangenheitsorientiert Ergebnisse prüft und Abweichungen lediglich feststellt.
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC)?
Die BSC ist ein Controllingsystem, das neben Finanzkennzahlen auch Perspektiven wie Kunden, interne Prozesse und Lernen/Entwicklung berücksichtigt, um Strategien ganzheitlich umzusetzen.
Wie wird die Fluktuationsquote im Fitnessbereich berechnet?
Die Fluktuationsquote wird ermittelt, indem die Anzahl der Kündigungen ins Verhältnis zum durchschnittlichen Mitgliederbestand gesetzt wird. Sie ist eine wichtige Kennzahl für die Kundenzufriedenheit.
Welche Kennzahlen sind für eine Jahresabschlussanalyse wichtig?
Zentrale Bilanzkennzahlen sind der Jahresüberschuss, die Eigenkapitalquote, die Eigenkapitalrentabilität, die Umsatzrentabilität und das Working Capital.
Was ist das Ziel der Deckungsbeitragsrechnung?
Die Deckungsbeitragsrechnung dient der Ermittlung, wie viel ein Produkt oder eine Dienstleistung zur Deckung der Fixkosten und zum Gewinn des Unternehmens beiträgt.
Welche Aufgaben übernimmt das Controlling in einem Fitnessunternehmen?
Zu den Aufgaben gehören die Planung, Steuerung von Mitgliederentwicklungen, Koordination von Ressourcen und die Bereitstellung von Informationen für die Geschäftsführung.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Ziegert (Autor:in), 2014, Überblick zu Controlling, Jahresabschlussanalyse, Kostenrechnung. Mit praktischen Rechenbeispielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284494