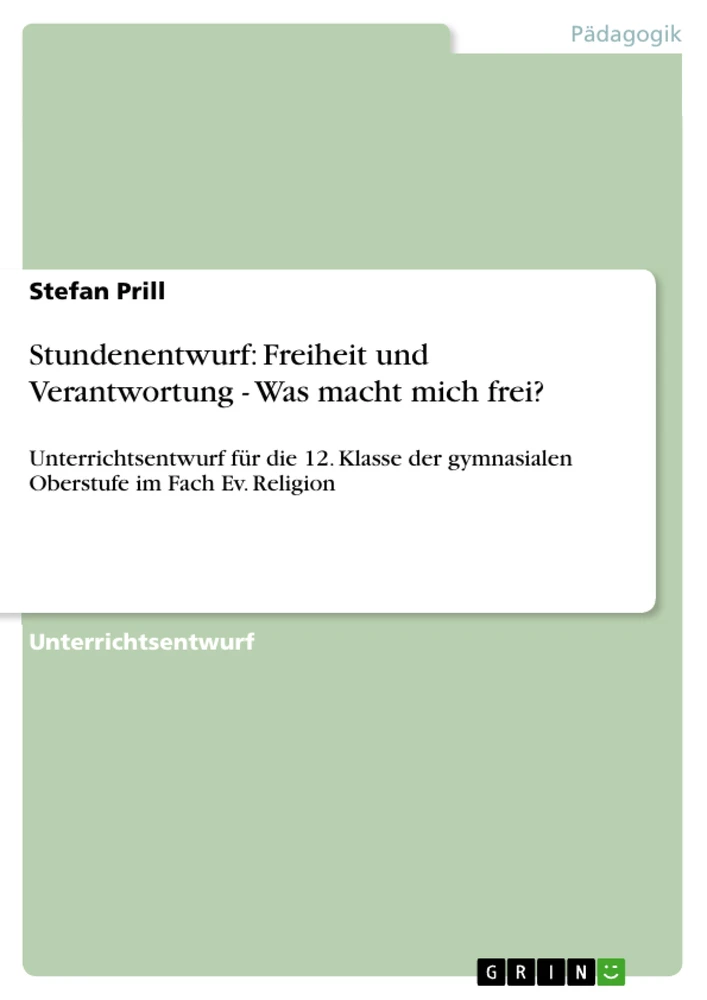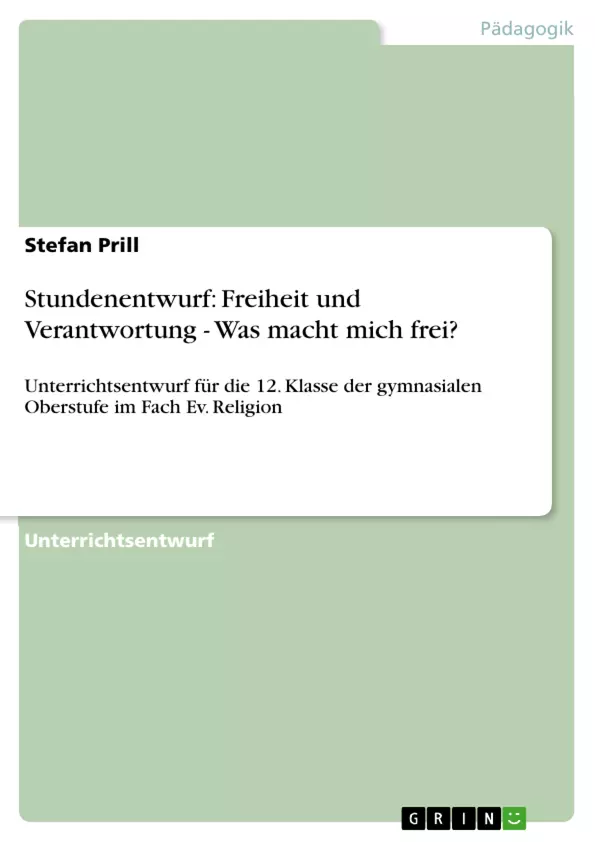„Bei der Freiheit handelt es sich […] um ein aktuelles und beziehungsreiches Thema. Die Verheißung der Freiheit zieht die Aufmerksamkeit auf sich; doch die Gefährdung der Freiheit steht genauso dringlich auf der Tagesordnung“, konstatiert Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD. Auch wenn Freiheit ein hohes Gut ist, ist sie keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Der Blick in Regionen der Erde, in denen die Freiheitsrechte der UN-Menschenrechtscharta nicht verwirklicht werden, macht dies deutlich. Doch auch wenn die Schüler meistens keine persönlichen Erfahrungen mit politischer Unfreiheit gemacht haben und das Gefühl der Freiheit eine wichtige und existentielle Erfahrung für sie darstellt, erleben besonders Jugendliche viele gesellschaftliche Zwänge als Bedrohung ihrer Freiheit. Oft sind diese Bedrohungen des eigenen Freiheitgefühls mit den Orten Schule und Elternhaus verknüpft, sodass viele Jugendliche eine Sehnsucht nach Freiheit als Unabhängigkeit entwickeln. Dieses Gefühl „Ich kann tun und lassen, was ich will“, manifestiert sich für sie oft in ihrer Freizeit, im Urlaub oder aber in dem Herbeiwünschen der Zeit nach dem Auszug aus dem Elternhaus bzw. nach dem Schulabschluss. Dass Freiheit jedoch weit mehr als Unabhängigkeit bedeutet, haben viele Schülerinnen und Schüler nicht im Blick. Durch die Beschäftigung mit der christlichen Freiheit, die in der Bibel sowohl im Alten, als auch im Neuen Testament beschrieben wird und die in der Reformation neu entdeckt wurde, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eine andere Konzeption von Freiheit kennenzulernen, das mehr bietet als äußere Freiheit und Unabhängigkeit. Im Alten Testament wird Freiheit als ein Geschenk beschrieben, welches Gott erst möglich macht. Im Neuen Testament liegt die christliche Freiheit im heilsgeschichtlichen Wirken Christi begründet.Für die Bibel ist die höchste Form des menschlichen Zusammenlebens die Nächstenliebe und so verwirklicht sich in der Nächstenliebe auch der richtige christliche Gebrauch der eigenen Freiheit. Die Schülerinnen und Schüler können für sich entscheiden, ob das christliche Freiheitsverständnis für sie etwas wäre, dass ihrem Leben Gewinn bringen könnte und dass sie selber erleben möchten, oder ob sie es begründet ablehnen wollen, aber zumindest erklären können, was Christen unter Freiheit und einem freiheitlichen Lebensstil, der in der Nächstenliebe gipfelt, verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Orientierung
- Was will ich, dass meine Schüler lernen?
- Bezug zum Bildungsplan
- Vorläufiger Stoffverteilungsplan
- Theologische Entfaltung
- Freiheit im Alten Testament
- Freiheit im Neuen Testament
- Didaktischer Übergang
- Worauf richtet sich mein Unterricht?
- Lernschritte und Kompetenzerwerb
- Stoffverteilungsplan
- Konzeption einer Stunde aus dem Gesamtzusammenhang
- Materialien, Medien, Texte
- Kurzfilm „Eine Minute Freiheit“
- Huber, W., Von der Freiheit, 98-105 (Auszüge)
- Fragen zu „Huber, W., Von der Freiheit, 98-105 (Auszüge)“
- Ernst Lange, Die zehn großen Freiheiten, 3-8
- Kurzfilm „Wacht auf!“
- Dietrich Bonhoeffer, Stationen der Freiheit
- Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen (Auszüge)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler das christliche Freiheitsverständnis kennenlernen, es in Beziehung zu ihren eigenen Vorstellungen von Freiheit setzen und Impulse für ihre eigene Lebens- und Handlungspraxis gewinnen. Im Fokus stehen biblische Texte aus dem Alten und Neuen Testament sowie theologische Texte aus der Zeit der Reformation und von heutigen Theologen.
- Die unterschiedlichen Konzeptionen von Freiheit im Alten und Neuen Testament.
- Die christliche Freiheit als ein Geschenk Gottes, das von der menschlichen Sünde befreit und auf die Liebe zum Nächsten ausgerichtet ist.
- Der Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung im christlichen Kontext.
- Die Verbindung von innerlicher Freiheit und äußerlicher Verantwortung, wie sie von Martin Luther in seiner Freiheitsschrift beschrieben wird.
- Die Relevanz biblischer Texte für die Lebenswelt heutiger Schülerinnen und Schüler.
Zusammenfassung der Kapitel
Orientierung
Dieser Abschnitt stellt das Thema „Freiheit und Verantwortung“ im Kontext des Religionsunterrichts vor und erläutert die didaktischen Ziele, die der Unterrichtsentwurf verfolgt. Der Bezug zum Bildungsplan wird hergestellt und ein vorläufiger Stoffverteilungsplan skizziert.
Theologische Entfaltung
Dieser Abschnitt bietet eine theologische Einordnung des Begriffs „Freiheit“ und untersucht dessen Bedeutung in den biblischen Schriften. Die Schöpfungserzählungen des Alten Testaments werden als Ausgangspunkt für die Betrachtung des Menschen als freiheitliches Geschöpf Gottes herangezogen. Der Exodus als existentielle Freiheitserfahrung für das Volk Israel wird als ein weiteres Beispiel für die Bedeutung von Freiheit im Alten Testament vorgestellt. Im Neuen Testament liegt der Fokus auf der inneren Freiheit des Menschen von Sünde, Gesetz und Tod, die in Christus verwirklicht wird. Die paulinische Rechtfertigungslehre und ihre Bedeutung für das christliche Verständnis von Freiheit werden erläutert.
Didaktischer Übergang
Dieser Abschnitt führt die didaktischen Ansätze des Unterrichtsentwurfes näher aus und beschreibt die einzelnen Lernschritte und Kompetenzerwerbsziele, die in den vier Doppelstunden der Unterrichtseinheit angestrebt werden. Es werden konkrete Beispiele für Unterrichtsphasen und Methoden beschrieben, die eingesetzt werden können, um die Lernziele zu erreichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Unterrichtseinheit sind Freiheit, Verantwortung, christliche Freiheit, Altes Testament, Neues Testament, Schöpfung, Exodus, Sünde, Gesetz, Tod, Rechtfertigungslehre, Glaube, Liebe, Nächstenliebe, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer.
- Citar trabajo
- Stefan Prill (Autor), 2014, Stundenentwurf: Freiheit und Verantwortung - Was macht mich frei?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284589