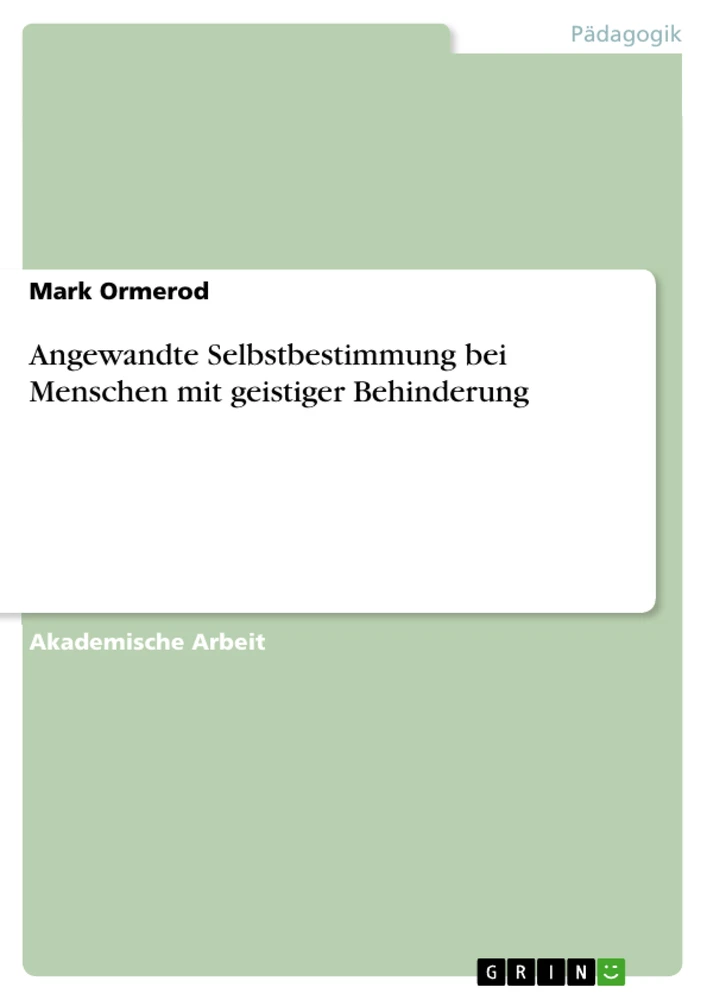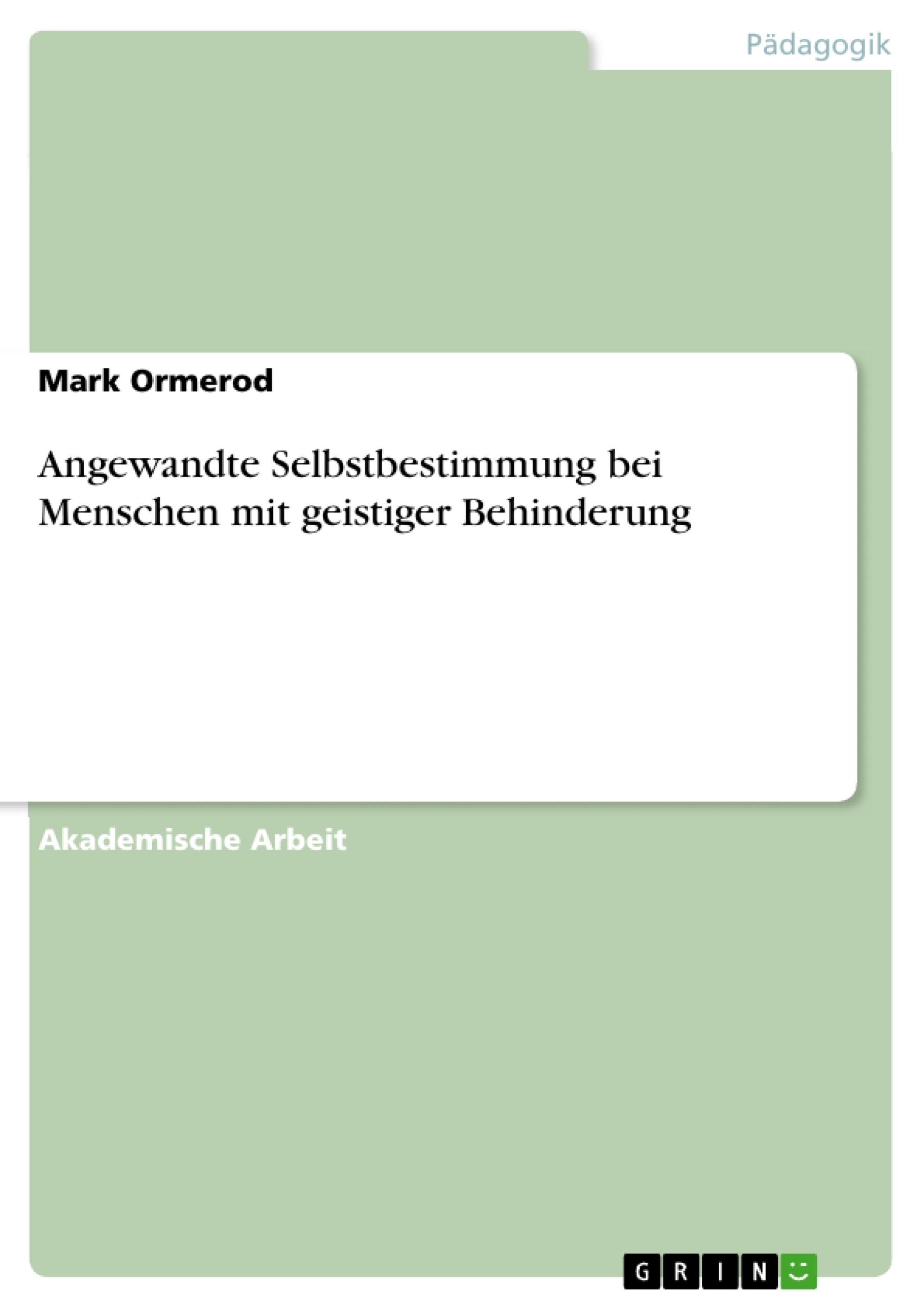Ich werde zu Beginn meiner Arbeit auf den Begriff der geistigen Behinderung Bezug nehmen und auf die vergangenen und aktuellen Lebensbedingungen von Menschen, die als geistig behindert gelten, eingehen. Darauf aufbauend sollen die bisherigen Überlegungen dann zusammengeführt werden.
Es wird um die Frage gehen, wie das Selbstbestimmungsparadigma auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden kann und welche bisherigen Errungenschaften und Erfolge in der Praxis bereits zu verzeichnen sind. Um den persönlichen Nutzen dieser Arbeit auch auf die handlungspraktische oder. fachlich-professionelle Ebene auszudehnen, gebe ich im letzten Teil Anregungen dazu, wie sich professionelle Helfer in Bezug auf ihr berufliches Selbstverständnis orientieren sollten und welche Rolle ihnen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung zuteilwerden muss, um Selbstbestimmung als „neue Kultur des Helfens“ zu fördern und zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschen mit geistiger Behinderung
- Definitionsansätze und Beschreibungsversuche
- Geschichte der Behindertenarbeit und Enthospitalisierung
- Von der Normalisierung zur Selbstbestimmung – Leitbilder in der Arbeit mit (geistig) behinderten Menschen
- Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung?
- Alltagsbezogene Selbstbestimmung durch tagesstrukturierende Aufgaben
- Wohnen, Arbeit und Freizeit -Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen
- Perspektiven / Beispiel eines Handlungsmodells aus der Praxis (Werkstatthaus Hamburg - Wohnen und Arbeiten in der Stadt)
- Konsequenzen für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit
- Werte, Einstellungen und Bereitschaft der Mitarbeiter
- Zur Rolle der professionellen Helfer
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich dem Thema der Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung und untersucht, wie optimale Bedingungen geschaffen werden können, um ein sinnerfülltes und befriedigendes Leben für diese Personengruppe zu ermöglichen.
- Definitionen und Beschreibungsversuche von geistiger Behinderung
- Entwicklungen der Behindertenarbeit und das Selbstbestimmungsparadigma
- Konkrete Beispiele und Handlungsmodelle aus der Praxis
- Die Rolle professioneller Helfer in der Förderung von Selbstbestimmung
- Werte und Einstellungen, die für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung notwendig sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung ein und beleuchtet die persönlichen Erfahrungen des Autors im Rahmen seiner Arbeit in einem Ferienprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung. Anschließend wird ein Überblick über die historische Entwicklung und die verschiedenen Definitionen von geistiger Behinderung gegeben. In Kapitel 3 wird untersucht, wie das Selbstbestimmungsparadigma auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden kann und welche praktischen Erfolge bereits erzielt wurden. Kapitel 4 präsentiert ein Beispiel eines Handlungsmodells aus der Praxis. In den abschließenden Kapiteln werden Konsequenzen für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit und die Rolle professioneller Helfer im Hinblick auf die Förderung von Selbstbestimmung diskutiert.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Selbstbestimmung, Behindertenarbeit, Enthospitalisierung, Normalisierung, Integration, Handlungsmodell, Professionelles Handeln, Soziale Arbeit, Werte, Einstellungen, Helferrolle.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Leitbild in der Behindertenarbeit gewandelt?
Der Fokus verschob sich von der reinen "Normalisierung" und Verwahrung hin zum Paradigma der Selbstbestimmung und Teilhabe.
Was bedeutet Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung?
Es bedeutet, Entscheidungen in allen Lebensbereichen – Wohnen, Arbeit und Freizeit – so weit wie möglich eigenständig treffen zu können.
Was ist das Werkstatthaus Hamburg?
Es dient als Praxisbeispiel für ein Handlungsmodell, das integratives Wohnen und Arbeiten mitten in der Stadt ermöglicht.
Welche Rolle haben professionelle Helfer heute?
Helfer sollen als Assistenten fungieren, die Selbstbestimmung fördern, anstatt stellvertretend für die Betroffenen zu entscheiden.
Was versteht man unter Enthospitalisierung?
Dies ist der Prozess der Auflösung großer Heime zugunsten von gemeindenahen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen.
- Quote paper
- Mark Ormerod (Author), 2004, Angewandte Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284729