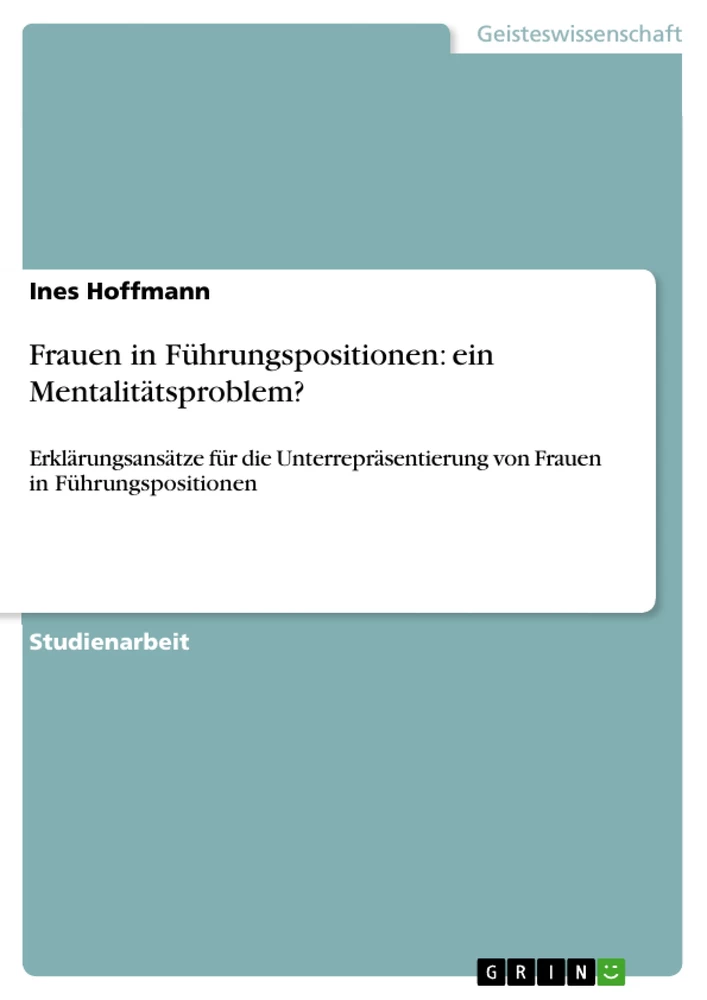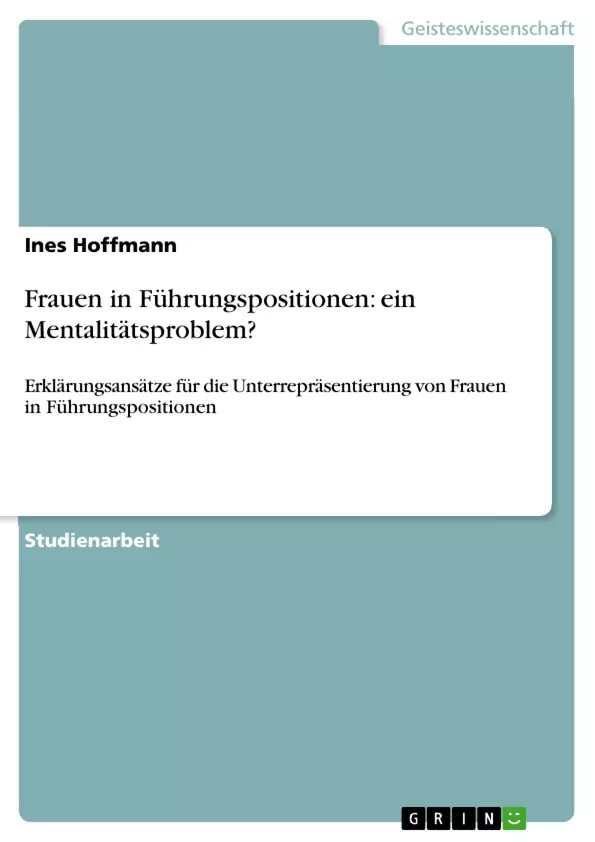Paul-Hermann Gruner behauptet in seinem Buch „Frauen und Kinder zuerst“, dass Frauen und insbesondere Feministinnen selbst schuld sind, wenn ihre Arbeiten kritisiert werden. Sie suchen die Opferrolle und sie ist ja auch bequemer. Das vielbeschworene Patriarchat ist seiner Meinung nach noch existent, weil „…ein Regelwerk zwischen zwei Vertragsparteien, das ausschließlich auf Kosten einer Partei existiert…“ binnen kurzer Zeit zusammenbricht und unmöglich 2500 Jahre bestehen kann. Die 100jährige Sklaverei der Schwarzen in Nordamerika, die Apartheid in Südafrika, der 70 Jahre andauernde Kommunismus einschließlich Lenins und Stalins Regentschaft sowie Hitlers vergleichsweise kurzer Auftritt in der Geschichte sollen beweisende Beispiele sein. Er resümiert: „Wer so lange vergeblich auf sein Recht pocht…ist entweder unfähig…oder…es gibt sie so gar nicht, diese Benachteiligung, und das Getöse von der Herrschaft des Mannes ist eine Behauptung mit äußerst begrenztem Wahrheitsgehalt.“ Er schlussfolgert, dass es sie also gegeben haben muss, die angenehmen Seiten der Männerherrschaft.
Barbara Bierach äußert sich in ihrem Buch „Das dämliche Geschlecht“ ganz ähnlich: Sie bemängelt, dass der Frauenanteil im Management verschwindend gering ist und stellt fest, dass sich erschreckend viele als Hausfrau und Mutter mit Mitte 30 in ein Vorstadtviertel zurückziehen. Aber gerade jene Frauen, resümiert sie, sind es dann, die sich darüber beschweren, dass die Anderen, die Männer, die Macht haben. Was also hält Frauen in Deutschland davon ab, eine Karriere anzustreben und sich 50 Prozent ihres Machtanteils einzufordern? Bierach betont, dass nicht die allein erziehenden Mütter gemeint sind, die von Sozialhilfe leben, sondern jene, die die besten Voraussetzungen haben: Junge Akademikerinnen mit Potential, ungenutzt verpufft. Wenn sich die Mühen endlich lohnen könnten, ziehen sie sich zurück und drücken sich davor, Verantwortung zu übernehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das soziokulturelle Erbe
- Traditionelle Wertvorstellungen und daraus resultierende Rollenkonflikte
- Sozialisation als Rechtfertigung? - Wie kommt es zu unterschiedlichen Denkmustern z. B. bei der Arbeitsteilung von Mann und Frau?
- Karriere und Karriereplanung
- (Eigenschafts-) Anforderungen
- Fachliche Qualifikation
- Begriff der Führungskraft
- Kriterien für den beruflichen Aufstieg
- Karrierehindernisse
- Warum Frauen weniger verdienen
- Die Unterrepräsentierung von Frauen in Führungspositionen und warum der Erziehungsurlaub zur Karrierefalle werden kann
- Warum Frauenförderungsprojekte und Quotenregelungen Frauen eher schaden als nutzen
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Traditionelle Wertvorstellungen und daraus resultierende Rollenkonflikte
- Weibliche Führungskräfte mit Kindern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen und hinterfragt, ob dieses Phänomen auf ein Mentalitätsproblem zurückzuführen ist. Die Arbeit untersucht, welche soziokulturellen und karrierebedingten Faktoren den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen behindern und welche Rolle die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt.
- Soziokulturelles Erbe und traditionelle Wertvorstellungen
- Einfluss von Sozialisation auf die Rollenverteilung von Mann und Frau
- Karriereplanung und -hindernisse für Frauen
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Herausforderung für Frauen
- Kritik an Frauenförderungsprojekten und Quotenregelungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen und stellt die Frage nach den Ursachen. Das zweite Kapitel behandelt das soziokulturelle Erbe und die daraus resultierenden traditionellen Wertvorstellungen, die sich auf die Rollenverteilung von Mann und Frau auswirken. Hierbei wird auch die Rolle der Sozialisation und die Entstehung von Geschlechterstereotypen analysiert. Im dritten Kapitel werden die Aspekte von Karriere und Karriereplanung beleuchtet, unter anderem die (Eigenschafts-) Anforderungen an Führungskräfte, die fachliche Qualifikation und die Kriterien für den beruflichen Aufstieg. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Karrierehindernissen für Frauen, wie z. B. dem niedrigeren Verdienst, der Unterrepräsentanz in Führungspositionen und dem Erziehungsurlaub als Karrierefalle. Weiterhin wird die Kritik an Frauenförderungsprojekten und Quotenregelungen diskutiert. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Herausforderung für Frauen, ihre Karriere mit der Familie zu vereinbaren. Dieses Kapitel beleuchtet insbesondere die traditionellen Wertvorstellungen, die dieses Feld beeinflussen. Das sechste Kapitel behandelt schließlich die Thematik der weiblichen Führungskräfte mit Kindern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Frauen, Führungspositionen, Unterrepräsentanz, Mentalitätsproblem, soziokulturelles Erbe, traditionelle Wertvorstellungen, Rollenkonflikte, Sozialisation, Karriereplanung, Karrierehindernisse, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Frauenförderungsprojekte, Quotenregelungen, weibliche Führungskräfte mit Kindern.
Häufig gestellte Fragen
Sind Frauen in Führungspositionen in Deutschland unterrepräsentiert?
Ja, die Arbeit stellt fest, dass der Frauenanteil im Management im Vergleich zu Männern immer noch verschwindend gering ist.
Was wird als „Karrierefalle“ für Frauen bezeichnet?
Insbesondere der Erziehungsurlaub und die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden als strukturelle Hindernisse für den beruflichen Aufstieg identifiziert.
Welche Rolle spielt die Sozialisation bei der Berufswahl?
Die Arbeit untersucht, wie traditionelle Wertvorstellungen und Rollenbilder bereits in der Kindheit Denkmuster prägen, die später die Karriereplanung beeinflussen.
Wie werden Frauenförderungsprojekte in der Arbeit bewertet?
Es wird die kritische Position diskutiert, dass Quotenregelungen und Förderprojekte Frauen unter Umständen mehr schaden als nützen könnten.
Was ist das „Mentalitätsproblem“ in Bezug auf Frauenkarrieren?
Die Arbeit hinterfragt, ob sich qualifizierte Frauen zum Teil bewusst aus der Verantwortung zurückziehen, anstatt Machtanteile aktiv einzufordern.
- Citar trabajo
- Ines Hoffmann (Autor), 2004, Frauen in Führungspositionen: ein Mentalitätsproblem?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28473